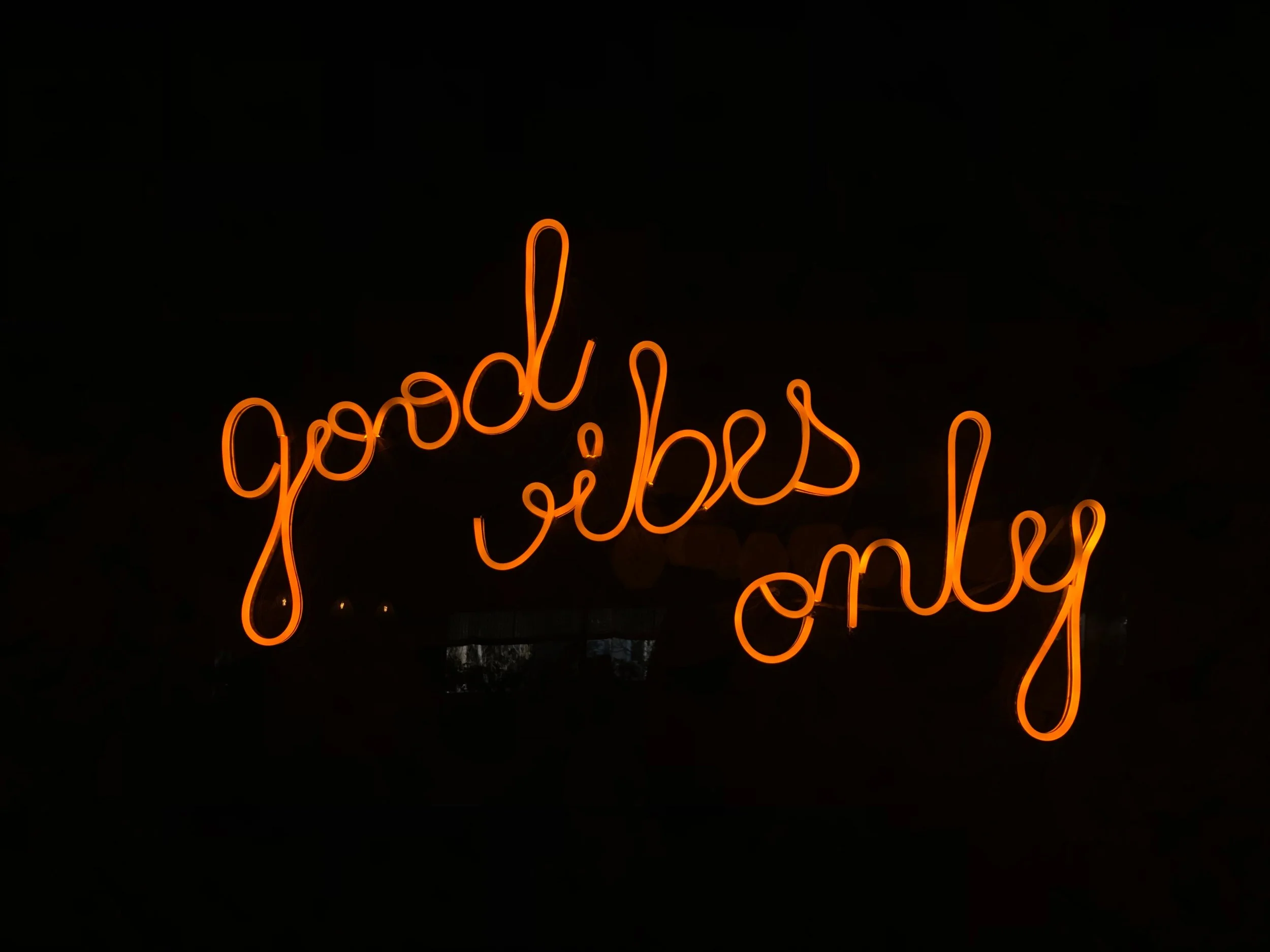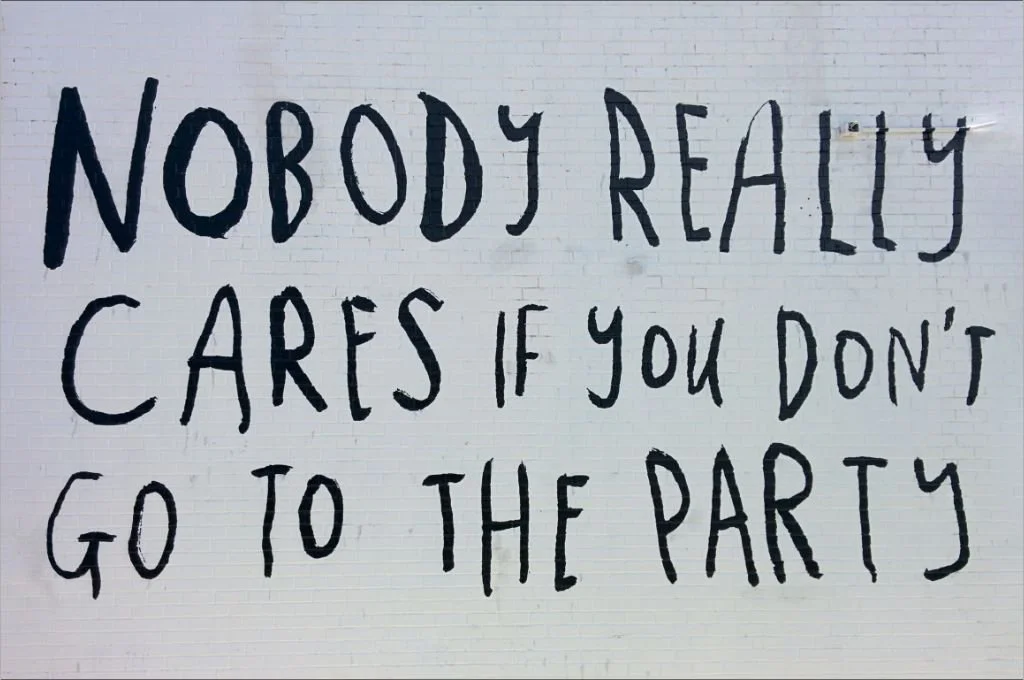Blog
Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.
Mein Buch „She Works Hard For No Money“ ist da 🎉
Es ist soweit: Heute erscheint mein neues Sachbuch „She Works Hard For No Money – eine feministische Kritik sozialer Medien“ bei Palomaa Publishing.🥳
Es ist soweit: Heute erscheint mein neues Sachbuch „She Works Hard For No Money – eine feministische Kritik sozialer Medien“ bei Palomaa Publishing.🥳
„She Works Hard For No Money“ kaufen oder bestellen
Du kannst das Buch ab sofort an allen üblichen Stellen kaufen oder bestellen, zum Beispiel:
Oder direkt in deiner Lieblingsbuchhandlung
*Dies ist ein Affiliatellink. Das bedeutet, dass ich eine Provision erhalte, wenn du über diesen Link kaufst. Für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Worum geht’s im „She Works Hard For No Money“?
„She Works Hard For No Money“ ist eine feministische Kritik sozialer Medien.
Wir denken, wir scrollen zur Entspannung, posten zum Spaß oder um uns mit anderen Menschen zu verbinden. Doch in Wahrheit leisten wir dabei Arbeit – unbezahlte Arbeit. Jede Interaktion, jeder Like, jedes Stück Content füttert ein System, das von unserer Aufmerksamkeit und Kreativität lebt, ohne uns dafür zu entlohnen.
Doch mir geht es nicht nur darum, dass wir Inhalte für Mark Zuckerbergs Plattformen erstellen und ihm for free dabei helfen, sein Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Es geht auch um unbezahlte ästhetische Arbeit, Emotionsarbeit, Selbstoptimierung und Mental Load.
Social Media ist längst keine harmlose Freizeitbeschäftigung mehr, sondern Teil eines riesigen Systems digitaler Ausbeutung. Besonders Frauen trifft das hart: Sie tragen ohnehin den Großteil unbezahlter Care-Arbeit – und nun auch die emotionale und kreative Arbeit, die Plattformen profitabel macht.
Mein Buch zeigt, wie Social Media uns in diese Rollen drängt, warum sich Arbeit und Freizeit immer mehr vermischen – und wie wir Wege finden können, unsere Zeit zurückzuerobern.
Für wen habe ich das Buch geschrieben?
Ich habe das Buch für all jene geschrieben, die sich von Social Media ausgelaugt oder überfordert fühlen.
Ich möchte zeigen: Ihre Erschöpfung ist kein persönliches Versagen, sie ist eine logische Folge eines Systems, das auf Ausbeutung beruht und Menschen systematisch an ihre Grenzen bringt.
Als Feministinnen stehen wir vor einem Dilemma:
Wir wollen unsere Botschaften möglichst weit verbreiten. Doch die Plattformen, auf denen wir das tun, gehören Tech-Milliardären, deren Hauptinteresse dem Profit gilt, nicht dem Wohl von Frauen. Genau über diese Widersprüche sollten wir sprechen und uns ihrer bewusst sein.
Ein Blick hinter die Kulissen
Was ist „Palomaa Publishing“ für ein Verlag?
Palomaa Publishing ist ein Indie-Verlag für feministische Sachbücher und Essays, der vor allem Frauen und nicht binären Personen eine Stimme gibt.
Der Verlag setzt sich für Gleichberechtigung und Vielfalt ein.
Wer hat das Vorwort geschrieben?
Das Vorwort zu „She Works Hard For No Money“ hat Mareice Kaiser geschrieben, Journalistin, Autorin und Moderatorin aus Berlin.
Vielleicht hast du ja mal ihr Buch „Das Unwohlsein der modernen Mutter“ gelesen? (Wenn nein, unbedingt nachholen!)
Wer hat das Cover gemacht?
Die tolle Illustration auf dem Cover stammt von der Künstlerin Sophie Kuhn, deren Markenzeichen weiblich gelesene Personen mit grimmigen Gesichtern sind.
Die Umschlaggestaltung kommt von Grafikerin Katja Rub.
Warum heißt das Buch „She Works Hard For No Money“?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe ein Faible für abgewandelte Songtitel, wie mir spätestens bei meinem neuen Podcast klargeworden ist.🫣
Abgesehen davon fand ich es witzig, wie Donna Summer zum Titel „She Works Hard For The Money“ gekommen ist:
Sie war 1983 auf der Geburtstagsparty von niemand Geringerem als Julio Iglesias und entdeckte auf dem Klo Onetta Johnson, die auf dem Stuhl eingeschlafen war. „Wow, sie arbeitet aber hart fürs Geld“, sagte Donna zu ihrer Managerin.
Was hätte Donna Summer wohl angesichts einer müden Influencerin gesagt, fragte ich mich? So kam es zum Titel.
Lesung oder Vortrag für deine Community?
Ist eine feministische Perspektive auf Social Media und/oder Marketing auch für deine Online- oder Offline-Community spannend?
Für eine Lesung oder einen Vortrag bin ich natürlich immer zu haben! Sprich mich gerne an.
Social Media: Die moderne Sunk Cost Fallacy
Die Sunk Cost Fallacy ist ein Denkfehler, bei dem wir an etwas festhalten, weil wir bereits Zeit, Geld oder Energie investiert haben – selbst wenn es vielleicht besser wäre, einen anderen Weg einzuschlagen. Auch Selbstständige fallen in diese Denkfalle, wenn es um Social Media geht und sie denken: „Ich habe schon so viel Zeit in Instagram & Co. gesteckt – jetzt kann ich unmöglich damit aufhören!“
Kennst du das?
Du schaust einen furchtbaren Film zu Ende, nur weil du schon die Hälfte gesehen hast.
Oder du trägst diese unbequemen (aber teuren!) Schuhe weiter, obwohl sie für dich unangenehm sind.
Vielleicht liest du auch in einem Buch weiter, das dich langweilt, nur weil du bereits 100 Seiten gelesen hast.
Oder du isst im Restaurant deine Portion auf, obwohl du längst satt bist – schließlich hast du dafür bezahlt.
In der Betriebswirtschaftslehre gibt es dafür einen Begriff: die Sunk Cost Fallacy.
Das ist ein Denkfehler, bei dem wir an etwas festhalten, weil wir bereits Zeit, Geld oder Energie investiert haben – selbst wenn es vielleicht besser wäre, einen anderen Weg einzuschlagen.
Sunk Cost Fallacy und Social Media
Viele Selbstständige fallen genau in diese Denkfalle, wenn es um Social Media geht. Der Gedanke geht in etwa so:
„Ich habe schon so viel Zeit in Instagram & Co. gesteckt – jetzt kann ich unmöglich damit aufhören!“
Die Aussicht, Social Media zu verlassen, fühlt sich weniger wie Befreiung an, sondern eher wie ein Verlust, den es unbedingt zu vermeiden gilt.
Doch selbst mit kapitalistischer Brille betrachtet ist das irrational:
Wenn soziale Medien täglich deine Zeit, Energie und Geld verschlingen, ohne dir nennenswerte Ergebnisse zu liefern – solltest du dann nicht schnellstmöglich aufhören, diese kostbaren Ressourcen zu verschwenden?
Die harte Wahrheit über Social Media
Soziale Medien vermitteln uns das Gefühl, nur noch einen Post von einem viralen Hit oder einer neuen Kundin entfernt zu sein.
Doch das ist einfach nicht wahr.
Es mag Selbstständige und Unternehmer*innen geben, die auf, mit oder durch Social Media überdurchschnittlich erfolgreich sind.
Doch für die meisten werden sich die großen Social-Media-Versprechen nicht erfüllen:
Nur 4% aller Influencer*innen können vollständig von ihrem Instagram-Account leben. (Quelle)
Über 75% der Influencer*innen in Deutschland sind Nano- oder Micro-Influencer:innen, deren Verdienst gerade so ausreicht, um ihre Social-Media-Tätigkeit zu finanzieren. (Quelle)
Belastbare Zahlen, die zeigen, für wie viele Selbstständige sich Social-Media-Marketing tatsächlich lohnt, existieren meines Wissen überhaupt nicht.
Eine ehrliche Bestandsaufnahme könnte helfen
Wenn du am liebsten noch heute aus Social Media aussteigen würdest, aber zögerst, weil du schon so viel investiert hast, wäre es hilfreich zu bedenken:
Deine bereits investierten Ressourcen (die „versunkenen Kosten“) sind weg und sollten keine Rolle bei deiner Entscheidung über die Zukunft spielen.
Stattdessen solltest du nur betrachten, was ab jetzt das Beste für dich ist:
Social-Media-Marketing – oder Marketing ohne Social Media?
8 Fragen zum Weiterdenken
Vielleicht sind diese Fragen für deine Überlegungen hilfreich:
Wie viel Zeit verbringst du wöchentlich mit Social Media-Marketing und was könntest du in dieser Zeit stattdessen tun?
Welche konkreten, messbaren Ergebnisse haben dir soziale Medien in den letzten sechs Monaten gebracht?
Würdest du heute wieder mit Social Media anfangen, wenn du noch nicht dort wärst?
Welche alternativen Marketingkanäle hast du bisher vernachlässigt, die möglicherweise besser zu dir und deinen Stärken passen könnten?
Wie würde dein Arbeitsalltag aussehen, wenn du Social Media komplett aus deiner Marketingstrategie streichen würdest?
Was ist dein größtes Argument FÜR Social Media – abgesehen von den bereits investierten Ressourcen oder der Hoffnung auf Reichweite?
Welche deiner Kund*innen hast du tatsächlich über Social Media gewonnen und wie zufrieden bist du mit diesen Kundenbeziehungen?
Fühlst du dich nach dem Posten und Interagieren auf Social Media energiegeladen oder erschöpft?
Möglichkeiten abseits von Social Media
Vielleicht ist es an der Zeit, die Sunk Cost Fallacy hinter dir zu lassen und ein Marketing zu finden, das wirklich zu dir passt?
Additive Bias – Wie sich die kognitive Verzerrung im Marketing zeigt
Die Additive Bias ist eine kognitive Verzerrung, eine menschliche Denkfalle: Wir denken, dass wir eine Situation mit Ergänzungen oder Hinzufügungen verbessern und kommen oft gar nicht auf die Idee, dass Weglassen, Einsparen und Co. die besseren Alternativen wären. Wie sich die Additive Bias im Marketing zeigt und was wir dagegen tun können, zeige ich in diesem Artikel.
Neulich habe ich von einer spannenden Studie in der Nature gelesen:
Mehr als tausend Versuchspersonen aus den USA, Japan und Deutschland wurden mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert und es zeigte sich, dass die meisten Menschen dazu neigten, Probleme dadurch zu lösen, dass sie etwas hinzufügten, statt etwas wegzunehmen.
Ich fühlte mich seltsam ertappt. Doch da bin ich vermutlich nicht die einzige.
Es sei, so die Forschenden, eine grundsätzliche menschliche Denkfalle, eine kognitive Verzerrung:
Wir denken, dass wir eine Situation mit Ergänzungen oder Hinzufügungen verbessern und kommen oft gar nicht auf die Idee, dass Weglassen, Einsparen und Co. die besseren Alternativen wären.
Additive Bias im Alltag
Diese Additive Bias zeigt sich im Alltag überall:
Zu viel Zeugs bekämpfen wir lieber mit neuen Schränken und neuen Ordnungsboxen als mit radikalem Ausmisten.
Wir wollen gesünder leben und kaufen uns dafür lieber teure Nahrungsergänzungsmittel mit 70 Inhaltsstoffen, statt einfach Alkohol, Fleisch oder Zucker wegzulassen. (Und damit gleichzeitig auch noch viel Geld zu sparen.)
Bei Stress suchen wir uns lieber neue Techniken (Mediation! Achtsamkeit! Yoga!), um unser Leid zu lindern, statt uns einfach mal weniger auf die To-do-Liste zu schreiben und dadurch vielleicht die Ursache für Stress zu beseitigen.
Doch warum ist das so?
Forschende vermuten, dass unser Gehirn die Weglasserei nicht so gerne mag. Wer versucht, nicht an einen rosa Elefanten zu denken, weiß sofort, was sie meinen.
Auch im Marketing neigen wir dazu, nach neuen Tricks, Trends und Hypes Ausschau zu halten, obwohl in so vielen Fällen systematisches Weglassen die bessere Idee wäre.
Additive Bias in der Marketingpraxis – und wie wir sie überwinden
Nicht noch weitere Aspekte und Absätze machen deine Marketingtexte meist besser, sondern Editieren, Löschen, Streichen.
Wen Marketing überfordert, kann eine Plattform, die einem wie Dementoren jegliches Glück aus dem Körper zieht (hallo Instagram!), weglassen – statt noch mehr Tricks, Hacks und Tipps auszuprobieren, um die Plattform zum Laufen zu bringen.
Nicht nur unsere Schränke, sondern auch unsere olle Marketingstrategiekiste sollte von Zeit zu Zeit ausgemistet werden. Oft stellt sich eine größere Zufriedenheit ein, wenn wir uns von Marketingstrategien verabschieden (tschüss, Werbeanzeigen!), als wenn wir neue hinzunehmen und uns wieder in ein neues Thema einarbeiten müssen und Platz im Kopf belegen.
Statt neue Marketingstrategien zu lernen, können wir uns zum Ziel setzen, problematische Marketingstrategien bewusst zu verlernen – auf Nimmerwiedersehen, künstliche Verknappung, FOMO und Co.!
Wir müssen nicht zwingend nach noch mehr Umsatz als Onlineunternehmer*innen streben, sondern können stattdessen unseren Fokus darauf richten, welche Tools, Plattformen, Strategien und Aktionen wir uns sparen können.
Fängst du erst einmal an, deinen Blick für die Dinge zu schärfen, die du in deiner Selbstständigkeit weglassen kannst, kannst du quasi nicht mehr damit aufhören.
Also:
Was darf es für dich ab sofort nicht mehr sein?
Worauf willst du in Zukunft verzichten?
Was willst du ausmisten, löschen, verlernen, entfernen, aussortieren, streichen, dir sparen?
Welche Herausforderung, welches Problem willst du lösen, indem du etwas weglässt – Social Media, Launchen, Skalieren, Werbeanzeigen, Reels drehen, Webinare halten, ein Team haben?
Tob dich aus!
Social Media löschen meets Feminismus
„Social Media löschen“ ist ein feministisches Thema, auch wenn für meinen Geschmack darüber noch zu wenig aus feministischer Perspektive gesprochen wird.
Am 25. August 2020 habe ich das letzte Mal etwas auf Instagram gepostet und am 21. September 2021 dann meinen Account gelöscht. TikTok, Facebook, Twitter und Pinterest folgten bald.
Ich ging diesen Schritt, weil ich merkte, dass mir soziale Medien nicht (mehr) gut taten.
Ja, Instagram und Co. haben einen mittlerweile unbestreitbaren negativen Effekt auf unsere Psyche. Doch wenn wir Instagram verlassen, weil wir merken, dass es uns nicht gut tut, dort zu sein – ist das eine Schwäche oder nicht viel mehr ein emanzipatorischer Akt?
Als ich im September 2021 dann endlich auf „Löschen“ klickte, war es für mich genau das: eine Möglichkeit, mich von dem Zwang zur Selbstoptimierung und dem chronischen Neid auf andere zu befreien und meine Selbstbestimmung zurückzugewinnen.
Denn die Sache mit der Selbstbestimmung ist die: Sie hört nicht auf, nur weil wir das „Real Life“ verlassen und die Welt der Likes und Selfies betreten.
Auch was Social Media angeht, haben wir die Wahl:
So wie wir entscheiden dürfen, ob wir Kinder mitten im Studium bekommen oder gar nicht, ob wir Ärztin werden oder eine Promotion abbrechen, ob wir uns als Frauen verstehen oder gar nicht erst im binären Geschlechtssystem verorten, ob wir Männer lieben oder einen queeren Menschen, dürfen wir auch wählen, wie wir mit Social Media verfahren:
Wir dürfen Social Media aktiv oder passiv nutzen und es toll finden. Wir dürfen es aber auch sein lassen und unser Leben völlig ohne Social Media gestalten. Wir haben die Wahl.
Deshalb ist das Thema „Social Media löschen“ ein feministisches Thema, auch wenn darüber noch zu wenig aus feministischer Perspektive geredet wird.
Vielleicht liegt das daran, dass soziale Medien vom Grundprinzip feministisch anmuten: Sie bieten Chancen zu mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit; und im Gegensatz zur früheren Medienlandschaft gibt es – vermeintlich – keine Gatekeeper mehr, die darüber entscheiden, wer was und in welcher Form veröffentlichen darf.
Jede*r kann mit nur wenigen Klicks einen Account anlegen und die eigene Meinung kundtun; und sicherlich hat auch das dazu geführt, dass feministische Themen in den letzten zwei Jahrzehnten entmystifiziert und einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurden.
Doch was ist, wenn wir einen zweiten Blick auf Social Media riskieren und uns die Menschenbilder, Strukturen und Mechanismen dahinter anschauen?
Was ist, wenn wir uns fragen, was soziale Medien mit Menschen anstellen und ob sie menschliche Kommunikation zum Guten verändern?
Was ist, wenn wir uns die Frage erlauben, ob soziale Netzwerke – neben der Tatsache, dass sie zweifelsohne viele Menschen ermächtigen – nicht auch ein Diskriminierungssystem sind, das Frauen ausbeutet, abwertet und Stereotype und veraltete Rollen reproduziert?
Ist es vor dem Hintergrund der Funktionsweise von sozialen Medien wirklich so „krass“, „radikal“ oder „kontraproduktiv“, Social-Media-Kanäle zu löschen, oder nicht eher absolut verständlich und vielleicht sogar … folgerichtig?
Was Emotionsarbeit mit unserer Selbstständigkeit zu tun hat
Was ist Emotionsarbeit, was hat das mit Selbstständigkeit, Social Media und Dienstleistungen zu tun und wie können wir mit den Auswirkungen und Herausforderungen von Emotionsarbeit zurechtkommen?
Hast du schon einmal locker, flockig in die Kamera für eine Instastory gesprochen und so getan, als wärst du bester Laune, obwohl dir gerade eigentlich eher nach Heulen zumute war?
Warst du schon einmal freundlich zu einem Kunden, obwohl du ihn aufgrund seiner problematischen Aussagen am liebsten zum Mond geschossen hättest?
Hast du auch schon mal eine Kollegin angelächelt, obwohl dir gerade gar nicht nach lächeln war?
Wenn du diese oder ähnliche Situationen schon einmal erlebt hast, dann hast du bereits Bekanntschaft mit Emotionsarbeit gemacht.
Was Emotionsarbeit ist, was es mit der Selbstständigkeit und Social Media zu tun hat und warum es so wichtig für Selbstständige ist, sich der geleisteten Emotionsarbeit bewusst zu werden, möchte ich in diesem Blogartikel zeigen.
Was ist Emotionsarbeit?
Emotionsarbeit ist ein Konzept, das in der Soziologie und Psychologie eine immer größere Bedeutung erlangt. Im Kern geht es um die Anstrengungen, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, auszudrücken oder zu modifizieren, um sozialen Erwartungen gerecht zu werden.
Emotionsarbeit tritt in verschiedenen Bereichen des Lebens auf: auf der Arbeit, in der Partnerschaft, in der Eltern-Kind-Beziehung oder auf Social Media.
Emotionsarbeit als Selbstständige
Gerade in Dienstleistungs- und Serviceberufen haben Selbstständige häufigen Kontakt zu anderen Menschen. Per E-Mail, in Zoom, auf Social Media oder persönlich. Und natürlich geht diese Arbeit mit verschiedensten emotionalen Zuständen einher:
Manchmal geht es uns gerade nicht gut. (Wir fühlen uns traurig, wütend, gestresst, leer oder irgendwas dazwischen.)
Manchmal geht es unserem Gegenüber nicht gut (Er fühlt sich traurig, wütend, gestresst, leer oder irgendwas dazwischen.).
Doch egal, wie es uns oder unserem Interaktionspartner geht – die meisten Selbstständigen bemühen sich in solchen Situationen, professionell zu bleiben und das heißt: freundlich, empathisch, zurückhaltend.
Und so haben wir selbst in Zeiten größter persönlicher Herausforderungen ein Lächeln für unsere Kund*innen übrig. Oder bleiben ruhig, selbst wenn es – angesichts eines doofen Spruchs – innerlich in uns tobt.
Emotionsarbeit auf Social Media
Auch auf Social Media findet Emotionsarbeit statt.
Jemand findet in einem Kommentar nicht gerade nette Worte für uns – wir schlucken’s runter und versprühen weiterhin „Good Vibes“.
Und auch der Druck, ständig glücklich, erfolgreich und positiv zu erscheinen, führt zu einer verstärkten Emotionsarbeit, denn – surprise, surprise – wir sind nicht jeden Tag glücklich, erfolgreich und positiv.
Es gibt viele weitere Formen emotionaler Arbeit auf Social Media:
Vergleich: Wir vergleichen jeden Aspekt unseres Berufslebens mit anderen und müssen mit Gefühlen wie Unzulänglichkeiten klarkommen.
Inszenierung: Wir stellen uns anders da, als wir wirklich sind. Manchmal ist die Abweichung minimal. Manchmal etwas größer. Was macht das mit unseren Gefühlen?
Bewertungen: Likes oder keine Likes, positive, negative oder gar keine Kommentare. Wir werden auf Social Media ständig bewertet – das ist nicht immer angenehm. Kritik oder Anfeindungen erfordern emotionale Resilienz.
Erwartungen: Was, wie und wie oft wir posten – unsere Follower haben ganz konkrete Erwartungen und lassen es uns öfter auch wissen, wenn wir ihre Erwartungen enttäuscht haben. Wie geht es uns dabei? Reden wir mit jemandem darüber?
Privatsphäre: Selbstständige müssen ständig entscheiden, wie viel von sich selbst sie auf Social Media zeigen wollen. Das erfordert Emotionsarbeit.
Andere Formen der Emotionsarbeit
Auch eine Migrationsgeschichte kann bedeuten, zusätzliche Emotionsarbeit leisten zu müssen. Neben Marketing, Buchhaltung und der Zusammenarbeit mit Menschen geht es bei Selbstständigen mit Migrationsgeschichte oft auch darum, aktuelle Ereignisse wie Krieg und Krisen zu verarbeiten oder mit Traumata umzugehen.
Auch aus feministischer Perspektive ist Emotionsarbeit wichtig. Denn es sind häufig Frauen, die – in der Familie oder im Büro – Streit schlichten, vermitteln oder für Harmonie sorgen.
Die Auswirkungen von Emotionsarbeit
Warum ist es für Selbstständige nun so wichtig, über Emotionsarbeit Bescheid zu wissen?
Zunächst einmal: Weil Emotionsarbeit auch Arbeit ist. Selbst wenn sie nicht bezahlt, nicht wertgeschätzt und oft auch nicht gesehen wird, erfordert Emotionsarbeit unsere Zeit, Energie und manchmal auch Geld.
Das kann dazu führen, dass wir uns müde fühlen, ja regelrecht erschöpft und ausgebrannt. Selbst wenn wir nicht viele Termine haben und eigentlich nur im Homeoffice arbeiten.
Eng mit der Emotionsarbeit verknüpft ist auch das Konzept der emotionalen Dissonanz.
Emotionale Dissonanz tritt auf, wenn es eine Spannung gibt zwischen den tatsächlichen Emotionen und den Emotionen, die gezeigt oder ausgedrückt werden.
Klassisches Beispiel: Aufgrund einer Trennung oder eines Todesfalls ist jemand zutiefst traurig, zwingt sich aber dazu, auf Instagram „Good Vibes“ zu versprühen. Das erzeugt einen inneren Konflikt, der dann noch mehr Emotionsarbeit benötigt.
Manchmal kann der Erwartungsdruck auf Social Media, ständig gut gelaunt zu sein, sich bis ins Toxische steigern, was wiederum zu verstärkter Emotionsarbeit führen kann. Denn die Erwartung, immer glücklich oder positiv zu sein, heißt oft, die tatsächlich erlebten Gefühle zu unterdrücken oder zu verstecken.
Was ist im Hinblick auf Selbstständigkeit und Emotionsarbeit wichtig?
Es geht nicht darum, Emotionsarbeit abzuschaffen. Im Gegenteil: Emotionsarbeit ist notwendig für eine Gesellschaft.
Wem als Selbstständige*r psychische Gesundheit wichtig ist, sollte aber erst einmal ganz grundlegend anerkennen und auf dem Schirm haben, dass es Emotionsarbeit gibt und dass sie geleistet wird. Oft jeden Tag.
Vor allem bei Selbstständigen in Dienstleistungsberufen, auf Social Media, mit Migrationsgeschichte oder bei Selbstständigen mit Kindern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Emotionsarbeit einen großen Teil der Zeit und Energie beansprucht. (Und Introvertierte können Emotionsarbeit vielleicht sogar noch zusätzlich als anstrengender empfinden.)
Was mir persönlich geholfen hat, war bekanntermaßen, Social Media zu verlassen und in meinem Marketing auf Social-Media-freie Plattformen zu setzen.
Ansonsten ist authentischer Selbstausdruck oft die beste Prävention. Und in einem akuten Fall von Erschöpfung heißt es: gut zu sich sein, ausruhen und Auszeiten einlegen. Auch wenn das bedeutet, nicht so schnell voranzukommen, wie die schnelllebige Welt das von uns will.
10 Argumente gegen personalisierte Werbung auf Social Media
Kritische Perspektive auf personalisierte Werbeanzeigen in sozialen Medien: Im Blogartikel nenne ich zehn wichtige Argumente, die gegen die Nutzung von Social-Media-Ads sprechen.
Seit ungefähr 2,5 Jahren nutze ich keine Werbeanzeigen mehr in meinem Marketing.
Angefangen hat das Ganze eher unfreiwillig: Nachdem ich jahrelang auf Facebook und Instagram Werbung geschaltet hatte, wurden meine Ads von einem Tag auf den anderen nicht mehr ausgespielt.
Einfach so.
Ich hatte die Werbeanzeigen genauso erstellt, wie ich sie seit vier Jahren immer erstellte. Und ich nutzte genau die Kampagnenziele, die ich immer nutzte. Der Werbeanzeigenmanager zeigte an, dass alles korrekt war – doch die Anzeigen gingen nicht raus und es wurde kein Geld verbraucht.
Auch zwei Marketingberater*innen, die sich auf FB-Ads spezialisiert hatten und die ich in meiner Verzweiflung buchte und drüber gucken ließ, konnten nicht herausfinden, woran es lag. „Alles sieht korrekt aus“, so das einhellige Urteil. „Eigentlich müsste es funktionieren …“
Tat es aber nicht. Auch der Facebook-Support konnte mir nicht weiterhelfen. Oder besser gesagt: Wollte es nicht. Nach zwei Mal hin und her mailen bekam ich die leicht gereizte Antwort, dass ich doch bitte davon Abstand nehmen sollte, sie weiterhin zu kontaktieren.
Da stand ich nun kurz vor einem Launch, bei dem ich felsenfest mit Werbeanzeigen gerechnet hatte. Und der Facebook-Werbeanzeigenmanager zeigte mir den Stinkefinger.
Zuerst war ich entsetzt. Schließlich waren Werbeanzeigen ein essentieller Bestandteil in meinem Marketing. Doch schon bald nahmen meine Bemühungen, mein Werbeanzeigenkonto wieder zum Laufen zu bringen, eine andere Richtung – die entgegengesetzte.
Und heute, 2,5 Jahre später, schalte ich freiwillig und ganz bewusst keine Werbeanzeigen mehr in meinem Marketing.
Warum, erzähle ich dir in diesem Blogartikel.
Argumente für personalisierte Werbung auf Social Media
Doch lass uns zunächst einmal über die Argumente für Werbeanzeigen sprechen. Vermutlich sind sie dir auch wohlbekannt. Denn in der Marketingwelt ist diese Ansicht dominant:
Wir können mit Werbeanzeigen gezielt eine bestimmte Gruppe von Menschen ansprechen. Frauen zwischen 30 und 40 aus München, die gerne golfen? Kein Problem mit dem mächtigen Werbeanzeigenmanager!
Wir können bestimmte Posts, die organisch zu wenige Menschen aus unserer Community erreichen, gezielt pushen und einer größeren Gruppe von Menschen ausspielen.
Wir können unsere Freebies, Webinare & Co bewerben und so erfolgreich unsere E-Mail-Liste aufbauen oder launchen.
Reichweite aufbauen, Sichtbarkeit erhöhen und Skalieren gehen mit Werbeanzeigen viel schneller als ohne.
Wir können mit sogenannten Retargeting-Kampagnen die Menschen kontaktieren, die sich ein Produkt von uns angeguckt oder in den Warenkorb gelegt haben. Damit können wir Verkäufe ankurbeln und Umsätze steigern.
An sich will ich diesen Argumenten auch gar nicht widersprechen. Doch was viel seltener thematisiert wird, sind die vielen Argumente, die gegen Werbeanzeigen, insbesondere personalisierte Werbung, sprechen.
Hier kommen zehn davon.
Argumente gegen personalisierte Werbung auf Social Media
#1 Das Abhängigkeits-Argument
Aus meiner Geschichte, die ich zu Beginn des Textes geteilt habe, wird deutlich: Wenn wir unser gesamtes Marketing auf Werbeanzeigen aufbauen, machen wir uns verdammt abhängig.
Solange alles reibungslos funktioniert, finden wir Abhängigkeit meist gar nicht schlimm. Doch sobald etwas nicht so läuft, wie es soll, merken wir, dass Abhängigkeit zum Problem werden kann.
Es gibt eine Menge Dinge, die passieren können, obwohl wir uns überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen und keine Communityrichtlinien verletzen.
Meine Geschichte, dass ich von einem Tag auf den anderen einfach keine Anzeigen mehr schalten konnte, ist vergleichsweise harmlos.
Es gibt Onlineunternehmer*innen, deren Konten werden trotz gutem Passwort und Zweifaktor-Authentifizierung gehackt und gesperrt. Mit gravierenden Folgen für alle Beteiligten.
Und manchmal passiert das sogar im großen Stil, zum Beispiel wenn Facebook-Mitarbeitende gegen Bezahlung externen Unternehmen Zugriff auf Tools zur Kontowiederherstellung geben.
Wenn darüber hinaus der Facebook-Support die Nutzer*innen mit ihren gehackten, gesperrten oder nicht funktionierenden Konten alleine lässt, ist das keine gute Kombination.
Abhängigkeit von einer Social-Media-Plattform klingt total normal? Ist es nicht. Mit anderen Marketingstrategien ist es nämlich so:
Falls mich mein Newsletter-Tool irgendwann nervt, kann ich meine E-Mail-Kontakte exportieren und zu einem anderen Anbieter wechseln. Falls ich irgendwann Squarespace nicht mehr gut finden sollte, kann ich wieder zu WordPress wechseln. Falls ich Probleme mit meinem Podcast-Hoster hätte, würde ich einfach einen anderen nehmen.
Doch bei Werbeanzeigen?
Falls Meta und Co. irgendetwas an der Funktionsweise ändern oder unser Konto nicht mehr funktioniert, können wir nicht einfach unsere sieben Sachen packen und zu einer Konkurrenzplattform wechseln. Solange wir Werbeanzeigen schalten wollen, sind wir an diese Plattformen gebunden.
#2 Das Privatsphäre-Argument
Die Werbung, die wir auf Social Media schalten können, ist nicht einfach nur Werbung. Sie ist personalisierte Werbung.
Im Gegensatz zu Massenwerbung bekommen Menschen bei personalisierter Werbung die Themen angezeigt, für die sie sich interessieren. Passgenau. Individuell. Zielgerichtet.
Was für alle Beteiligten praktisch klingt, ist bei näherem Hinsehen problematisch. Denn wie genau funktioniert personalisierte Werbung auf Social Media überhaupt?
Zunächst einmal, indem ein Unternehmen wie Meta Daten zu einem Wirtschaftsgut erklärt.
Alles, was wir auf Facebook oder Instagram tun, wird deshalb registriert, gemessen und gespeichert. Ebenso das, was wir außerhalb von Facebook und Instagram online tun.
Websites, die den Meta-Pixel eingebunden haben, geben alle Informationen an Meta weiter: was wir im Netz lesen, wie lange wir uns Videos angucken, was wir in den Warenkorb gelegt haben (aber nicht kaufen) und vieles mehr. Diese Informationen über uns werden an Werbetreibende verkauft. Damit möglichst viele dieser Daten erhoben und verkauft werden können, ist Metas oberstes Ziel, dass Menschen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Algorithmen, die emotionalisierende Inhalte pushen, helfen dabei. ⬅️ Das ist Metas Geschäftsmodell in a nutshell.
Die Harvard-Professorin und Autorin Shoshana Zuboff spricht in ihrem gleichnamigen Buch von einem „Überwachungskapitalismus“. Konzerne wie Meta (aber auch Google oder Microsoft) sammeln, analysieren und speichern eine große Menge an Daten über Menschen und ermöglichen damit, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen (um nicht zu sagen: zu manipulieren).
Für Zuboff stellt das Geschäftsmodell mit den Daten demokratische Normen in Frage, was sich in der Vergangenheit vielfach bestätigt hat:
Mikrotargeting mag also nach einer tollen Chance für Selbstständige und Unternehmen klingen, ja. Doch es stellt eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie dar, die so langsam nicht mehr wegdiskutiert werden kann.
Besonders ärgerlich ist es, wenn der Einsatz des Meta-Pixels „aus Versehen“ oder unreflektiert passiert, wie jüngst bei der Polizei in Großbritannien. Sie hatte den Pixel auf einer Seite verwendet, auf der Menschen häusliche oder sexualisierte Gewalt melden konnten. Die Folge: Durch den Pixel gab die Polizei diese sensiblen Informationen an Meta weiter, sodass Meta jetzt genau weiß, wer potentiell von häuslicher / sexualisierter Gewalt betroffen ist.
Wer nun sagt, dass er doch gar nichts zu verbergen habe, sei daran erinnert, dass Privatsphäre ein Grundrecht ist, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Charta der Grundrechte verankert ist.
Es geht nicht darum, ob wir etwas zu verbergen haben, sondern darum, dass es Grundrechte zu schützen gilt. Schließlich setzen wir ja auch nicht gleich die Meinungsfreiheit außer Kraft, nur weil wir mal nichts zu sagen haben.(1)
#3 Das Rechtsargument
Das Problem ist aber nicht nur, dass Unternehmen wie Meta all diese Daten erheben, analysieren, verarbeiten, speichern und verkaufen. Das Problem ist auch, dass sie es meist ohne das explizite Einverständnis der Menschen tun.
Denn auch wenn die meisten Selbstständigen, Onlineunternehmer*innen und Unternehmen auf personalisierte Werbung setzen, heißt es nicht, dass sie es rechtskonform tun.
Die Rechtslage (2) sieht zur Zeit so aus, dass Websitenbetreiber*innen dafür verantwortlich sind, den Meta-Pixel datenschutzkonform einzubinden. Ein Hinweis zum Meta-Pixel in den Datenschutzhinweisen reicht dazu nicht aus.
Datenschutzkonform ist die Nutzung des Meta-Pixels meinem Verständnis (2) dann, wenn
Menschen aktiv in die Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke einwilligen (Opt-in)
Menschen der Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen können (Opt-out)
der Meta-Pixel erst dann lädt und Daten erhebt, nachdem das Einverständnis erteilt wurde
Gerade der letzte Punkt ist technisch wohl nicht immer so leicht umzusetzen und verlangt – je nach CMS und Cookie-Banner – Coding-Kenntnisse.
#4 Das Ethik-Argument
Doch selbst wenn der Einsatz des Meta-Pixels rechtskonform ist und sich Selbstständige und Unternehmen offiziell nichts „zu Schulden“ kommen lassen – die wenigsten Menschen blicken wohl wirklich durch, was passiert, wenn sie beim Cookie-Banner auf „Annehmen“ klicken.
Hinzu kommt noch, dass es inzwischen eine ganze Marketingdisziplin gibt, die sich damit befasst, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, möglichst viele ihrer persönlichen Daten preiszugeben, damit möglichst zielgerichtete Werbeanzeigen geschaltet werden können
Consent Optimization nennt sich das, und es geht im Großen und Ganzen darum, durch ein spezielles Wording oder Design Menschen dazu zu „motivieren“, Cookies zu akzeptieren.
Diese Consent-Optimierung öffnet Tür und Tor für sogenannte Dark Patterns – Strategie-, Design- oder Sprachmuster, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten verleiten und ethisch fragwürdig sind.
Auch die Social-Media-Plattformen selbst bedienen sich natürlich solcher Dark Patterns, um Menschen dazu zu bringen, der Nutzung ihrer Daten zuzustimmen. Zum Beispiel, indem der Annehmen-Button in einer auffälligeren Farbe gestaltet wird als der Ablehn-Button.
#5 Das Zukunftsargument
Auch ob personalisierte Werbung in der aktuellen Form so zukunftsfähig ist, darf bezweifelt werden.
Surprise, surprise: Selbstständige und Unternehmen (und Politiker*innen) finden es vielleicht gut, personalisierte Werbung zu schalten. Doch die meisten Menschen finden es eben nicht gerade toll, getrackt zu werden.
Und Unternehmen wie Apple tragen dem Rechnung, indem sie seit iOS 14.5 es ermöglichen, Tracking für bestimmte Apps – und dazu gehören auch Facebook und Instagram – abzulehnen.
Natürlich macht das Apple nicht (nur) aus Menschenliebe oder aus Spaß an der Freude – auch wenn es die Apple-Bosse sicherlich freut, dass das ihren Konkurrenten Meta rund 10 Milliarden Dollar im Jahr kostet –, sondern aus wirtschaftlichem Interesse.
Doch das grundsätzliche Problem bleibt: Metas Geschäftsmodell setzt voraus, dass sich Menschen freiwillig und ohne zu mucken tracken lassen. Und ob das für jetzt bis in alle Zeit so gelten wird?
Gleichzeitig gibt es in letzter Zeit auch aus der Politik entsprechende Zeichen:
In Norwegen wurde jüngst personalisierte Werbung für drei Monate verboten.
Und auch im Europaparlament gibt es Bestrebungen, personalisierte Werbung zu verbieten.
Mit anderen Worten: Dass die Politik ewig dabei zusehen wird, wie Meta und Co. Daten im großen Stil und ohne das explizite Einverständnis der Menschen sammeln und die Konsequenzen stillschweigend in Kauf nehmen, darf bezweifelt werden.
#6 Das „Mehr ist nicht immer besser“-Argument
Menschen, die für den Einsatz von Werbeanzeigen mit dem Argument „Wir können mit Werbeanzeigen schneller wachsen und skalieren als ohne Werbeanzeigen.“ plädieren, scheinen stillschweigend davon auszugehen, dass „mehr“ immer „besser“ ist.
Doch das ist aus meiner Sicht nicht zwingend der Fall. Ich selbst habe zum Beispiel folgende Erfahrungen gemacht:
Menschen, die mich durch Ads fanden, waren anders als die Menschen, die wegen eines Interviews, einer Empfehlung oder eines Blogartikels auf mich aufmerksam wurden. Seit ich keine Werbeanzeigen mehr schalte, habe ich es auch deutlich seltener mit ausfallenden, unfreundlichen und unangenehmen Menschen zu tun.
Werbeanzeigen führten bei mir zu einer höheren Abmelderate beim Newsletter, weil sie vermutlich auch viele Freebiejäger erreichten, die sich einfach nur das Freebie schnappen wollten, aber gar kein Interesse daran hatten, den Newsletter zu abonnieren. Seit ich keine Werbeanzeigen mehr nutze (und auch keine Freebies mehr habe), ist die Abmelderate deutlich gesunken, während die Öffnungs- und Klickrate gestiegen sind.
Stellen wir doch einfach mal zwei Situationen gegenüber.
Lara scrollt durch ihren Instagram-Feed und sieht eine Werbeanzeige für ein kostenloses Downloadprodukt. Innerhalb von wenigen Sekunden beschließt sie, sich das Downloadprodukt zu holen, indem sie ihre E-Mail-Adresse rausrückt. Lara weiß noch gar nicht so viel über die Person, deren Newsletter sie abonniert hat. Und sie hat sich auch streng genommen gar nicht zum Newsletter anmelden wollen – sie wollte nur das PDF.
Ein anderes Szenario:
Ben ist Fan eines bestimmten Podcasts. In der letzten Folge wurde eine Person zu einem spannenden Thema interviewt. Nach fast einer Stunde Interview hat Ben eine Menge über den Werdegang, das Thema und die Ansichten dieser Person erfahren. Und als er dann zu ihr auf die Website geht, steuert er gezielt die Newsletteranmeldung an. Er weiß ganz genau, dass er auch in Zukunft mehr von dieser Person hören will.
Nun ist damit natürlich nicht gesagt, dass sich Lara sofort vom Newsletter abmelden und Ben bis in alle Ewigkeiten im Newsletter bleiben wird – auch Bens melden sich vom Newsletter ab, wenn sich ihre Interessen oder persönlichen Umstände ändern. Doch die Voraussetzungen bei Lara und Ben sind einfach völlig unterschiedliche.
Mehr ist nicht immer besser. Die richtigen Menschen sind besser.
Und was sind die richtigen Menschen? Aus meiner Sicht sind das Menschen, die genügend Zeit hatten, um eine informierte Entscheidung für oder gegen einen Newsletter, ein Webinar oder ein Produkt zu treffen. Und das ist bei Werbeanzeigen, wo wir Entscheidungen innerhalb von wenigen Sekunden treffen, nur selten der Fall.
#7 Das „Wir können nicht mehr unbegrenzt wachsen“-Argument
„Klingt ja schön und gut“, kriege ich manchmal von erfahrenen Onlineunternehmer*innen gesagt, „aber ohne Werbeanzeigen ginge mir das viel zu langsam.“
Da gebe ich ihnen Recht: Ohne Werbeanzeigen geht Wachstum viel langsamer.
Doch könnte das nicht auch … eine gute Sache sein?
Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr und mehr verstehen, dass wir nicht mehr so wirtschaften können wie bisher. Wir merken, dass unbegrenztes Wachstum unsere Welt zerstört und unsere Gesundheit. Wir sehen, dass Unternehmen, die ohne Kopplung an Werte wachsen, das meist auf Kosten von Sicherheit, Privatsphäre und Moral tun.
Wollen wir da wirklich mitmachen? Muss es denn wirklich immer um maximalen Gewinn gehen?
Oder wollen wir unser Wachstum verantwortungsbewusst gestalten? Zum Beispiel, indem wir klare rote Linien ziehen und auf Dark Patterns oder personalisierte Werbung verzichten?
#8 „Es geht gar nicht schneller“-Argument
Doch es gibt noch ein zweites Argument gegen die „Mit Werbeanzeigen geht Wachstum viel schneller“-These: Sie trifft nur auf diejenigen zu, die sich mit Werbeanzeigen auskennen.
Mir war das zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch nicht so klar. Ich dachte, ich setze eine Werbekampagne auf und – schwupps – bringt sie mir zuverlässig neue Menschen in meinen Newsletter.
So einfach ist es dann nicht. Wer als Neuling das erste Mal in einen Werbeanzeigenmanager reinguckt, ist erst einmal komplett überfordert. Er benötigt Tage, wenn nicht gar Wochen, um sich einzuarbeiten und alle wichtigen Funktionen zu verstehen. Denn das Ding ist komplex.
Dann dauert es weitere Wochen, bis der Pixel genügend Daten liefert und sogenannte Custom Audiences so aufgebaut sind, dass man sie sinnvoll nutzen kann.
Die ersten Werbekampagnen funktionieren meist eher so semigut, sodass viele Tests notwendig sind, bis man die Kombination aus Zielgruppe, Anzeige und Text hat, die gute Ergebnisse bringt.
Werbeanzeigen sind nicht notwendigerweise eine Abkürzung – sie sind ein großes, neues, komplexes Feld, das man verstehen und durchdringen muss, bevor man wirklich sagen kann, dass es gut läuft.
Ads sind damit eine viel längerfristige Strategie, als viele Selbstständige glauben. Gefühlt kommen auf jeden Onlineunternehmer, der behauptet, dass er mit Ads so tolle Ergebnisse einfährt, einhundert, die daran verzweifeln.
#9 Das „Die Menschen sind genervt“-Argument
Auf die Frage, warum Meta nicht einfach aufhört, personalisierte Werbung zu zeigen, antwortet das Unternehmen 2020:
„The answer is that we believe that personalized advertising provides the best experience for people and the best value for businesses – particularly small businesses, which make up the vast majority of Facebook’s nine million active advertisers across our services.“ (Quelle)
Unternehmen wie Meta tun gerne so, als wäre personalisierte Werbung für alle Beteiligten eine „tolle Erfahrung“, doch was ist die Aussage wert angesichts der Tatsache, dass personalisierte Werbung nun mal den Kern eines Unternehmens wie Meta trifft?
Wer personalisierte Werbung kritisiert, kritisiert damit auch Metas Geschäftsmodell. Natürlich würde sich Meta niemals die Geschäftsgrundlage entziehen, indem das Unternehmen sagt, dass die Kritik an personalisierter Werbung berechtigt ist.
Und so toll scheint die Erfahrung für die Menschen, die die Werbeanzeigen letzten Endes sehen, dann doch nicht zu sein. Einige Zahlen:
Nur 11% der befragten Menschen wollen laut einer Studie von YouGov überhaupt personalisierte Anzeigen sehen. 57% wollen überhaupt keine personalisierte Anzeigen sehen. 26% keine politischen personalisierten Anzeigen. (Quelle)
Laut einer Studie von European netID Foundation ist die Hälfte der befragten Deutschen von der ungefragten Datenweitergabe genervt. (Quelle)
75% der Deutschen empfinden laut einer Studie von Ogury personalisierte Werbung auf Mobilgeräten als nervig. (Quelle)
Die Genervtheit der Menschen ist verständlich. Wer will denn zum Beispiel als 60-Jähriger Werbung für Inkontinenzeinlagen sehen, nur weil er … eben ein bestimmtes Alter erreicht hat? Oder Werbung für High Heels, nur weil jemand … eben eine Frau ist?
Außerdem stellt sich bei vielen Menschen auch das „Big Brother is watching you“-Gefühl ein. Da haben sie sich nur in einem Onlineshop ein paar Schreibtischstühle angeguckt und kaum machen sie Instagram auf, werden ihnen genau dieselben Produkte angezeigt. Die wenigsten verstehen wohl genau, wie das technisch funktioniert. Und selbst, wer über die Existenz des Pixels Bescheid weiß – das Gefühl, beobachtet zu werden, bleibt. (Und ist alles andere als angenehm.)
#10 Das Investitionsargument
Sind Werbeanzeigen also wirklich eine so gute Investition? Bei der Antwort würde ich nicht lediglich den finanziellen Aspekt berücksichtigen, sondern auch den Faktor Zeit, Energie, Headspace oder Nerven.
Personalisierte Werbung bindet Ressourcen auf allen Ebenen, und sogar wenn FB-Ads ganz okaye Ergebnisse bringen, kann es sein, dass sie uns den letzten Nerv rauben und uns das Leben insgesamt schwerer machen.
Will ich mich mit dem Thema beschäftigen? Will ich mich da weiterbilden? Will ich ständig Dinge testen und optimieren? Will ich täglich meine Kampagne checken? Oder will ich jemanden beauftragen, die Werbekampagnen für mich zu managen? Wie viel Zeit kostet mich das Thema Werbeanzeigen? Und wie viel Energie? Wie viel Geld? Was könnte ich stattdessen tun? Ist es den ganzen Aufwand wert? Wie würde mein Leben ohne Werbeanzeigen aussehen?
All das sind legitime Fragen, die bei der Entscheidung für oder gegen Werbeanzeigen eine Rolle spielen können.
Was ist denn die Alternative zu personalisierter Werbung?
Eine Alternative für unbegrenztes Wachstum habe ich nicht. Aber ich habe eine Alternative für verantwortungsbewusstes Wachstum: kontextualisierte Werbung.
Kontextualisierte Werbung bedeutet, dass Werbung passend zu bestimmten Kontexten erscheint.
Personalisierte Werbung mag mehr Aufmerksamkeit erhalten. Doch kontextualisierte Werbung hat eine höhere Akzeptanz. Außerdem ist kontextualisierte Werbung ein wachsender Markt, der von 106 Milliarden Dollar 2017 auf über 400 Milliarden 2025 wachsen soll. (Quelle)
Wer zum Beispiel in einem Podcast interviewt wird und am Ende des Podcasts auf die Website, den Newsletter oder Onlinekurse verweist, macht auch „Werbung“ für sein Zeugs. Doch:
Dafür müssen keine Daten von Menschen gesammelt werden. Jeder Mensch, der den Podcast hört, hört genau dieselbe Botschaft.
Nachdem sich jemand ein 30- oder 60-minütiges Interview zu einem bestimmten Thema angehört hat, kommt ein Hinweis zu einer Website oder einem Produkt nicht überraschend, sondern ergibt sich aus dem Kontext.
Fazit: Es gibt viele Argumente, die gegen Social-Media-Ads sprechen
Personalisierte Werbung ist für die meisten Selbstständigen und Unternehmen nicht mehr aus dem Marketing wegzudenken. Doch neben den zweifelsohne vorhandenen Pro-Argumenten für personalisierte Ads, gibt es auch viele Argumente dagegen:
#1 Abhängigkeit: Wir machen uns abhängig. Vor allem, wenn unser gesamtes Marketing auf Ads beruht.
#2 Privatsphäre: Für personalisierte Werbung muss das Onlineverhalten von Menschen im großen Stil getrackt werden. Das ist in den meisten Fällen ein Angriff auf die Privatsphäre der Menschen.
#3 Datenschutzrecht: Websitebetreiber*innen sind für die rechtskonforme Einbindung des Meta-Pixels verantwortlich, doch das ist technisch nicht immer so leicht umzusetzen (vor allem, dass der Pixel erst nach dem Einverständnis lädt).
#4 Ethik: Statt Menschen über die Nutzung ihrer Daten aufzuklären, geht es im Marketing immer mehr um „Consent Optimization“, also darum, durch Tricks im Wording und Design möglichst viele Menschen dazu zu bringen, auf „Cookies annehmen“ zu klicken.
#5 Zukunftsfähigkeit: Wie zukunftsfähig Metas Geschäftsmodell mit personalisierter Werbung ist, ist die Frage. Apple bietet inzwischen die Möglichkeit, Tracking abzulehnen, und auch die Politik macht Druck.
#6 Mehr ist nicht immer besser: Wer Menschen ausreichend Zeit gibt, sich für einen Newsletter, ein Webinar oder ein Produkt zu entscheiden, erhöht die Chance, die richtigen Menschen zu erreichen und letzten Endes Abmeldungen zu reduzieren.
#7 Wachstum: Es sollte nicht um maximalen Gewinn gehen, sondern um verantwortungsbewusstes Wachstum. Selbstständige und Unternehmen brauchen Werte, an denen sie sich orientieren.
#8 Langfristigkeit: Dass personalisierte Werbung gute Ergebnisse bringt, setzt voraus, dass man genau weiß, was man tut. Dazu ist entweder ausgebildetes Fachpersonal nötig oder viel Zeit und Übung.
#9 Genervt: Menschen sind von personalisierter Werbung und der Weitergabe ihrer Daten immer mehr genervt.
#10 Investition: Ob Werbeanzeigen eine gute Investition sind, ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch von Zeit, Energie, Hirnschmalz und Nerven.
(1) Beispiel von Edward Snowden
(2) Ich bin natürlich keine Anwältin und dieser Text stellt keine Rechtsberatung dar. Ich gebe nur die Rechtslage nach bestem Wissen und Gewissen weiter.
Fünf Narrative, die wir nicht mehr im Marketing verwenden sollten
Viele der etablierten Narrative im Onlinemarketing und auf Social Media sind extrem problematisch. Sie sähen Selbstzweifel und treiben Frauen in die Selbstoptimierung und Erschöpfung. Ein Überblick.
Ob in unserem Newsletter, im Blog, auf Social Media oder auf der Website – wenn wir über uns, unsere Produkte und Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, reden, verwenden wir Narrative.
Ein Narrativ ist eine etablierte Erzählung, die für eine Gruppe von Menschen eine sinnstiftende Funktion erfüllt.
Viele der Narrative im Marketing sind sogar so etabliert, gelten als so „normal“ und „selbstverständlich“, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen.
Doch leider sind gerade die etablierten Narrative oft problematisch. Warum? Das möchte ich im Folgenden genauer unter die Lupe nehmen.
#1 Das Umsatz-Narrativ
„Ich habe ein siebenstelliges Business aufgebaut – und du kannst es auch“
„Meine Kundin hat einen sechsstelligen Launch hingelegt – mit meinem Programm“
„Wie ich jeden Monat 10k Euro durch passives Einkommen bekomme“
Kennst du dieses Umsatz-Narrativ auch?
Meine Beobachtung ist, dass es eine der beliebtesten Erzählungen ist, der sich Businesscoaches im Marketing bedienen. Kein Wunder: Es macht natürlich mächtig Eindruck, von solchen Erfolgsgeschichten zu hören, und löst bei uns Normalsterblichen sofort ein „Haben wollen“-Gefühl aus.
Als ich Ende 2015 meine Fühler in Richtung Selbstständigkeit ausstreckte, teilten Menschen noch ihre fünfstelligen Launches, später waren es sechsstellige, dann siebenstellige und inzwischen wundere ich mich noch nicht einmal mehr, wenn ich irgendwo lese: „Ich mache mit meinem Business 10 Millionen und mehr.“
Doch ein sechs-, sieben- oder achtstelliger Jahresumsatz – das ist für die meisten Selbstständigen einfach nicht realistisch. Da können wir noch so viel „manifestieren“ oder an unserem „Mindset“ arbeiten.
Warum bedienen sich Businesscoaches dann dieser Erzählung?
Weil die Zahlen als ein Argument für ihre Programme fungieren sollen.
Die Geschichte lautet ja nicht „Ich habe ein siebenstelliges Business aufgebaut – und es war nur Zufall“ oder „Diese Frau hat einen sechsstelligen Launch hingelegt – mit dem Programm einer Kollegin“, sondern wird immer in den Launch der eigenen Programme eingebettet.
Jeden Monat 10k Euro – und ich bringe dir die exakte Methode bei.
Sechsstellig im Launch – und hier ist mein Onlinekurs, in dem du es lernst.
Siebenstelliges Business – meine Mastermind bringt dich auf den Weg dahin.
Das Umsatz-Narrativ ist aus meiner Sicht einer der fiesesten Psychotricks, die wir im Marketing verwenden können.
Es trifft Menschen an einem wunden Punkt. (Geld ist für viele Menschen scham- oder schuldbehaftet.)
Es erzeugt Neid, Druck und Vergleicheritis.
Es bringt Menschen dazu, eine extrem kapitalistische Haltung in Bezug auf ihre Selbstständigkeit einzunehmen und Menschen, Marketing oder ihre Ziele nur noch danach zu bewerten, ob und wenn ja, wie viel Umsatz sie bedeuten.
Es kann dazu führen, dass Menschen ihre Gesundheit oder ihre Beziehungen riskieren, nur um einem komplett unrealistischen Umsatzziel hinterherzujagen.
Eng damit verknüpft ist ein weiteres Narrativ:
#2 Das Investitions-Narrativ
Kennst du das „Du musst in dich / dein Business investieren“-Narrativ?
Zunächst einmal ist es ziemlich trivial:
Natürlich haben wir als Selbstständige Betriebsausgaben und natürlich können wir eine professionelle Website, ein schickes Logo oder ein Businesscoaching als Investment sehen.
Denn oft ist es ja so: Wenn wir etwas Geld in die Hand nehmen, fühlen wir uns „verpflichtet“, das Projekt dann auch durchzuziehen. Und oft kommen wir dadurch schneller zum Ziel (keine Prokrastination mehr) oder erzielen sogar bessere Ergebnisse (eben weil wir uns fokussieren).
Das Problem an dem „Du musst in dich investieren“-Narrativ sehe ich vor allem dann, wenn damit extrem hochpreisige Angebote gerechtfertigt werden.
Ja, mein Programm kostet 100k – doch wenn du danach siebenstellig verdienst, hast du das Geld ja schnell wieder drin.
Nicht selten werden Menschen so auch dazu gebracht, einen Kredit aufzunehmen und damit Schulden zu machen.
„Du musst Vertrauen haben. Das Universum wird dich für diesen Vertrauensvorschuss belohnen.“
Ein absoluter Red Flag!
#3 Das Universum-Narrativ
Apropos Universum.
Wir können hier und heute ja zum Glück alles glauben, was wir wollen: an einen Gott, an das fliegende Spaghettimonster oder an den rückläufigen Merkur.
Doch weißt du was? Das alles hat für mich nichts im Marketing verloren.
Was das „Universum“ „denkt“, „macht“ oder „belohnt“, ob es überhaupt existiert oder ob das ganze Gerede von einem „Universum“ ausgemachter Unsinn ist, darf jede*r gerne für sich an einem verregneten Sonntagmorgen kontemplieren.
Doch was nicht geht, ist, Menschen (viel zu viel) Geld abzuknöpfen und es mit etwas, was nun mal nicht bewiesen werden kann, zu begründen.
„Das Universum wird dich dafür belohnen.“
Wenn du so etwas irgendwo hörst, dann lauf!
#4 Das „Du kannst alles schaffen, was du willst“-Narrativ
Dream big. Shoot for the moon. Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du fest daran glaubst (hart genug arbeitest / es dir manifestierst etc.).
Als ich noch auf Instagram war, sah ich diese Botschaften überdurchschnittlich oft.
Auf den ersten Blick sollen diese Botschaften (selbstständige) Frauen bestärken. Sie sollen ihnen Mut machen, mehr zu wollen, sich höhere Ziele zu setzen. Doch auf den zweiten Blick ist auch das „Du kannst alles schaffen, was du willst“ extrem problematisch.
Es negiert und bagatellisiert die Herausforderungen der meisten Frauen, die nun mal leider nicht in einer pinken Insta-Wohlfühlwelt leben, sondern täglich mit diversen Gender Gaps, Diskriminierung oder Krankheiten zurechtkommen müssen.
Es führt nicht selten zur Selbstoptimierung, Selbstausbeutung und – nach ein paar Jahren – zu großer Erschöpfung.
Für mich gehört dieses Narrativ zum Femwashing und sollte dringend aus dem Marketing verschwinden.
Eng damit verknüpft ist das folgende Narrativ:
#5 Das „Du bist nicht genug“-Narrativ
Das „Du bist nicht genug“-Narrativ kommt in vielen Farben und Formen und die meisten davon sind eher subtil.
Meist sagt uns ja niemand ins Gesicht, dass wir es nicht drauf haben, vielmehr schwingt diese Annahme oft stillschweigend mit.
Du willst erfolgreich werden? Tja, wenn du so weitermachst wie bisher, wird es eher schwierig. Doch mit meinem Framework kannst du deine Ziele erreichen.
Du fühlst dich angesichts deiner Selbstständigkeit und Kinder überfordert? Tja, kein Wunder bei dem Zeitmanagement. Ich bringe dir bei, wie du deine Zeit richtig nutzt!
Die Message ist immer: So, wie du jetzt bist, bist du nicht in Ordnung. So, wie du es jetzt machst, ist es scheiße. Du musst dich ändern. Du musst an dir arbeiten.
Es ist ein perfides Businessmodell: Erst werden systematisch Selbstzweifel gesät und dann wird ein passendes – oft extrem hochpreisiges – Programm angeboten.
Fazit
Die Marketingwelt ist voller problematischer Narrative, die wir dringend überdenken sollten. Fünf davon habe ich dir in diesem Blogartikel genannt:
Das Umsatz-Narrativ
Das Investitions-Narrativ
Das Universum-Narrativ
Das „Du kannst alles schaffen, was du willst“-Narrativ
Das „Du bist nicht genug“-Narrative
Welche Narrative wir stattdessen verwenden können? Wie wäre es mit folgenden Ideen:
Du bist genug.
So, wie du bist, bist du in Ordnung. Du musst dich nicht ständig verbessern, verändern oder weiterbilden.
Dein Wert ist nicht an deine Leistung gekoppelt.
Du darfst deinen Fähigkeit vertrauen.
Businessaufbau braucht Zeit und es wird nicht immer leicht sein.
Ja, diese Narrative lassen sich nicht so gut ausschlachten. Doch was ist, wenn das gar nicht mehr das Ziel von Marketing wäre?
Was wirst du bauen?
Stell dir vor, du kaufst ein Lego-Set mit dem Namen „Selbstständigkeit“. Du öffnest die große, bunte Packung und entdeckst unzählige Steine in den verschiedensten Größen, Farben und Formen. Was wirst du bauen?
Stell dir vor, du kaufst ein Lego-Set mit dem Namen „Selbstständigkeit“.
Du öffnest die große, bunte Packung und entdeckst unzählige Steine in den verschiedensten Größen, Farben und Formen.
Der eine dunkelblaue Lego-Stein heißt Facebook.
Der lilafarbene Stein Instagram.
Der grüne Stein Blog, der gelbe Stein Podcast und der weiße SEO.
Und die große, graue Platte, auf der du alle anderen Steine draufsetzen kannst, nennt sich Website.
Was wirst du bauen?
Wirst du sofort nach der Bauanleitung suchen und jeden einzelnen Schritt akribisch befolgen?
Wirst du den langen gelben Vierer auf den langen roten Vierer setzen und nicht umgekehrt?
Wirst du etwas bauen, was alle anderen Menschen auch bauen, die sich an der gleichen Anleitung orientieren? (Um dich dann nachher zu beschweren, dass dein Bauwerk nicht genügend heraussticht?)
Oder wirst du die Steine nach deiner eigenen Vorstellung zusammensetzen?
Die Steine, mit denen du nichts anfangen kannst, einfach weglassen?
Nur die Steine nutzen, bei denen es dir in den Fingern kribbelt?
Wirst du dich von deinen Ideen und Vorstellungen leiten lassen und etwas Einzigartiges bauen? Etwas, das es so noch nicht gibt?
Alle Steine aus dem Lego-Bausatz „Selbstständigkeit“ liegen vor dir:
Website, SEO, Blog, Podcast, Facebook, Instagram, TikTok, Webinare, Newsletter, persönliche Kontakte, Weiterempfehlungen, Affiliate-Marketing, Werbeanzeigen.
Schau sie dir genau an und entscheide selbst, was du daraus baust und welche Steine du nimmst.
Wir müssen das nicht machen
Hier ist eine Liste von Dingen, die wir nicht tun müssen, obwohl wir selbstständig sind.
Hier ist eine Liste von Dingen, die wir nicht machen müssen, nur weil wir selbstständig sind:
Skalieren.
Einen „Sales Funnel“ entwickeln.
SEO betreiben.
Passives Einkommen generieren.
Ein Logo haben.
Oder ein professionelles Brand Design.
Eine Website haben.
Blogartikel schreiben.
Bücher schreiben.
Ein Freebie haben.
Newsletter schreiben.
Unser Gesicht täglich in den Storys zeigen.
Liken.
Kommentieren.
Reels drehen.
Jeden Tag auf Instagram posten.
Digitale Produkte haben.
Auf Netzwerkveranstaltungen gehen.
Webinare halten.
Eine Membership haben.
Onlinekurse erstellen.
Ein „Tiny Offer“ haben.
Eine Mastermind anbieten.
Speakerin sein.
Interviewt werden.
Gastartikel schreiben.
Affiliate-Marketing betreiben.
Bei Kongressen mitmachen.
Produkt einem Bundle beisteuern.
Livegehen.
Eine „Challenge“ durchführen.
Oder ein „Bootcamp“.
Facebook-Gruppen für den Support von Kund:innen haben.
Videos drehen.
Uns spitz positionieren.
Karussellposts erstellen.
ChatGPT nutzen.
Diese Strategien sind Werkzeuge. Wir können alle diese Werkzeuge nutzen oder nur drei.
Wir können sagen „Das passt alles nicht zu mir“ und es ganz anders machen.
Wir können ein Werkzeug testen, nur um festzustellen, dass es nicht gut in der Hand liegt und wir damit nicht weiter arbeiten möchten.
Das ist okay.
Wir müssen nichts machen, was wir nicht wollen.
Ein kritischer Blick auf das Female Empowerment auf Social Media
Wie feministisch sind die üblichen „Female Empowerment“-Posts auf Social Media? The answer may (not) surprise you: Bedingt. In diesem Blogartikel geht es um die widersprüchlichen und problematischen Botschaften der Girlbosse auf Instagram und Co.
In knapp einem Monat ist internationaler Weltfrauentag.
Und wie immer wird – neben wichtigen Anliegen, Aktionen, Impulsen und Statistiken – eine Menge gefährlicher Blödsinn im Namen des „Female Empowerment“ verbreitet.
Oft (und insbesondere) von Coaches.
Für mich gehört das zu den Hauptwidersprüchen der hippen Girlboss-Female-Empowerment-Selbstverwirklichungsbubble:
Wir tun so, als wäre uns die Stärkung von Frauen eine Herzensangelegenheit – doch unsere Handlungen sprechen eine andere Sprache.
Hier eine lange Liste von Begriffen, Bildern, Botschaften und Handlungen, die dem Anliegen der Female-Empowerment-Bewegung schaden – und abschließend ein paar Ideen, wie wir es besser machen können.
#1 Die Sprache im Female Empowerment
Alles fängt mit der Sprache an.
Powerfrau
Karrierefrau
Fempreneur
Bosslady
Ladyboss
Working Mum
Mumpreneur
Mompreneur
SHEO
Diese Begriffe mögen nett oder sogar als ein Kompliment gemeint sein, doch sie zeigen ganz deutlich:
Wenn Frauen oder Mütter arbeiten oder sich selbstständig machen, ist das immer noch eine Abweichung von der Norm und sollte extra betont werden. Als wären wir immer noch ganz verwundert darüber, wenn Frauen Karriere machen oder Mütter arbeiten.
In der Linguistik nennt man das eine konversationelle Implikatur: Wir sagen zwar nicht explizit, dass es „nicht normal“ ist, dass Frauen arbeiten oder Karriere machen, aber wir meinen das stillschweigend mit.
Das liegt an den sogenannten Konversationsmaximen, die der Sprachphilosoph H. P. Grice 1967 „entdeckt“ hat. Im Fall von „Powerfrau“ oder „Karrierefrau“ gilt die Maxime der Relevanz. Wäre es nicht relevant, die „Power“ oder „Karriere“ extra zu betonen, würden wir es gar nicht erst so formulieren.
Wie im Grice’schen Beispiel vom Kapitän und dem Maat.
Der Kapitän schreibt ins Logbuch: Heute, 11. November, der Maat ist betrunken. Der Maat liest den Eintrag, wird wütend und schreibt seinerseits: Heute, 12. November, der Kapitän ist nicht betrunken.
Die Implikatur ist klar: Normalerweise ist der Kapitän betrunken, doch heute – es geschehen noch Zeichen und Wunder – mal nicht!
Die Maxime der Relevanz greift auch, wenn wir sagen:
Heute war das Essen in der Mensa mal lecker.
Oder:
Heute hat Michael mal selbst das Klo geputzt.
Wir implizieren mit diesen Sätzen, dass der Normalfall ein ganz anderer ist. Deshalb sind auch solche Begriffe wie „Frauenfußball“ bescheuert. Und deshalb tut sich die Female-Empowerment-Bewegung keinen Gefallen damit, von „Powerfrauen“, „Karrierefrauen“ und Co. zu sprechen.
Wie absurd diese Wörter eigentlich sind, merken wir spätestens, wenn wir das männliche Pendant bilden:
Powermann
Karrieremann
Manpreneur
Bosssir
Sirboss
Working Dad
Dadpreneur
HEO
Diese Begriffe gibt es nicht, weil es für Männer „normal“ ist, „Power“ zu haben oder Karriere zu machen. Und weil die Frage, ob ein Mann Kinder hat, in einer Gesellschaft, in der Mütter immer noch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen, zu vernachlässigen ist.
Deshalb ist es auch so witzig, wenn der Satire-Account „Man who has it all“ twittert:
Working husband? How do you keep your energy levels up? Jack, age 28 „I keep an almond in my coat pocket“. Inspirational.
Mindestens genauso problematisch ist die Verniedlichung von Frauen mit Begriffen wie
Girlboss
Bossbabe
Girlpreneur
Girlpower
„Girlboss“ geht auf „Nasty Gal“-CEO Sophia Amoruso zurück, die den Begriff mit ihrem gleichnamigen Buch 2014 in die Welt gebracht hat.
Doch was sagen Begriffe wie „Girlpower“ und Co. überhaupt aus?
Vielleicht: „Keine Angst, ich werde mit meiner ‚Power‘ das Patriarchat schon nicht zum Einsturz bringen. Schließlich bin ich ja nur ein kleines Mädchen.“
Oder: „Ich bin nur ein ‚Girl‘ und will ein bisschen ‚Boss‘ spielen.“
Inzwischen hat es sich zum Glück auch ein Stück weit „ausgegirlbosst“. Während Anfang 2017 der Begriff „Girlboss“ im Urban Dictionary noch so erklärt wurde:
A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knows her worth and won't accept anything less. […] She is empowering and inspiring to those around her. She kicks ass!
Heißt es bereits 2021 und 2022:
A person who co-opts popular feminist “girl power” rhetoric as a way to virtue signal to other neoliberals and shield themselves from criticism.
Oder:
Someone who is lauded by themselves or others as a feminist icon, despite not typifing feminism in many ways or sometimes being unpleasant and unethical in a way that is antithetical to feminism.
Von „empowering“ (2017) zu „gegensätzlich zum Feminismus“ (2022) in nur fünf Jahren – wie konnte das passieren?
#2 Die Ästhetik im Female Empowerment
Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir zuvor über die Botschaften sowie über die Bilder und Ästhetik sprechen, die manchmal im Namen der Girlboss-Mumpreneurs-Female-Empowerment-Bewegung verbreitet wird.
Geben wir den Begriff „Girlboss“ in Fotodatenbanken wie Canva ein, sehen wir zu 95% einen ganz bestimmten Typ Frau.
Weiß.
Jung.
Schlank.
Gestylt.
Reine Haut.
Volles Haar.
Stilvoll gekleidet.
Ein typisches „Girlboss“ laut Canva: jung, schlank, schön.
Eine heile, glorifizierte, pastellige Welt aus Apple-Gerät, duftenden Blumensträußen, Kaffeebechern und Terminplanern (denn ein Girlboss ist busy!).
Ein typischer „Workplace“ eines „Girlboss“: Laptop, Blumen, Pastell.
Wen sehen wir auf prototypischen Girlboss-Bildern nicht oder vergleichsweise selten? Richtig: Women of Colour, Muslimas, Transfrauen, Frauen jenseits der 50 oder Vielfalt von Frauenkörpern.
Was findet auf den prototypischen Girlboss-Bildern üblicherweise nicht statt? Richtig: der meist unglamouröse Alltag von Frauen, die sich selbstständig machen und dabei mit diversen Gender Gaps zurechtkommen müssen.
#3 Botschaften im Female Empowerment
Die typischen Bilder der Selbstverwirklichungsbubble stehen für einen weißen, wohlhabenden „Feminismus“ und haben mit der Realität der meisten Frauen nur wenig zu tun.
Nicht selten legen sie einen so starken Fokus auf „Good Vibes Only“, sodass ihre „positiven“ Botschaften ins Toxische gehen und Herausforderungen, Probleme, Rückschläge grundsätzlich ignorieren.
Vor allem aber passen diese Bilder zu der Kernbotschaft, die im Namen des Female Empowerment verbreitet wird:
Du kannst super erfolgreich werden, wenn du nur hart genug (an dir) arbeitest und dabei stets positiv bleibst.
Sheryl Sandberg hat diese neoliberale Message im Namen der Frauenbewegung 2013 in die Welt gesetzt.
In ihrem Buch – mittlerweile ein Bestseller und Klassiker – „Lean in. Frauen und der Wille zum Erfolg“ schreibt Sandberg sinngemäß:
„Wenn Frauen hart arbeiten und mutig sind, können sie alles erreichen, was sie sich vornehmen.“
Hört sich erst einmal gut an, ist bei näherem Hinsehen aber nur ein unreflektierter Worthaufen, der stark nach Privilegien riecht.
Sheryl Sandberg, die bis Herbst 2022 COO von Facebook war, hat ein geschätztes Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar. Nicht Millionen, MILLIARDEN. Und vermutlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage:
Einer weißen, reichen Frau kommen solche Sätze leichter über die Lippen als beispielsweise Alleinerziehenden, deren Zeit, Kraft und finanzielle Ressourcen nun einmal beschränkt sind. Oder Schwarzen Frauen, die täglich Diskriminierungserfahrungen machen.
Für die meisten Frauen dieser Erde gibt es in patriarchalen Strukturen Grenzen. Selbst wer als Frau weiß und glücklich verheiratet ist – sobald Kinder ins Spiel kommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nach durchgemachten Nächten und dank Gender Care Gap erst einmal nicht sooo leistungsfähig sind.
Überhaupt gehen Female Empowerment und die Hustle Culture, für die vor allem Millenials anfällig zu sein scheinen, erstaunlich oft Hand in Hand.
Häufig das Credo der Selbstverwirklichungsbubble: hustle and grind.
Ein echtes „Girlboss“ meint es ernst und gibt jeden Tag alles.
Trinkt erst Kaffee und rettet dann die Welt.
Macht ständig Selfies von sich bei der Arbeit oder eine Instastory davon, wie sie eine Pause macht.
Die Spitze der Selbstverwirklichungsbubble-Hustle-Bubble ist der 5am Club – ein Konzept, das auf das gleichnamige Buch von Robin Sharma zurückgeht.
Sharmas These:
Frühmorgens, wenn alle schlafen, können wir ungestört unseren Zielen nachgehen. Wir können Sport machen, meditieren, lesen. Morgens um 5 Uhr sind die wertvollsten Stunden. (Dich ruft garantiert niemand an. Selbst der WhatsApp-Gruppenchat des Fußballvereins des Kindes bleibt stumm.) Das Wissen, dass du schon etwas für dich getan hast, wird dich den ganzen Tag beflügeln und dich unglaublich produktiv machen.
Einschlägige Beispiele sind schnell gefunden: Tim Cook steht laut Business Insider um 3:45 Uhr auf. Ehemalige First Lady Michelle Obama um 4:30 Uhr. Tim Armstrong um 5 Uhr. Sergio Marchionne um 3:30 Uhr.
Die Botschaft ist klar: Erfolgreiche Menschen sind Frühaufsteher!
Und so zwingen sich „frischgebackene“ Girlbosses Tag für Tag um 5 Uhr aus den Federn, weil erfolgreiche Menschen nun mal nicht snoozen.
Dass wir in der Leistungsgesellschaft weniger schlafen sollen, um noch mehr zu leisten und noch produktiver zu sein, ist zunächst einmal wenig überraschend: Schlaf ist aus kapitalistischer Sicht völlig wertlos. Denn wer schläft, leistet nichts und kann noch nicht einmal etwas konsumieren.
Die Forschungslage ist allerdings gar nicht so eindeutig, wie die 5am-Befürworter*innen tun.
Es gibt Studien, die belegen, dass Morgenmenschen gesünder sind und länger leben. Es gibt aber auch genauso Studien, die zeigen, dass es nichts bringt, sich zum Frühaufstehen zu zwingen, wenn mensch einen anderen zirkadianen Rhythmus hat. Oder dass es keinen Zusammenhang zwischen der Aufstehzeit und dem sozioökonomischen Status gibt.
Kurz: Wer von sich aus früh wach ist, darf gerne um 5 Uhr aufstehen und meditieren. Wer sich schwer damit tut, wird vermutlich nicht produktiver und leistungsfähiger, sondern durch den Schlafmangel auf Dauer krank werden.
Wem ist mit diesem hustlenden, früh aufstehenden Female Empowerment also geholfen? Na, vor allem Männern.
Denn wenn die Antwort der Female-Empowerment-Bewegung auf die diskriminierenden gesellschaftlichen Strukturen lautet, dass Frauen einfach noch härter arbeiten und noch früher aufstehen müssen, wird sich in absehbarer Zeit nichts an diesen Strukturen ändern.
Und wer Frauen zu 100% die Verantwortung für ihren Erfolg oder Misserfolg überträgt oder alles als eine Frage des „richtigen Mindsets“ darstellt, erzeugt unrealistische Ideale, die Frauen in eine Selbstoptimierungsspirale bringen, sie unter Druck setzen und an sich zweifeln lassen.
Das könnte zum Beispiel so aussehen:
#1 Frau möchte mich selbstständig machen.
#2 Frau entdeckt auf Instagram einschlägige Accounts, die ihr sagen: Für dich ist alles möglich, wenn du hart genug arbeitest!
#3 Frau fühlt sich bestätigt, freut sich und beginnt, hart zu arbeiten und sich den Wecker auf 4:30 Uhr zu stellen.
#4 Nach ein paar Tagen/Wochen/Monaten/Jahren merkt sie: Hmmm, irgendwie ist es nicht so glamourös, wie es bei den „Bossbabes“ immer aussieht. Ich arbeite nicht in einem Büro mit Blick auf eine Skyline, sondern auf der Couch zwischen Wäschebergen und Krümeln der Tiefkühlpizza, die ich mir abends um 23 Uhr noch schnell gegönnt habe. Ich bin durch das frühe Aufstehen erschöpft und hab trotz täglichem Meditieren Streit mit meinem Mann, weil ich nicht als einzige den Haushalt schmeißen will. Und zahlende Kund*innen finde ich nach einem Jahr auch nicht!
#5 Frau scrollt noch einmal durch sämtliche Accounts, denen sie auf Insta folgt, und stellt immer wieder fest: Alle anderen schaffen es doch auch. Es muss an mir liegen. Bei allen anderen sieht es leicht aus. Bei mir ist es schwer. Ich bin das Problem. Mit mir stimmt was nicht.
Das ist der große, traurige Widerspruch des Female Empowerment
Frauen sollen empowered werden, doch durch die einseitigen Botschaften, die auf Social Media wie am Fließband produziert und geteilt werden, bekommen sie immer wieder vermittelt, dass sie nicht gut genug sind.
Zum Beispiel, weil sie nach einer Nacht, in der ihre Kinder gekotzt haben und sie zweimal das Bett komplett neu beziehen mussten, es nicht schaffen, um 5 Uhr aufzustehen, Affirmationen aufzusagen und Tony Robbins zu lesen.
Thanks for nothing, Female Empowerment!
#4 Handlungen im Female Empowerment
Doch am beunruhigendsten ist für mich das sogenannte Pinkwashing.
So wie „Greenwashing“ Methoden meint, sich in der Öffentlichkeit ein klimafreundliches Image aufzubauen, während die Handlungen des Unternehmens in der Realität alles andere als umweltfreundlich sind, meint „Pinkwashing“ ein feministisches Image von Unternehmen oder Unternehmer*innen, während die Handlungen eine ganz andere Sprache sprechen.
Sollten Frauen, die sich Female Empowerment auf die Fahnen schreiben, nicht gerade solidarisch mit anderen Frauen sein?
Möchte mensch meinen. Doch die Praxis sieht alles andere als solidarisch aus.
Das Vereinbarkeitsproblem – der Gender Care Gap – zum Beispiel wird nicht etwa dadurch gelöst, Männer und Väter stärker in die Pflicht zu nehmen und für eine gerechtere Aufteilung der Care-Arbeit einzustehen, sondern durch „Nannys“ und „Putzfeen“.
Als ich 2018 das allererste Mal ein größeres Onlineprogramm buchte, war das einer der ersten Tipps, den ich von etablierten Business-Coaches bekam.
Nicht nur, dass sie für sich selbst entschieden, andere Frauen nicht angemeldet oder in Minijobs als Reinigungskraft zu beschäftigen und sie damit in die Altersarmut zu treiben – sie empfahlen ihren Kund*innen, dasselbe zu tun.
Schließlich können wir Frauen ja nicht gleichzeitig ein Imperium aufbauen und das Klo putzen. Oder?
Seit 2018 sind fünf Jahre vergangen, doch geändert hat sich wenig:
Noch immer geben manche Frauen im Namen des Female Empowerment anderen Frauen den Ratschlag, weniger privilegierte Frauen auszubeuten, um erfolgreich zu sein und ihr individuelles Vereinbarkeitsproblem zu lösen.
Es sei ein altes, veraltetes Modell, schreibt Teresa Bücker pointiert, in dem „Macht bedeutet, die ‚Drecksarbeit‘ an Menschen abzutreten, die nur Zugang zu diesen Arten der Arbeit haben. Und privilegierte Frauen machen in diesem Modell mit. Sie stärken es, statt einzufordern, die Arbeitswelt neu zu organisieren.“ (Quelle)
Das Outsourcen der Care-Arbeit, für die frau nun keine Zeit mehr hat, weil sie sich selbst verwirklichen will, steht also im krassesten Widerspruch zu der Botschaft des Female Empowerment: Frauen zu „ermächtigen“, sie handlungsfähig zu machen, Chancengleichheit zu schaffen und die Einkommensschere zu schließen.
Ähnlich sieht es aus, wenn erfolgreiche Onlineunternehmerinnen Freelancerinnen beschäftigen.
Immer wieder sind es gerade die Unternehmerinnen, die sich medienwirksam „Female Empowerment“ auf die Fahnen und Instaposts schreiben, die ihre eigenen Mitarbeiterinnen aus irgendeinem Grund ausklammern, jeden berechneten Euro in Frage stellen, um jedes Angebot grundsätzlich feilschen und Stundensatzerhöhungen pauschal ablehnen, Wochen ins Land ziehen lassen, bevor sie Rechnungen begleichen.
Außen Girlpower, innen Scrooge.
Wenige Jahre nach „Lean in“ müssen wir also feststellen: Es reicht eben nicht, einzelne Frauen an der Spitze zu sehen, solange frauenfeindliche Strukturen in der Gesellschaft und in Unternehmen existieren. Denn natürlich sind auch erfolgreiche Frauen nicht davor gefeit, Mitarbeitende auszubeuten und toxische Unternehmensstrukturen fortzuführen.
So wie Girlboss Sophia Amoruso, die schwangere Mitarbeiterinnen feuerte und mit Nasty Gal letzten Endes Insolvenz anmeldete.
Oder Audrey Gelman, die mit „Wing“ einen sicheren Coworking-Space für Frauen und nicht-binäre Menschen gründen wollte, der sich dann aber als rassistisch und diskriminierend entpuppte.
Oder Elizabeth Holmes, die in ihrem Unternehmen Theranos eine Kultur der Angst und Geheimhaltung schuf, einige Zeit als erste Selfmade-Milliardärin galt und inzwischen wegen Anlagebetrugs zu elf Jahren Haft verurteilt wurde.
Die Bilanz der (selbsterklärten) Girlbosses ist also ernüchternd. Doch die Spitze der systematischen Ausbeutung von Frauen im Namen von Girlpower sind sogenannte MLMs.
MLM ist die Abkürzung für Multi-Level-Marketing, was auch als „Network-Marketing“ oder „Direktvertrieb“ bezeichnet wird. Die vielleicht bekanntesten Beispiele für MLMs in Deutschland sind Tupperware, Vorwerk (Thermomix), Mary Kay oder die DVAG.
Der Grundgedanke ist, dass Produkte direkt von zufriedenen Kund*innen empfohlen und verkauft werden.
Ganz praktisch sieht das dann so aus:
Deine Nachbarin ruft dich an und lädt dich zu einer Tupperparty ein …
Die Mitschülerin, von der du schon neunzehn Jahre nichts gehört hast, findet dich plötzlich auf Facebook und fragt dich, ob du schon von diesem Nahrungsergänzungsmittel gehört hast, mit dem sie ihren bettlägerigen Cousin dritten Grades wieder zum Laufen gebracht hat …
Eine völlig Unbekannte schreibt dir auf Instagram, dass sie genauso jemanden wie dich sucht und es viele Möglichkeiten für solche Macher-Menschen wie dich gibt, sich selbst zu verwirklichen …
Ein Kumpel faselt auf einmal etwas von Strukturvertrieb und Lebensversicherungen und davon, dass es ganz einfach ist, fünfstellig im Monat zu verdienen …
Die Versprechen der MLM-Bubble sind in der Tat gigantisch.
Wir können völlig flexibel Geld verdienen.
Ganz bequem von zu Hause aus.
Selbst wenn wir siebzehn Kinder und drei Goldfische haben.
Es sind überhaupt keine Vorkenntnisse nötig.
Dafür winken quasi grenzenloses, passives Einkommen, ja finanzielle Freiheit gar – solange der richtige Einsatz gebracht wird.
Dabei ist inzwischen klar, dass der Hauptumsatz bei MLMs nicht durch den Verkauf der Produkte generiert wird, sondern durch das Anwerben von neuen Mitgliedern, die wiederum Produkte verkaufen.
Solche Praktiken sind sowohl in der Europäischen Richtlinie zu unlauteren Geschäftspraktiken (Richtlinie 2005/29/EG) als auch im deutschen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG §16 Abs. 2) nicht erlaubt.
Deshalb wird in MLMs einfach nicht transparent gesagt, dass die Rekrutierung von neuen Mitgliedern im Fokus steht. Fertig ist der durch und durch undurchsichtige „Werde dein eigener Girlboss“-Kuchen.
Denn ja: Natürlich werden durch die Betonung auf Flexibilität und Vereinbarkeit vor allem Frauen angesprochen.
Doch wie Dr. Claudia Groß vom Institute for Management Research der Radboud University Nijmegen zeigt, werden die Selbstverwirklichungs- und Umsatzversprechen nicht eingelöst. Durch die teils illegalen Praktiken, den Missbrauch sozialer Beziehungen und die sektenähnliche Zustände profitieren nur wenige an der Spitze.
Ein Mensch aus 40.000 wird mit MLMs reich.
Ein Mensch aus 2.000 kann mit MLMs ein Nettoeinkommen von 2.500–4.000 erwirtschaften.
Die durchschnittlichen Einkünfte, so Dr. Claudia Groß, liegen bei MLMs aber weit unter dem Mindestlohn.
Daran ändert auch nichts, dass eine Reihe von Celebritys sich positiv über MLMs äußern, als Speaker auf MLMs-Events auftreten oder gleich ganz einsteigen. Tony Robbins, GaryV, Chuck Norris, Jürgen Klopp. Die Liste ist lang.
MLMs sind für nahezu alle Menschen, die mitmachen, ein Verlustgeschäft und ganz sicher nicht die Möglichkeit für Frauen, sich selbst zu verwirklichen und finanziell frei zu werden.
Und weil es so unfassbar traurig ist, dass vor allem Frauen so bewusst und systematisch – oft im Namen des Female Empowerment – getäuscht werden, etwas Comic Relief.
#5 Kapitalismus in pink
Die Female-Empowerment-Bewegung auf Social Media ist also auffällig systemkompatibel. Schließlich müssen sich weder Männer noch Strukturen ändern, sondern wieder einmal wir Frauen.
Wir sind es, die mehr leisten müssen.
Wir sind es, die früher aufstehen müssen.
Wir sind es, die nicht gut genug sind.
Diese Botschaften sind praktisch fürs Marketing. Denn wer Frauen als Mangelwesen darstellt, kann ein Produkt anbieten, das diesen Mangel vermeintlich behebt.
Es ist ein perfides Businessmodell: Frauen einreden, dass sie nicht gut genug sind, und ihnen danach ein hochpreisiges vier-, fünf- oder sechsstelliges Produkt anbieten, damit sie sich endlich wertvoll fühlen.
Nicht selten werden Frauen dabei zusätzlich unter Druck gesetzt, indem ihnen ein „falsches Mindset“ attestiert wird, sollten sie diese Beträge nicht zahlen wollen oder können.
Das heißt jetzt nicht, dass Selbstständige, die mit anderen Frauen zusammenarbeiten, niemals verkaufen dürfen. Oder dass ihre Produkte nicht das kosten dürfen, was sie wert sind.
Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich einen bestehenden Bedarf bediene und bestehende Probleme lösen will oder ob ich die Frau als defizitäres Wesen inszeniere und es als ihre einzige Möglichkeit darstelle, ein teures Programm zu kaufen.
Manchmal werden noch nicht einmal Ratenzahlungen angeboten (und wenn doch, grundsätzlich immer mit einem saftigen Aufpreis im Vergleich zur Einmalzahlung) und Frauen werden direkt oder indirekt ermuntert, einen Kredit aufzunehmen und Schulden zu machen.
Die dunkle Seite des Female Empowerment treibt Frauen also mit ihren Gaslighting-Praktiken nicht nur in den finanziellen Ruin, sondern erfüllt auch eine Gatekeeping-Funktion, indem sie Selbstverwirklichung nur für Frauen mit entsprechenden finanziellen Ressourcen – oder diejenigen, die bereit sind, sich dafür zu verschulden – zugänglich macht.
„Gaslight, Gatekeep, Girlboss“.
Das ist nicht Female Empowerment sondern ein weißer „Upper Class“-Feminismus, von dem nur die Frauen profitieren, die eh schon privilegiert sind.
Die Tassen, Taschen, Shirts, Hoodies, Notizbücher, Stifte, Mousepads, Handyhüllen, Sticker, Poster, Schlüsselanhänger und Jutebeutel, auf denen „Girlboss“ oder „Girlpower“ gedruckt wird, wirken dagegen fast schon harmlos …
… sind es aber natürlich auch nicht. Hier wird nicht nur Zugehörigkeit durch Konsum erkauft. Die Shirts, auf den „Girlpower“ steht, werden nicht selten von Frauen in Südostasien unter prekären Bedingungen genäht.
Back to the roots
Natürlich ist das Anliegen, Frauen zu stärken und ihnen zu Chancen- und Einkommensgleichheit zu verhelfen, ein wichtiges.
Nur müssen wir Female Empowerment nicht individuell denken, sondern strukturell.
Wir müssen nicht das Vereinbarkeitsproblem von einigen wenigen glücklichen (weißen) Frauen lösen, sondern idealerweise von allen oder zumindest von möglichst vielen.
Wir können mit dem Frauenbild starten, dass Frauen bereits genug sind, so, wie sie sind, und dass sie sich nicht optimieren müssen, um erfolgreich zu werden. Klar dürfen Frauen lernen, wachsen und sich verändern – doch aus intrinsischer Motivation, weil sie ein Thema interessiert und sie es wollen.
Wir können ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten stärken, statt ihnen das Gefühl zu geben, dass ihnen etwas fehlt.
Wir können den Selbstwert von Frauen von Leistung und Erfolg entkoppeln und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie auch dann wertvoll sind, selbst wenn ein Plan nicht gelingt, selbst wenn sie nichts leisten.
Wir können anfangen, komplexere, realistischere Botschaften auf unseren Kanälen zu verbreiten. Botschaften, die deutlich machen: Der Weg zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit ist nicht immer gerade, einfach und pastellig. Wir können Wege aufzeigen, wie es vielleicht etwas leichter geht.
Wir können für Diversität einstehen und Frauen jeglicher Herkunft, Religion ansprechen und beschäftigen. Wir können darauf achten, dass die Bilder, die wir nutzen, die Vielfalt von Frauenkörpern abbilden, und nicht nur die Norm.
Wir können unsere Botschaften einem Intersektionalitätscheck unterziehen und uns fragen, ob wir hier aus einer privilegierten Position sprechen oder die tatsächlichen Lebensrealitäten, die oft Begrenzungen enthalten, mitdenken.
Wir können bei uns ansetzen und unsere eigenen Mitarbeiterinnen fördern, wertschätzen, respektieren, stärken und angemessen bezahlen.
Und zwar nicht nur am Frauentag, sondern 365 Tage im Jahr.
Inspirationszitathölle 😈 – „Inspirierende“ Zitate, die problematische Botschaften verbreiten
Wie viel Bullshit steckt eigentlich in den beliebtesten und berühmtesten „motivierenden“ und „inspirierenden“ Zitaten und Sprüchen auf Social Media? Eine Menge! Die meisten Inspirationszitate machen uns nicht etwa inspirierter, motivierter und produktiver, sondern nerven und setzen uns gewaltig unter Druck. Ein Erklärungsversuch.
Wie viel Bullshit steckt eigentlich in den beliebtesten und berühmtesten inspirierenden Zitaten und Sprüchen auf Social Media?
The answer may (not) surprise you: Eine Menge!
Die meisten Inspirationszitate machen uns nicht etwa inspirierter, motivierter und produktiver, sondern nerven und setzen uns gewaltig unter Druck.
Doch warum spüren wir eigentlich immer so ein Grummeln im Bauch, wenn „Bro Marketer“ Tobi, 23, auf Insta postet, dass wir stärker sein sollen als unsere Ausreden?
Warum zuckt es immer so komisch in unserem Auge, wenn Girlboss Sophia uns befiehlt, groß zu träumen?
Und warum kommt uns der Kaffee gleich wieder aus der Nase, wenn wir morgens im Halbschlaf was von „Positive mind, positive vibes, positive life“ lesen?
Ein Erklärungsversuch.
Inspirierende Zitate und Sprüche ermutigen uns, groß zu träumen, doch sie ignorieren gesellschaftliche und politische Realitäten.
Zunächst einmal, weil es niemand von uns mag, wenn unsere Lebensrealitäten, Erfahrungen und Grenzen bagatellisiert, ignoriert oder negiert werden.
Sicherlich kennst du diese Sprüche auch:
„Your only limit is your mind.“ (Unbekannt)
„Jeder ist seines Glückes Schmied.“ (Sprichwort)
„Du kannst alles schaffen, wenn du nur genug daran glaubst.“ (Unbekannt.)
„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ (Walt Disney)
„Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun.“ (Walt Disney)
„Believe you can and you're halfway there.“ (Theodore Roosevelt)
„Hindernisse können mich nicht aufhalten; Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall.“ (Leonardo da Vinci)
„Wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das Universum darauf hinwirken, dass du es erreichen kannst.“ (Paulo Coelho)
„There is nothing impossible to they who will try.“ (Alexander der Große)
„All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.“ (Earl Nightingale)
„If my mind can conceive it, if my heart can believe it, then I can achieve it.“ (Muhammad Ali)
„All dreams are within reach. All you have to do is keep moving towards them.“ (Viola Davis)
„Be stronger than you excuses.“ (Unbekannt)
„To hell with circumstances; I create opportunities.” (Bruce Lee)
„The only place where your dreams become impossible is in your own thinking.“ (Robert H. Shuller)
Du liest diese Sprüche und denkst dir einfach nur: Nein.
Alles zu schaffen, wenn man nur stark genug daran glaubt – das war, ist und wird für die meisten Menschen dieser Erde einfach niemals Realität.
Eine Frau kann ja zum Beispiel gerne davon träumen, einen Managerposten zu ergattern. Doch statistisch hatte sie die längste Zeit schlechtere Chancen als jemand, der einfach nur Thomas oder Michael hieß. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und da können wir uns dann noch so oft vorsagen, dass wir nur fest genug daran glauben müssen. Gegen den Thomas-Kreislauf kommen wir als Frauen nur schwer an.
Ebenso wird es schwerer sein, sich selbst zu verwirklichen, wenn man es mit rassistischen oder ableistischen Strukturen aufnehmen muss. Oder mit Homophobie, Gewalt oder mit Xenophobie.
Diskriminierungserfahrungen kosten unfassbar viel Kraft, die dann wiederum für Selbstverwirklichung fehlt.
Man stelle sich nur vor, wie Frauen im Iran „Your only limit is your mind“ lesen. Da möchte man sich für alle Menschen, die so etwas unreflektiert posten, kollektiventschuldigen.
Deshalb: Nein, wir tragen nicht zu 100% die Verantwortung für unseren Erfolg und Misserfolg. Unsere Herkunft, Umstände und das politische System, in das wir hineingeboren werden, spielen sehr wohl eine Rolle. Da können wir noch so oft an unserem „falschen Mindset“ arbeiten.
Ja, wir können uns mit unseren eigenen Gedanken motivieren oder limitieren, keine Frage. Doch natürlich immer im Rahmen unserer individuellen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Möglichkeiten.
Und dass Menschen das 2023 immer noch nicht verstehen, geht uns allen inzwischen gewaltig auf den Keks.
Inspirierende Zitate und Sprüche unterliegen der spätkapitalistischen Wachstumslogik und machen uns alle müde und erschöpft.
Mindestens genauso schlimm sind die Hustle-Zitate, denn der „Hustle“ – das ist in diesen Zitaten eine Lebenseinstellung, ja, fast schon eine Religion.
Jede Sekunde des Tages muss bestmöglich genutzt werden. Schlafen ist was für Luschen. Wenn wir schlafen, können wir schließlich nicht arbeiten; und wenn wir nicht arbeiten, können wir kein Geld verdienen; und wenn wir kein Geld verdienen, können wir es ja auch gleich sein lassen mit dem Kapitalismus.
Der Job wird über alles gestellt und genießt in allen Situationen oberste Priorität. Schließlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder du arbeitest zwanzig Stunden am Tag oder du bleibst erfolglos. Dazwischen gibt es nun einmal nichts. #Facts
Du weißt sicherlich, was ich meine:
„I’ve got a dream that’s worth more than my sleep.“ (Unbekannt)
„I’d rather hustle 24/7 than slave 9 to 5.“ (Unbekannt)
„Go hard or go home.“ (Unbekannt)
„Eat. Sleep. Hustle. Repeat.“ (Unbekannt)
„Without hustle, talent will only carry you so far.“ (GaryV)
„Good things happen to those who hustle.“ (Anais Nin)
„Stop whining, start hustling.“ (GaryV)
„Wähle einen Job, den du liebst, und du musst keinen Tag mehr im Leben arbeiten.“ (Unbekannt)
„Be the best version of yourself.“ (Unbekannt)
„Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.“ (Konfuzius)
„Hustle until you no longer need to introduce yourself.“ (Unbekannt)
„Stay positive, work hard, make it happen.“ (Unbekannt)
„If you live for the weekends and vacations, your shit is broken.“ (GaryV)
„Your 9-5 may make you a living, but your 5-9 makes you alive!“ (Nick Loper)
“My entire life can be summed up in four word: I hustled. I conquered.“ (Unbekannt)
„Invest in your dreams. Grind now. Shine later.“ (Unbekannt)
„Hustle beats talent when talent doesn’t hustle.“ (Ross Simmonds)
„Greatness only comes before hustle in the dictionary.“ (Ross Simmonds)
„Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won’t. So that you can spend the rest of your life like most people can’t.“ (Unbekannt)
„Hustle isn’t just working on the things you like. It means doing the things you don’t enjoy so you can do the things you love.“ (Unbekannt)
„Don’t stay in bed unless you can make money in bed.“ (George Burns)
„Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.“ (Abraham Lincoln)
„Success is never owned, it’s rented. And the rent is due every day.“ (Unbekannt)
„Today I will do what others won’t, so tomorrow I can accomplish what others can’t.“ (Jerry Rice)
Man muss keine Wahrsagerin sein, um zu prognostizieren, dass das eine ganz, ganz gefährliche Einstellung ist und Menschen, die 24/7/365 durcharbeiten, ihre Gesundheit ernsthaft aufs Spiel setzen und andere Lebensbereiche (Freunde, Familie, Kinder, Haushalt, Hobbys) sträflich vernachlässigen.
(Wobei … so als Mann hat man ja meist weniger Probleme in Punkte Vereinbarkeit. Das ist dann schon praktisch.)
Selbst wenn wir das, was wir tun, lieben, brauchen wir Pausen.
Und auch wenn die Menschen, mit denen wir arbeiten, mehr an Freundschaften erinnern als an Kundschaft, haben wir ein Recht auf Feierabend und Wochenende.
Oder um es mit Ovid zu sagen: „Was keine Pause kennt, ist nicht von Dauer.“
Deshalb nervt es auch so sehr, dass die Bros und Girlbosses auf Insta so tun, als wären Menschen Waren, deren Wert sich einzig daran bemisst, wie produktiv sie sind.
Inspirierende Zitate und Sprüche werten Alltägliches und Normalität ab.
Ein weiterer Grund, warum uns einige Inspirationszitate oft den letzten Nerv rauben, ist, dass sie Alltägliches, Gewöhnliches, Normalität und Durchschnittlichkeit abwerten und problematisieren.
Es reicht nicht, dass du einfach nur selbstständig bist, nein, du musst EIN IMPERIUM aufbauen und SIEBENSTELLIGE MONATSUMSÄTZE machen.
Wir müssen besessen von Erfolg sein, sonst werden wir alle noch *dramatische Pause* DURCHSCHNITTLICH.
Ja, durchschnittlich sein – das ist die größte Angst, die der durchschnittliche Entrepreneur mit dem durchschnittlich schicken Auto hat.
Er ist nie zufrieden, und alle, die zufrieden sind und „for mediocrity settlen“, sind grundsätzlich verdächtig und Menschen zweiter Klasse.
Diese ungewöhnlichen Menschen sagen dann gewöhnlicherweise solche Sachen wie:
„I’m not here to be average. I’m here to be awesome.“ (Unbekannt)
„Dream big“ (Unbekannt)
„Think big, dream big, believe big and the results will be big.“ (Unbekannt)
„Das Leben beginnt dort, wo deine Komfortzone endet.“ (Unbekannt)
„Escape the ordinary.“ (Unbekannt)
„How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?“ (Seth Godin)
„There is never a bad time to start a business – unless you want to start a mediocre one.“ (GaryV)
„You are unique. Don’t be a follower, be a leader.“ (Unbekannt)
„Don’t get comfortable with mediocrity.“ (Unbekannt)
„Being realistic is the most common path to mediocrity.“ (Will Smith)
„Never ever settle for mediocrity.“ (Unbekannt)
„Never let ‚good enough‘ be ‚good enough‘.“ (Unbekannt)
„A life of mediocrity is a waste of life.“ (Unbekannt)
„Be motivated by the fear of becoming average.“ (Unbekannt und seriously – WTF?😂)
„Dare to dream big“ (Unbekannt)
„Dream big, sparkle more, shine bright“ (Unbekannt)
„In a world full of average be outstanding.“ (Unbekannt)
„I did not wake up today to be average.“ (Unbekannt)
„Average will not be my legacy.“ (Unbekannt)
„‚Normal‘ is not in my dictionary.“ (Unbekannt)
Warum setzen sich Menschen bloß so sehr unter Druck?
Klar ist jede*r von uns besonders – in dem Sinne, dass es vermutlich niemanden auf der Welt gibt, der oder die dieselbe Kombination von Stärken, Schwächen, Erfahrungen, Ansichten, Meinungen, Werten und Lieblingssongs hat wie wir.
Doch der Alltag ist eben auch … Alltag. Ist die Komfortzone nicht auch etwas Schönes? Und sind wir nicht alle in den meisten Dingen völlig normal, mittelmäßig und manchmal auch etwas langweilig?
Das lässt sich übrigens auch wissenschaftlich belegen.
Das ist die sogenannte Gaußsche Normalverteilung.
Diese Glockenkurve ist einer der wichtigsten Typen von Wahrscheinlichkeitsverteilung und wird nicht nur in Naturwissenschaften, sondern auch in Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften verwendet.
Vereinfacht ausgedrückt sagt die Glockenkurve:
Wenn wir untersuchen, wie ein bestimmtes Merkmal unter allen Menschen verteilt ist (Körpergröße, Intelligenz, Talent, you name it), werden sich die meisten Menschen bei den meisten Dingen irgendwo in der Mitte wiederfinden. Und es wird nur wenige Ausreißer nach links oder rechts geben.
Lernst du Gitarre, ist die Wahrscheinlichkeit also groß, dass du nicht der nächste Django Reinhardt, aber eben auch kein totaler Loser sein wirst, sondern gerade mal so gut spielst, dass Menschen nicht panisch das Wohnzimmer verlassen, wenn du die ersten Takte von „Wonderwall“ anschlägst.
Lernst du kochen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es niemals mit Jamie Oliver aufnehmen wirst, aber deine Familienmitglieder zum Glück auch nicht vergiftest, sondern im Großen und Ganzen essbare Lasagnen produzierst.
Machst du dich selbstständig, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du kein „siebenstelliges Business“ haben wirst, aber eben auch nicht nur zwei Followerinnen auf Instagram (deine Mama und beste Freundin), sondern einfach einigermaßen zurechtkommst. Mit besseren und schlechteren Zeiten.
Und so weiter.
Das wahrscheinlichste Szenario ist also, dass wir in dem meisten, was wir tun, Mittelmaß sein werden. Langweiliges, gewöhnliches, durchschnittliches, normales Mittelmaß. Auch in unserer Selbstständigkeit und in unserem Marketing.
Ich persönlich finde das gar nicht so erschreckend, wie sich das auf den ersten Blick vielleicht anhören mag, sondern eher eine beruhigende Nachricht. Denn sie befreit uns endlich von diesem unsäglichen Druck, „groß zu träumen“ oder „außergewöhnlich“ sein zu müssen.
Auch das Normale und Gewöhnliche hat einen Wert. Oder haben wir schon wieder vergessen, wie wir uns damals in dem ersten Lockdown nach „einem Stück Normalität“ sehnten?
Vielleicht könnten wir dann ja auch bitte aufhören, so zu tun, als wären wir jemand, der wir nicht sind, und einfach unser Ding machen? Danke!
Zitate, die wollen, dass wir unsere Persönlichkeit verändern, nerven – und halten vermutlich unzählige Menschen davon ab, Arbeit zu erledigen, die okay, in Ordnung und einfach nur gut genug ist.
Inspirierende Zitate und Sprüche verbreiten toxische Positivität und stellen eine Gefahr für unsere mentale Gesundheit dar.
Wir müssen positiv bleiben, reden, sein – egal, was ist. Manche bezeichnen das schon als das „Diktat des positiven Denkens“ oder toxische Positivität.
Wenn ein Plan nicht gelingt und wir uns ärgern – macht nichts, solange wir immer schön weiterlächeln.
Und huch, da war ja ein negativer Gedanke – schnell in einen positiven verwandeln.
Meckern, schimpfen und Co. ist nicht – schließlich müssen wir immer und überall Good Vibes Only versprühen.
Hängen dir diese Sprüche inzwischen auch so zum Halse raus wie mir?
„Good vibes only.“ (Unbekannt)
„For every minute you are angry you lose 60 seconds of happiness.“ (Ralph Waldo Emerson)
„Say no to negative thoughts.“ (Unbekannt)
„Be happy. It drives people crazy.“ (Unbekannt)
„Positive mind, positive vibes, positive life.“ (Unbekannt)
„Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.“ (Willie Nelson)
„All things are positive if you believe.“ (Unbekannt)
„Being positive is a sign of intelligence.“ (Maxime Lagacé)
„Don‘t forget to smile.“
„Don’t worry, be happy.“
Diejenigen, deren Probleme sich in Luft auflösten, nachdem sie solch ein Zitat lasen, heben bitte die Hand!
Vermutlich werden wir uns nach diesen Zitaten noch nicht einmal besser fühlen, denn die Diskrepanz zwischen den Worten einerseits und den erlebten Gefühlen andererseits ist einfach zu groß.
Wir sagen „Don’t worry, be happy“ und verschlimmbessern unsere Situation, denn Gefühle wollen nicht verdrängt und negiert werden, sondern gefühlt, akzeptiert und verarbeitet.
Wir können nicht immer nur „nein zu ‚negativen‘ Gefühlen“ sagen, denn die gehören zu einer menschlichen Existenz nun einmal dazu und meist haben sie auch eine wichtige Funktion. Angst, Wut, Trauer sind schließlich nicht ohne Grund da.
Sie sind da, weil sie uns zeigen wollen:
„Achtung, Achtung. Alarm, Alarm. Hier ist gerade etwas nicht in Ordnung. Action required. Action required.“
Sollten wir nicht dann nicht lieber diese Notrufe ernst nehmen, statt sie zu ignorieren? Wir lösen Probleme doch nicht, indem wir sie durch einen Insta-Filter jagen. Wir verändern auch nichts an sozialen Missständen und Ungerechtigkeit, wenn wir wütenden Menschen ein „Fokussiere sich mal auf das Positive“ entgegensetzen.
Aber vielleicht ist das ja auch so gewünscht? Die Positive Psychologie ist schließlich verdammt systemkompatibel.
Denn wenn ich daran glaube, dass ich und nur ich alleine für mein Glück verantwortlich bin, indem ich bei Wut, Frust oder Erschöpfung einfach positiv denke, kommt mir ja gar nicht in den Sinn, etwas an den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen oder sozialen Missständen zu ändern.
All things are positive when you believe.
Wie praktisch.
Toxische Positivität auf Social Media: Ein kritischer Blick auf die „Good Vibes Only“-Bubble
Warum toxische Positivität auf Social Media ein großes Problem ist und wir als Selbstständige die „Good Vibes only“-Bubble auf Social Media dringend verlassen sollten.
Toxische Positivität – einer der Gründe, warum ich vor gut einem Jahr meinen Instagram-Account gelöscht habe.
Was dieser Begriff genau meint, welche Rolle soziale Medien bei der toxischen Positivität spielen und warum ich es so wichtig für Selbstständige finde, aus der „Good Vibes only“-Bubble auszusteigen, erzähle ich in diesem Artikel.
Inhalt
Was ist toxische Positivität? Eine Definition
Beispiele für toxische Positivität
Warum ist toxische Positivität so problematisch für Selbstständige?
All feelings welcome – Warum wir auch die unangenehmen Gefühle in der Selbstständigkeit brauchen
Was ist toxische Positivität? Eine Definition
Toxische Positivität meint eine Form von übertriebenem Optimismus und einen so starken Fokus auf das Positive, dass es zum Negieren, Ignorieren oder Verdrängen von bestimmten „unbequemen“ Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Enttäuschung oder Angst kommt.
In jeder Situation wird versucht, „positiv zu denken“. Und wenn andere Menschen traurig oder enttäuscht sind, wird ihnen gerne mal ein „Sieh es doch mal positiv“ oder „Don’t worry, be happy“ entgegengebracht.
Beispiele für toxische Positivität
Soweit die Theorie. Lass uns das Ganze jetzt mal an einigen konkreten Beispielen durchspielen, die den meisten Selbstständigen bekannt vorkommen dürften.
Toxische Positivität in der Offlinewelt
Zunächst einmal ist toxische Positivität nicht für die Onlinewelt reserviert. Wir finden sie auch im „wirklichen Leben“:
Wenn ein langjähriger Kunde gekündigt hat, wir enttäuscht sind und unsere Freundin sagt: „Kopf hoch! Das wird schon wieder …“
Wenn wir ein Ziel haben, es nicht erreichen, traurig sind und der Partner sagt: „Ist doch nicht so schlimm. Du machst doch trotzdem alles super …“
Wenn uns die Reaktion einer Kundin wütend macht und wir von der Mutter gesagt bekommen: „Du musst das Ganze positiv sehen …“
Alles toxische Positivität.
Diese Worte mögen zwar nett gemeint oder sogar als liebevoller Trost gedacht sein, aber in erster Linie negieren oder ignorieren sie die Gefühle, die wir in diesem Augenblick fühlen.
Enttäuschung, Traurigkeit, Wut.
Alles normale Gefühle, die zur normalen Bandbreite der menschlichen Empfindungen gehören und per se nicht schlechter sind als Freude, Neugier oder Glück.
Nicht nur im Privatleben, sondern auch in der Selbstständigkeit.
Toxische Positivität in sozialen Medien
Social Media hat toxische Positivität also nicht erfunden, treibt das Phänomen aber nochmal ins Extreme. Denn je nach Plattform und Bubble kann es sein, dass wir uns in einer Welt wiederfinden, in der alle ausschließlich immer nur gute Laune haben.
Sie machen einen total romantischen Herbstspaziergang.
Haben die besten und treuesten Kundinnen.
Haben ihre Jahresumsätze verhundertdreißigfacht.
Machen die siebte Workation in Island dieses Jahr.
Sind dreiundzwanzig Monate im Voraus ausgebucht.
Haben sich fünfzehn neue Kund*innen manifestiert.
Dazwischen gibt es Motivations- und Inspirationszitate am Fließband:
Good vibes only.
Bad vibes don’t go with my outfit.
Radiate positivity.
She just shines.
Things are gonna totally work out.
Don’t forget to smile.
Good Vibes Only – ein häufiges Motto auf Social Media
Warum ist toxische Positivität so problematisch für Selbstständige?
Abgesehen davon, dass natürlich niemandem jeden Tag die Sonne aus dem Popo scheint und manche Dinge auch mal nicht funktionieren werden, sind für mich insbesondere drei Punkte an toxischer Positivität ein Problem:
#1 Fehler, Probleme, Herausforderungen und damit verbundene Gefühle wie Enttäuschung, Frust und Traurigkeit sind in den sozialen Medien chronisch unterrepräsentiert
Hier werden Erfolge gefeiert und siebenstellige Jahresumsätze manifestiert, doch nur selten redet jemand über Absagen, Geldnot, Herausforderungen, Fehler oder Misserfolge und damit verbundenen Gefühle.
Die Unterrepräsentation von diesen Herausforderungen und „unangenehmen“ Gefühlen ist auf der einen Seite natürlich verständlich. Kaum jemand möchte sich vor allen Leuten verletzlich machen, kaum jemand möchte zugeben, dass er oder sie auch mal struggelt.
Das Bild, das andere Menschen von uns haben sollen, soll ein positives sein. Vor allem, wenn wir als Selbstständige darauf angewiesen sind, dass Menschen uns gut finden und mit uns zusammenarbeiten wollen.
Das erklärt, warum viele Selbstständige nur dann ihre Struggles teilen, wenn sie ein entsprechendes „Learning“ vorweisen können. („Ich hab einen Fehler gemacht und dann – Heureka! – habe ich etwas Entscheidendes gelernt und bin jetzt noch erfolgreicher als jemals zuvor.“)
Auf der anderen Seite ist diese Unterrepräsentation zutiefst problematisch. Denn dadurch denken viele Selbstständige, dass …
alle wissen, wie der Hase läuft, nur sie nicht
alle mit Erfolg gesegnet sind, nur sie diejenigen sind, die Geldsorgen und zu wenige Kund*innen haben
oder kurz: dass alle anderen „normal“ sind, dass aber mit ihnen etwas nicht stimmt, weil ihre Pläne nicht immer funktionieren und sie auch mal schwierige(re) Zeiten durchleben
Toxische Positivität isoliert also (= alle anderen sind normal und richtig, ich bin unnormal, falsch und gehöre nicht dazu). Und Isolation kann auf Dauer eine immense Herausforderung für die mentale Gesundheit werden.
#2 Toxische Positivität verändert unser eigenes Verhalten auf Social Media
Wenn alle immer gut gelaunt sind, dann tun wir halt auch so, als wäre bei uns alles in Butter.
Denn wir wollen natürlich dazu gehören zum Social-Media-Club.
Bloß nicht negativ auffallen, uns nicht „blamieren“.
Bloß nicht zugeben, dass ein Auftrag überraschend geplatzt ist, eine Kundin plötzlich gekündigt hat, dass wir in der Anfangszeit der Selbstständigkeit keine Kunden finden und deshalb traurig, enttäuscht oder frustriert sind.
Wir passen uns der heilen Instagram-Welt an und erzählen auch überwiegend von den guten Tagen, unseren kleinen und großen Erfolgen und den erreichten Zielen.
Und ehe wir uns versehen, leisten wir auch unseren Beitrag dazu, dass die Maschinerie „toxische Positivität“ in Gang bleibt.
Ein teuflischer Kreislauf.
#3 Wir fühlen uns schlecht, weil wir uns schlecht fühlen
Die Unterrepräsentation von Herausforderungen und bestimmten Gefühlen auf Social Media führt nicht nur dazu, dass wir diese Gefühle selbst nicht mehr öffentlich zeigen. Sie führt auch dazu, dass wir denken, dass Herausforderungen in der Selbstständigkeit und die damit verbundenen Gefühle nicht in Ordnung sind.
Dass Enttäuschung, Frust, Trauer oder Wut nicht in Ordnung sind, weil wir sie online nicht mehr sehen. Vielleicht bei irgendwelchen Trolls und Spammern, aber nicht bei unseren Kolleg*innen oder Kund*innen.
Schließlich sehen wir ja nur ihre guten Tage und größten Erfolge.
Und wenn uns dann ein Kunde absagt, fühlen wir uns nicht nur schlecht, weil der Kunde abgesagt hat. Wir fühlen uns nun auch schlecht, weil wir uns schlecht fühlen.
Und wenn wir noch nicht fünf- und sechsstellige Monatsumsätze haben, weil wir uns gerade erst selbstständig gemacht haben, fühlen wir uns nicht nur frustriert, weil zu viel Monat für den Kontostand übrig ist. Wir fühlen uns auch schlecht, weil wir frustriert sind und mal keine „Good vibes“ versprühen.
„Moment einmal“, denkst du dir jetzt vielleicht, „was spricht denn überhaupt gegen positives Denken oder Optimismus?“
Nichts spricht dagegen.
Zumindest, wenn du unter „positivem Denken“ oder „Optimismus“ eine zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung verstehst. Die habe ich ja auch.
Toxische Positivität ist aber mehr als das.
Es ist ein „Positiv um jeden Preis“.
Es ist das Negieren, Ignorieren, Verdrängen oder Abstreiten von bestimmten Emotionen.
Es ist ein so starker Fokus auf das Positive, dass kein authentisches Empfinden, kein authentischer Ausdruck mehr möglich ist.
Toxische Positivität zu kritisieren, heißt also nicht, Pessimistin zu sein oder sich „in Selbstmitleid zu suhlen“. Es heißt einfach nur, für einen authentischen Ausdruck als Mensch einzustehen – mit allen Gefühlen, die dazu gehören.
Es heißt, Probleme, Herausforderungen und Fehler anzunehmen – und nicht totzuschweigen.
Es heißt, es sich erlauben, alle Gefühle auszudrücken und zu fühlen – und sie nicht etwa mit Social Media zu betäuben.
All feelings welcome – Warum wir (auch) die unangenehmen Gefühle in unserer Selbstständigkeit brauchen
Denn wir brauchen alle Gefühle als Selbstständige.
Nicht nur Freude und Glück und Begeisterung. Sondern auch Wut, Enttäuschung, Frust oder Traurigkeit.
Ja, Sie mögen unangenehme Gefühle sein, aber sie sind gleichzeitig auch so unendlich wertvoll. Warum? Darum:
#1 Weil unangenehme Gefühle unerfüllte Bedürfnisse zeigen
Warum ist mir das so wichtig? Was ist mir überhaupt wichtig? Warum habe ich überhaupt so reagiert?
Gefühle sind eine großartige Möglichkeit, mehr über uns und unsere Bedürfnisse zu erfahren.
So ist in der gewaltfreien Kommunikation Wut nichts anderes als ein Warnblinker, der anzeigt, dass irgendein elementares Bedürfnis zu kurz kommt. Ein Hilfeschrei des Körpers quasi.
So wie in einem Auto der Motor kaputt gehen kann, wenn wir wichtige Warnungen ignorieren, können auch wir richtig krank werden, wenn wir bestimmte Gefühle und damit unerfüllte Bedürfnisse (zu lange) verdrängen.
Oder anders formuliert: Wir brauchen Frust, Ärger, Trauer und Wut, um unseren unerfüllten Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und mental und körperlich gesund zu bleiben.
#2 Weil unangenehme Gefühle große Transformation bewirken können
Alle großen beruflichen Veränderungen in den letzten Jahren wurden bei mir durch unangenehme Gefühle in Gang gesetzt.
Als ich wütend war, dass ein Kunde – und ich tippe diese Zeilen gerade mit dem Mittelfinger – immer wieder die Zeche prellte, wusste ich, dass ich meine Beratungen ab sofort nur noch per Vorkasse anbieten wollte.
Als ich im Sommer 2020 so erschöpft war, dass ich noch nicht mal mehr meine Gedanken hören konnte, wusste ich, dass es Zeit war, mich von Social Media zu verabschieden und meine Social-Media-Kanäle zu löschen.
Wut. Frust. Erschöpfung – alles normale Gefühle und eine riesige Chance für tiefgreifende Veränderung und echtes Wachstum.
#3 Weil unangenehme Gefühle tiefe Verbindungen zu Menschen schaffen
Manchmal struggelt eine Teilnehmerin in einem meiner Programme so sehr, dass sie vor allen anderen weint, während sie von ihrer Herausforderung erzählt.
Auch wenn es sich auf den ersten Blick seltsam anhören mag, aber diese Momente gehören zu den wertvollsten Erfahrungen, die ich der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleben darf. Denn wenn Teilnehmerinnen merken, dass sich jemand öffnet – wirklich öffnet und Gefühle zeigt – passiert eine Magie, die sich kaum in Worte fassen lässt.
Es entsteht eine Verbindung zwischen den Teilnehmerinnen, die nicht möglich wäre, wenn alle so tun würden, als wäre alles in Butter. Diese Verbindung ist unsichtbar und dennoch fast greifbar. Und sie zeigt sich nicht zuletzt in der Empathie und dem Verständnis, das der Teilnehmerin von allen Seiten entgegengebracht wird.
#4 Weil überstandene Krisen Resilienz ausbilden
Das Schöne an Trauer, Frust und Enttäuschungen ist: dass sie uns stärker machen.
Wenn wir diese Gefühle verarbeiten, indem wir sie nicht verdrängen, ignorieren oder betäuben, sondern …
sie annehmen
ihnen Zeit und Raum geben
sie fühlen („Was spüre ich wo im Körper?“)
sie benennen und kategorisieren („Ich fühle mich traurig, weil …“)
neugierig sind und versuchen, sie zu verstehen („Warum fühle ich mich so? Welches unerfüllte Bedürfnis steckt dahinter?“)
… können wir als Selbstständige Resilienz ausbilden.
Und selbst wenn wir niemals zu 100% sagen können, dass schon „alles gut wird“, wissen wir damit doch, dass wir klarkommen – egal, was passiert.
FOMO (Fear Of Missing Out): Symptome, Gründe, Tipps
Was ist FOMO aka Fear Of Missing Out genau? Was hat FOMO mit Social Media zu tun, wie zeigt sie sich im Alltag und vor allem: Was können wir tun, um FOMO zu reduzieren oder vielleicht sogar in JOMO (Joy Of Missing Out) zu verwandeln?
Eine Kollegin ist bei einem Netzwerk-Event und postet ein Selfie mit anderen Kolleginnen …
Eine zweite erzählt in ihren Storys, dass sie jetzt auf dieser angesagten neuen Plattform ist und schon 10k Follower hat…
Eine dritte lacht auf Facebook in die Kamera, während sie ins Flugzeug nach Bali steigt …
Eine vierte hat ein zweites Unternehmen gegründet, das schon nach acht Wochen durch die Decke geht …
Eine fünfte verkündet stolz, dass sie dieses Jahr eine Million Euro Umsatz gemacht hat …
Und du?
Du liegst gerade in Embryonalstellung auf der Couch, scrollst apathisch durch deinen Feed (während im Hintergrund die fünfundzwanzigste Wiederholung von Friends läuft) und fragst dich, ob du der langweiligste Loser bist, den die Menschheit je gesehen hat.
Ein typischer Fall von FOMO.
Inhalt
Welche Rolle spielen Smartphones, das Internet und Social Media?
Doch halt … Was bedeutet FOMO eigentlich?
FOMO = Fear Of Missing Out
FOMO ist ein Akronym, das sich aus den Anfangsbuchstaben von „Fear Of Missing Out“ zusammensetzt und auf deutsch „Angst, etwas zu verpassen“ bedeutet.
Dieses „etwas“ kann dabei theoretisch alles sein:
eine soziale Interaktion
eine Begegnung
eine Erfahrung
ein Ereignis
ein Erlebnis oder auch
eine Möglichkeit, neue Kund*innen zu gewinnen
So äußert sich das Phänomen FOMO in der Angst, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, abgehängt zu werden und außen vor zu bleiben.
Egal, ob in der Schule, im Studium, im Job, in der Selbstständigkeit, in der Freizeit oder in allen Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen: unter Freundinnen, Kollegen oder Familie.
FOMO: Welche Rolle spielen Smartphones, das Internet und Social Media?
Während die Angst, etwas zu verpassen, mit Sicherheit so alt ist, wie die Menschheit selbst („Oi, da hinten wird ein Mammut zerlegt, schnell hin, bevor der Säbelzahntiger kommt!“), ist der eigentliche Begriff FOMO noch relativ jung.
Patric James McGinnis verwendete ihn das erste Mal im Jahre 2004 in seinem Artikel für das Magazin der Harvard Business School. Darin beschrieb er als erster ein Gefühl, das ein typisches Syndrom für unseren digitalisierten Alltag werden sollte.
FOMO und Social Media
Kein Wunder eigentlich, dass im selben Jahrzehnt nicht nur das erste iPhone erschien (2007), sondern auch Facebook (2004) und Instagram (2010) gegründet wurden.
Denn Social Media ist für FOMO vor allem eins: Öl im Feuer.
Auf einmal können wir durch Statusupdates, Bilder oder Videos zu jeder Tages- und Nachtzeit Einblick in das Leben der anderen bekommen.
Egal, wo sie wohnen.
Und egal, wer sie sind. (Ob Cousine dritten Grades oder Beyoncé.)
Wir können uns mit unseren liebsten Freundinnen freuen.
Checken, was unsere jugendlichen Kinder so treiben.
Wir können unsere Ex-Partner „stalken“.
Nachgucken, ob unser Schwarm aus der Grundschule schon eine Glatze hat.
Oder ob die Erzfeindin aus der 7. Klasse mittlerweile vielleicht schon geschieden ist.
Sehen, wie es unserer Großtante in Kanada geht.
Und wie erfolgreich (oder nicht erfolgreich) unsere Kolleginnen sind.
FOMO und Nachrichtenkonsum
Auch die Nachrichtenseiten mit ihren sich minütlich aktualisierten Inhalten wecken den Wunsch, ständig up to date zu bleiben.
Statt einmal am Tag die Tageszeitung zu lesen oder abends die Nachrichten im Fernsehen zu gucken, checken wir nun mehrmals täglich (stündlich, minütlich), was es Neues in der Welt gibt.
Gleich morgens im Bett (oder allerspätestens auf dem Klo) nehmen wir das Smartphone zur Hand und hüpfen von einem Newsfeed zum nächsten:
Live-Blog zur Corona-Pandemie.
Live-Blog zur Bundestagswahl.
Live-Blog zum Ukraine-Krieg.
Bloß keine Meldung verpassen. Könnte ja etwas Wichtiges sein.
FOMO und E-Mails
Und wer kennt diesen Drang nicht, alle paar Minuten seinen Posteingang zu checken?
Schließlich könnte ja die Anfrage, die Zusage oder das Angebot drin sein!
Die typischen FOMO-Symptome
Doch die Möglichkeit, jederzeit an Neuigkeiten zu kommen und mit allen jederzeit online in Verbindung bleiben zu können, kommt mit einem hohen Preis.
Die Liste in lang:
FOMO und POPC
Eng verknüpft mit FOMO ist das Phänomen POPC, was „permanently online, permanently connected“ bedeutet.
Die Angst, etwas zu verpassen, führt zu einer Dauerpräsenz in den sozialen Netzwerken.
Und so wird Instagram nicht nur geöffnet, wenn man alleine ist und sich langweilt, sondern auch, wenn man mit anderen Menschen beisammensitzt, mit Freunden etwas unternimmt, während des Essens oder sogar während der Autofahrt.
Das Smartphone wird das erste sein, was man morgens nach dem Aufwachen berührt, und das letzte, bevor man abends einschläft.
Und mittlerweile hat die Angst, ohne Smartphone zu sein, sogar einen eigenen Namen bekommen: Nomophobie.
FOMO und FOBO
In einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten wird es immer schwerer, sich für eine Option zu entscheiden – und dabei zu bleiben.
Denn egal, wie toll dein Job, Hobby, Urlaub, ja dein Leben klingen mag – auf Instagram findest du mit Sicherheit jemanden, dessen Leben noch ein bisschen eindrucksvoller und spannender ist.
FOBO bedeutet „Fear Of Better Options“ und beschreibt die Angst vor besseren Möglichkeiten, also die Angst, dass sich hinter dem nächsten Klick mit Sicherheit eine noch bessere Alternative versteckt.
Ob ich schon einmal mehrere Stunden durch Pinterest gescrollt und nach einem Rezept für ein nahrhaftes Abendessen gesucht habe, um dann anschließend frustriert (und aus Zeitnot) einfach nur Pizza zu bestellen?!
I have.
Chronischer Stress
FOMO, FOBO, POPC – die Abkürzungen mögen zwar lustig klingen, aber die Folgen sind es nicht:
Die ständige Angst, etwas zu verpassen, der Druck, ständig online sein zu müssen, die ewige Jagd nach der noch besseren Alternative – all das erzeugt chronischen Stress.
Dieser kann sich in einer inneren Unruhe äußern, falls man mal nicht am Smartphone ist, und auch zu Schlafstörungen oder psychosomatischen Beschwerden wie Schweißausbrüchen führen.
Wir verlernen, präsent zu sein, und einen Moment wirklich zu genießen.
Stattdessen suchen wir jede Minute unseres Alltags darauf ab, ob sich daraus ein Post oder zumindest eine nette Story machen lässt.
Pic or it didn’t happen!
Die Konzentrationsfähigkeit und Produktivität nehmen ab
Irgendwann können wir uns nicht mehr so gut konzentrieren.
Zwischen dem Checken der Nachrichten-Live-Blogs, des Insta-Feeds, der Mails, der WhatsApps, der Likes, Follower und Kommentare schieben wir unsere „eigentlichen“ Aufgaben dazwischen, kommen aber zu nichts.
Denn unser Gehirn ist zu sehr damit beschäftigt, zwischen unzähligen Aufgaben zu switchen, und bekommt gar nicht erst die Chance, tiefer in eine Aufgabe einzutauchen und in den Flow zu kommen.
Wie unkonzentriert und unproduktiv ich durch FOMO und Social Media wurde, habe ich hier aufgeschrieben.
Überreizung, Erschöpfung und Schlafstörungen
Als introvertierter und hochsensibler Mensch habe ich es am eigenen Leib erfahren: Die vielen Videos und Posts, die kurzen Storys, die ständigen Pushbenachrichtigungen – es waren einfach zu viele Reize.
Schon fünf Minuten durch den Feed scrollen bedeutete für mich eine so große Menge an Informationen, dass ich sie gar nicht richtig verarbeiten konnte.
Ich fühlte mich ausgelaugt und erschöpft.
Jeden Tag.
Doch es gibt noch einen weiteren Grund für Erschöpfung durch FOMO:
Viele Jugendliche lassen sich nachts von ihrem Smartphone wecken und sind infolgedessen tagsüber übermüdet. Einer Studie zufolge stehen rund 20% aller Jugendlichen nachts auf, um Nachrichten oder Social Media zu checken.
Vergleicheritis
Kuratierte Highlights von Fremden im Internet führen dazu, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen.
Wie wir unsere Freizeit verbringen …
Wie viel Umsatz wir machen …
Unsere Reiseziele …
Unsere Wohnung …
… nichts ist im Vergleich zu den auf Hochglanz polierten Social-Media-Fassungen mehr gut genug.
Gefühl der sozialen Isolation
Daraus kann sich eine gefährliche Spirale entwickeln: Man fühlt sich einsam, nutzt die sozialen Netzwerke, um Verbindung mit anderen Menschen zu spüren – und fühlt sich letzten Endes (da alle anderen vermeintlich erfolgreicher sind und das spannendere Leben führen) isolierter als zuvor.
Angststörungen und Depressionen
Inwiefern soziale Medien Angststörungen und Depressionen begünstigen oder verstärken, ist inzwischen Gegenstand vieler Studien.
Manche sagen: nein.
Andere sagen: ja. (Vor allem bei jungen Mädchen.)
Mehr Unfälle im Straßenverkehr
FOMO ist aber nicht nur eine Gefahr für die mentale Gesundheit, sondern auch für die körperliche.
Einer Studie zufolge führt FOMO – völlig unabhängig von Alter und Geschlecht – zu einem risikoreichen Verhalten und damit zu potentiell mehr Unfällen im Straßenverkehr. Denn immer mehr Menschen nutzen ihr Smartphone nicht nur im Sitzen, sondern auch während sie auf der Straße laufen.
Gründe für FOMO
Woran liegt es, dass manche Menschen mehr unter FOMO leiden als andere?
Unerfüllte Bedürfnisse nach Autonomie und Verbindung
US-amerikanische und englische Forscher*innen haben in ihren Studien zu FOMO herausgefunden, dass es unter anderem mit unerfüllten Bedürfnissen nach Autonomie und Verbindung beginnt:
Wer sich einsam fühlt und mit seiner Lebenssituation unzufrieden ist, spürt häufiger FOMO und nutzt daraufhin vermehrt Social Media, um Verbindung zu anderen Menschen herzustellen.
Doch soziale Medien lösen FOMO nicht, sondern verstärken FOMO oft, was wiederum zu noch mehr Social-Media-Nutzung führt.
Eine doofe Spirale, aus der es gar nicht so leicht ist, wieder rauszukommen.
Geringes Selbstwertgefühl
Für mich ist FOMO immer auch mit dem Selbstwertgefühl verbunden. Denn letzten Endes steckt hinter FOMO immer die Annahme, dass
dort, wo ich jetzt bin,
das, was ich jetzt weiß,
das, was ich jetzt kann, und
das, was ich jetzt habe,
nicht genug ist.
Toxische Hustle Culture
Für Selbstständige spielt die Hustle Culture oft noch eine wichtige Rolle.
Der Lifestyle, in dem Karriere und Selbstverwirklichung wichtiger sind als Gesundheit, Familie und Hobbys, wird so verinnerlicht, dass es zur Normalität wird, permanent zu arbeiten.
GaryV zum Beispiel zelebriert diesen Lifestyle in den meisten seiner Videos, wenn er sich als der Hustle-Papst darstellt, der täglich 15 Stunden arbeitet, nie Feierabend macht, sich am Wochenende nicht ausruht und niemals in den Urlaub fährt.
„Kein Wunder, dass du nicht erfolgreich bist“, ist seine Message dann. „Schließlich nimmst du dir am Samstag frei, anstatt Content für deine Follower zu erstellen.“
#redflag
Selbstoptimierungs- und Produktivitätshype
Eng damit verknüpft sind der Selbstoptimierungs- und Produktivitätshype: Jede Minute des Tages gilt es inzwischen, produktiv zu nutzen.
Ausschlafen war gestern. Heute hat jeder einen „Miracle Morning“ und steht um 5 Uhr nachts auf, um Yoga zu machen.
Einfach so spazieren gehen und die Sonne genießen? Undenkbar! Lieber währenddessen einen Podcast hören, um sich gezielt weiterzubilden. 🤓
Das gleiche gilt fürs Kochen, Putzen und Wäsche waschen. Bitte immer mit Knopf im Ohr mit der neuesten Episode deines liebsten Podcasts zur Persönlichkeitsentwicklung.
(Sonst entwickelt sich deine Persönlichkeit noch zurück, wenn du das Klo putzt, während du Rage against the Machine hörst.)
Lesen? Ja, aber bitte nur Sachbücher, die dich beruflich weiterbringen. Am besten jeden Tag 20 Seiten, bevor du deinen Bulletproof-Kaffee trinkst.
Produktiv ist das neue Normal.
Kapitalismus
Stell dir vor, wenn alle Menschen sich nachmittags glücklich und zufrieden in die Sonne legen und ihren Feierabend mit ihrer Familie verbringen würden, anstatt ihre Zeit auf Social Media zu vertrödeln. – Wer würde dann auf all die Werbeanzeigen klicken und Dinge kaufen, die niemand wirklich braucht?
Deshalb ist es im Kapitalismus durchaus erwünscht, dass du ständig Angst hast, etwas zu verpassen. So kannst du dich noch mehr auf Social Media rumtreiben und noch mehr konsumieren.
Aufmerksamkeitsökonomie Social Media
Natürlich gab es Werbung und damit den Kampf um deine Aufmerksamkeit auch schon vor Social Media.
Doch noch nie ließ es sich so exakt messen, welche Themen, Headlines, Content-Formate und Co. funktionieren.
In Zeiten von Clickbaiting, Fake News und Katzenvideos scheint alles legitim zu sein, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hauptsache, die Engagement-Rate stimmt!
Man könnte es auch so formulieren:
Es gibt Menschen, deren Job ist es, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen und es dir möglichst schwer zu machen, offline zu gehen.
Kein Wunder, dass es nahezu unmöglich scheint, FOMO wieder loszuwerden.
Tipps, um FOMO loszuwerden oder zu vermeiden
„Nobody really cares if you don’t go to the party“
Hustle Culture durchbrechen
Es wäre viel gewonnen, wenn Selbstständige es schaffen würden, die Hustle Culture, der sie überall auf Social Media ausgesetzt sind, zu durchbrechen.
Wenn sie ihre Selbstständigkeit als nur einen von mehreren wichtigen Bereichen des Lebens begreifen und ihn nicht Tag für Tag aufs Neue gegenüber Gesundheit, Familie, Freunden und ihren Hobbys priorisieren würden.
Das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen verändern. Aber du kannst schon heute damit beginnen und …
Kund*innen gegenüber Grenzen setzen und dein Smartphone einfach mal ausstellen, wenn du Feierabend hast
dir auch wirklich einen Feierabend nehmen, wenn wir schon dabei sind
deine Gesundheit ernst zu nehmen und für ausreichend Bewegung sorgen
dein Smartphone aus dem Schlafzimmer verbannen
Beim Selbstwertgefühl ansetzen
Sich klarmachen, dass du gut genug bist.
Dass das, was du weißt,
das, was du kannst, und
das, was du tust,
jederzeit zu 100% gut genug ist.
Du kannst das nutzen, was du bereits hast (Wissen, Erfahrungen, Intuition) und musst dir nicht erst noch drölfzig YouTube-Videos ansehen oder Onlinekurse kaufen.
Verhalten reflektieren
Du kannst dein Verhalten reflektieren und dich fragen:
Warum habe ich jetzt das Smartphone in die Hand genommen?
Was brauche ich gerade eigentlich?
Kann mir das Smartphone geben, was ich brauche?
Welches Bedürfnis versuche ich mit dem Social-Media-Konsum zu erfüllen?
Bringt mich dieses Scrollen irgendwie weiter?
Welche Gewohnheit steckt hinter dem Griff zum Smartphone? (Kann ich einen Auslöser identifizieren?)
Journaling kann eine gute Möglichkeit, um den Reflexionsprozess zu begleiten.
Akzeptieren, dass jeder Mensch einzigartig ist
Es ist verrückt: Eigentlich hasse ich als introvertierter Mensch Großveranstaltungen mit jeder Faser meines Körpers. Doch wenn ich sehe, wie Kolleg*innen sich auf genau diesen Veranstaltungen rumtreiben und ihre Selfies schießen, werde ich ein bisschen neidisch … 🙈
Warum eigentlich?
Jeder Mensch hat unterschiedliche Persönlichkeiten, Werte, Interessen und Ziele.
Und nur weil manche Menschen es toll finden, alle Zelte abzubrechen, um in einem kleinen Van durch die Welt zu reisen, heißt es nicht, dass es auch zwingend ein passender Lebensentwurf für mich sein muss.
Hier ist ein Satz, der mir immer geholfen hat, wenn die Vergleicheritis auf Social Media überhand genommen hat:
Es ist okay, ein ruhiges Leben zu führen und zufrieden zu sein.
(Selbst wenn andere Menschen ein wildes führen.)
Präsenz trainieren
Es kann hilfreich sein, sich dafür zu entscheiden, in bestimmten Situationen kein Smartphone mehr zu nutzen und Smartphone-freie Zonen oder Smartphone-freie Zeiten zu etablieren.
Hier sind drei Ideen:
Ganz bewusst ohne Smartphone essen
Ohne Smartphone (und Podcast!) spazierengehen
Schlafzimmer zur Smartphone-freien Zone erklären
Wie kannst du lernen, den Moment zu genießen? Denn wenn du zufrieden in deinem Strandkorb an der Nordsee sitzt (oder auf deinem Liegestuhl im Garten), ist es auch egal, dass Influencer*innen gerade auf Bali in der Hängematte schaukeln.
Natürlich kannst du auch digitale Achtsamkeit in deine Social-Media-Praxis integrieren und beispielsweise
Accounts, die dir nicht gut tun und FOMO auslösen, ganz gezielt entfolgen
Social-Media-Apps am Wochenende deinstallieren
oder gleich einen längeren Social-Media-Detox oder gleich einen Digital Detox einlegen
21 Ideen für Social-Media-Pausen habe ich hier aufgeschrieben.
Hinter die Kulissen blicken
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass du immer nur die Bühnenfassung in den sozialen Medien siehst.
Die Highlights.
Das Endprodukt.
Die Crème de la Crème.
Du siehst die retuschierten, auf Hochglanz polierten Momentaufnahmen, die in den meisten Fällen nicht der (vollständigen) Realität entsprechen. Und wenn du dein Behind-the-Scenes-Ich mit der Bühnenfassung eines Menschen auf Social Media vergleichst, kannst du nur verlieren.
Wenn FOMO oder Vergleicheritis aufploppen, kannst du dir deshalb sagen:
Das ist nicht das ganze Bild.
Das ist verkürzt dargestellt.
Das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Alleinsein lernen
Du kannst dich darin üben, Zeit alleine zu verbringen. Gerne erst fünf Minuten, wenn dich ein längerer Zeitraum noch überfordert.
Du kannst die Gedanken und Gefühle, die hochkommen, beobachten und dich auf deinen Atem konzentrieren.
Vielleicht genießt du es schon bald, etwas alleine und nur für dich zu tun? Einen Spaziergang zum Beispiel. Oder das Aufschreiben von Gedanken, Lesen, ein Musikinstrument spielen und so weiter.
FOMO in JOMO (= Joy Of Missing Out) oder LOMO (= Love Of Missing Out) verwandeln
Was liebe ich es inzwischen, Dinge auf Social Media zu verpassen.😁
Die Bots.
Den Hass.
Die Schwurbler.
Die realitätsfremden Ratschläge von priviligierten Coaches, die keine Ahnung haben, was es heißt, als Mutter selbstständig zu sein und mit Kind, Job und Haushalt zu jonglieren.
Alles hat zwei Seiten.
Wenn du dir klarmachst, was du gewinnst, wenn du etwas auf Social Media verpasst, ist es viel leichter.
Unproduktivität lernen
Du kannst den Produktivitäts- und Selbstoptimierungshype auch einfach ignorieren und so etwas Verrücktes tun wie
Ausschlafen
dir spontan freinehmen und den ganzen Arbeitstag damit verbringen, dir die zweite Staffel von Bridgerton reinzuziehen
einen seichten Roman lesen, bei dem du schon auf der ersten Seite weißt, wie die Geschichte ausgeht
Ohne Podcast kochen (😱) und mit deinen Mitmenschen reden
Du musst nicht jede Minute des Lebens etwas leisten, ständig online sein. Du darfst auch einfach nur sein.
Social-Media-Kanäle löschen
Ich selbst habe einen radikalen Schritt gemacht, um FOMO loszuwerden, und meine Social-Media-Profile gelöscht.
Es war faszinierend zu beobachten, dass ich in den ersten Tagen immer noch automatisch nach dem Smartphone gegriffen habe, um Insta zu checken, sich das aber nach wenigen Wochen bereits vollständig gelegt hat.
Inzwischen spüre ich 0,0% FOMO, wenn ich an Social Media denke, und zu 100% JOMO.😊
Und wenn ich wissen will, wie es bestimmten Menschen geht, dann schreibe ich ihnen einfach eine Nachricht, treffe mich mit ihnen auf einen virtuellen Kaffee in Zoom oder sehe sie gleich live und in Farbe.
E-Mails vom Smartphone deinstallieren
Falls du zu den Menschen gehörst, die ständig E-Mails checken, probiere es mal aus, die E-Mail-Apps von deinem Smartphone zu deinstallieren.
Plus: E-Mails am Smartphone sind richtige Zeitfresser. Meist lesen wir die Mails nur und antworten später, wenn wir wieder am Rechner sitzen. Ich habe für mich schon vor Jahren beschlossen, dass ich keine E-Mails auf meinem Smartphone brauche. Und es ist herrlich.
Rituale etablieren
Hier sind drei Ideen:
Tag ohne Smartphone beginnen
Tag ohne Smartphone beenden
Pausen ohne Smartphone verbringen
Solche Rituale sind der beste Garant für digitale Balance.
Fragen zu FOMO (Fear of missing out)
Was bedeutet die Abkürzung FOMO?
Die Abkürzung FOMO („Fear of missing out“) steht für die Angst, etwas zu verpassen.
Was ist das Gegenteil von FOMO?
Das Gegenteil von FOMO ist JOMO, was „Joy of missing out“ bedeutet und mit „Freude, etwas zu verpassen“ übersetzt werden kann. Denn etwas zu verpassen, muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein.
Was bedeuten die Abkürzung LOMO, FOBO und MOMO?
Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine neue Abkürzung daher.😊
Neben FOMO und JOMO gibt es auch die Abkürzungen LOMO, FOBO UND MOMO.
LOMO ist quasi die Steigerung von JOMO und bedeutet „Love of missing out“ („Die Liebe, etwas zu verpassen“).
FOBO steht für „Fear of better options“ und beschreibt die Angst, die viele Menschen haben, dass an der Ecke eine noch bessere Option wartet. Entscheidungsschwierigkeiten also.
Du weißt, dass deine Freunde sich ohne dich treffen, aber bisher wurden noch keine Fotos auf Instagram mit Cocktails gepostet? Ein typischer Fall von MOMO („Mystery Of Missing Out“).
Was bedeutet Nomophobie?
Nomophobie bezeichnet die Angst, ohne Handy zu sein.
Wie zeigt sich FOMO im Marketing?
FOMO wird von Selbstständigen und Unternehmen gerne und oft im Marketing verwendet, um Menschen zum Kaufen zu bringen. Meine Gedanken dazu habe ich im Blogartikel „Warum FOMO als Marketingstrategie ein Problem ist“ aufgeschrieben.
Ist FOMO eine Krankheit?
Eine Krankheit im Sinne des ICD ist FOMO (noch) nicht. Aber eins steht auf jeden Fall fest: FOMO kann sich auf jeden Fall zu einer ernsten Belastung entwickeln. Glücklicherweise lässt sich FOMO mit Gewohnheiten auf ein Minimum reduzieren.
Was kann man gegen FOMO tun?
Wer FOMO wieder loswerden will, hat mehrere Möglichkeiten. Eine Herangehensweise ist, die Hustle Culture, nach der Selbstständige immer busy sein zu haben, zu durchbrechen und auch mal unproduktiv zu sein. Gerade präsent zu sein, spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, FOMO loszuwerden. Denn wer präsent ist – wirklich da im Moment –, der muss nicht zwingend nach dem Smartphone greifen und gucken, was gerade so auf Instagram passiert.
Apropos: Wenn es die sozialen Netzwerke sind, die FOMO auslösen, sollte man überlegen, den Konsum auf ein Minimum zu reduzieren oder einige Kanäle ganz zu löschen. Das Wichtigste ist aber sicherlich die Reflexion des eigenen Verhaltens.
Wie entsteht FOMO?
US-amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass vor allem unerfüllte Bedürfnisse nach Autonomie und Verbindung die Entstehung von FOMO begünstigen. Daneben ist es auch ein geringes Selbstwertgefühl, das uns glauben lässt, dass das, was wir sind, wissen und können, nicht genug ist.
Und schließlich sorgen auch die toxische Hustle Culture sowie der Selbstoptimierungshype dafür, dass wir glauben, immer produktiv und online sein zu müssen.
Wer ist von FOMO betroffen?
In der öffentlichen Diskussion wird FOMO als ein Phänomen dargestellt, das vor allem Jugendliche und junge Erwachsene betrifft. Allerdings kann FOMO natürlich jeden Menschen treffen – unabhängig von Alter oder Geschlecht. Die Nutzung eines Smartphones, von Social Media und Messengerdiensten scheint FOMO zu begünstigen.
Warum habe ich immer Angst, etwas zu verpassen?
Es gibt viele verschiedene Gründe für FOMO. Am besten ist, sein Verhalten kritisch zu reflektieren und die Trigger zu identifizieren.
Warum ist FOMO so weit verbreitet?
FOMO ist so weit verbreitet, weil es durch Smartphone, Internet, Social Media und Messengerdienste wie WhatsApp begünstigt wird.
Gibt es Studien zu FOMO?
Ja. FOMO wird in der Psychologie bereits eingehend untersucht.
Diese Studie zeigt, dass FOMO zu einem riskanteren Verhalten im Straßenverkehr führen kann.
Diese Studie zeigt unter anderem, dass soziale Medien mit FOMO verknüpft sind.
In dieser Studie wird untersucht, welche Rolle FOMO und Vergleicheritis bei Depressionen spielen.
Dem Zusammenhang von FOMO und mentaler Gesundheit wird auch in dieser Studie nachgegangen.
Fazit: FOMO aka Fear Of Missing Out – it‘s a thing!
Mit den Möglichkeiten des Smartphones, Internets und der sozialen Medien haben immer mehr Menschen Angst, etwas zu verpassen, wenn sie offline gehen.
Dauerpräsenz in den sozialen Netzwerken, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und produktiv zu arbeiten, chronischer Stress und soziale Isolation sind häufige FOMO-Symptome.
Doch es ist möglich, FOMO loszuwerden und eine gesunde Phone-Life-Balance zu etablieren: mit Reflexion, gesunden Gewohnheiten und Präsenz.
Selbstständig in Krisenzeiten – Wie mit Krieg und Katastrophen umgehen?
Wie können Selbstständige mit Krisen, Krieg und Katastrophen umgehen? Einige Vorschläge und Gedankenanstöße gibt es in diesem Blogartikel.
Es ist Krieg in Europa und wir sind alle fassungslos angesichts der unvorstellbaren Zerstörung und des unendlichen Leids der Menschen in der Ukraine.
Als Menschen fühlen wir mit den Opfern des Krieges mit. Möglicherweise weinen wir, verzweifeln und verstehen die Welt nicht mehr.
Als Selbstständige beschäftigen uns zusätzlich noch andere Fragen:
Soll ich mich zu den aktuellen Geschehnissen äußern oder lieber schweigen?
Wie soll ich mich gegenüber meinen Kund*innen verhalten?
Was soll ich auf Social Media sagen?
Darf ich in einer Krise überhaupt „normal“ arbeiten und Geld verdienen?
Muss ich jetzt meinen Launch absagen?
Darf ich auch erstmal völlig von der Bildfläche verschwinden?
Wie gehe ich als Selbstständige also mit Krisen, Krieg und Katastrophen um?
Einige Vorschläge und Gedankenanstöße habe ich dir im Folgenden zusammengetragen:
Inhalt
#1 Den ersten Schock verarbeiten
Die berühmte Sauerstoffmaske im Flugzeug – wir setzen sie uns immer zuerst selbst auf.
Noch bevor wir daran denken, anderen Menschen zu helfen, helfen wir zuerst uns. Das gilt nicht nur für Eltern und Kinder im Flugzeug, sondern auch für uns als Selbstständige.
Noch bevor wir also an Kund*innen, Social-Media-Posts oder anstehende Launches denken, sorgen wir erst einmal für uns und leisten uns erste Hilfe.
✅ Pause einlegen
Wenn du gerade nicht „business as usual“ machen kannst, kannst du dir ein guter Freund sein und auf den Pausenknopf drücken. Minuten, Stunden, Tage, Wochen – alles ist okay, wenn du es für dich einrichten kannst.
Dass du gerade nicht kreativ arbeiten kannst, hat einen Grund:
Laut der Maslow’schen Bedürfnispyramide müssen zuerst elementare Bedürfnisse erfüllt sein, bevor wir uns um „Luxusbedürfnisse“ wie Selbstverwirklichung kümmern können.
Will heißen: Solange Ängste und Sorgen dominieren und das Bedürfnis nach Sicherheit unerfüllt bleibt, ist es schwer für Menschen, kreativ zu arbeiten.
Somit hat es überhaupt keinen Sinn, sich zum Arbeiten zu zwingen. Sinnvoller ist es, eine Pause einzulegen und Selbstfürsorge zu betreiben: Laptop zuklappen, Social-Media-Apps deinstallieren oder Smartphone ganz ausschalten und sich etwas Gutes tun wie zum Beispiel ein Spaziergang oder ein schönes Essen.
Du kannst partout nicht freimachen?
Vielleicht kannst du dich fragen:
Welche Aufgaben sind wirklich wichtig?
Was muss ich unbedingt heute machen und was kann ich auf später verschieben?
Welche Termine kann ich verlegen?
Was kann ich vielleicht ganz absagen, weil ich den Termin eh nicht wollte?
Und: Welche eine kleine Sache kann ich heute für mich tun, damit es mir ein bisschen besser geht?
✅ Gefühle verarbeiten
Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um in Kontakt mit unseren Gefühlen zu kommen, zum Beispiel indem wir …
… in unseren Körper hineinspüren und uns fragen: Wie geht der Atem? Wie schlägt das Herz?
… unsere Gefühle benennen und kategorisieren, zum Beispiel „Ich fühle mich wütend / ohnmächtig / traurig / ängstlich / ruhig.“
Es gibt keine „guten“ oder „schlechten“ Gefühle. All feelings are welcome.
Mir persönlich hilft der Austausch mit anderen.
Zu sagen „Ich bin fassungslos, wenn ich an all die Menschen denke, die jetzt sterben“ und zu hören „Du, mir geht es genauso. Es ist so unfassbar, was gerade passiert“, wird die Weltlage nicht verändern, aber es wird dir zeigen, dass …
du nicht alleine mit deinen Gefühlen bist
du verstanden und gesehen wirst
du auch in schwierigen Zeiten Verbindung zu anderen Menschen herstellen kannst
Weitere Möglichkeiten, dir deiner Gefühle klar zu werden und/oder sie zu verarbeiten:
Schreiben
Musik hören
Humor (Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es heißt nicht umsonst „Comic Relief“.)
❌ Schlechtes Gewissen und Rechtfertigungen
Alle anderen leiden, doch du kommst mit den Geschehnissen gut zurecht?
Es ist okay.
Genauso wie es in Ordnung ist, unter einer Krisensituation zu leiden, ist es natürlich auch völlig in Ordnung, resilient und stark zu sein. (Du weißt schon: All feelings are welcome.)
Es ist in Ordnung zu sagen: Ich sehe all das furchtbare Leid, das der Krieg hervorbringt, und es furchtbar, aber … ich bin soweit okay.
Es ist okay, okay zu sein.
Niemand braucht ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben.
Auch wenn du weitestgehend „normal“ arbeiten und dich konzentrieren kannst, musst du dich niemandem gegenüber rechtfertigen. Wenn dich deine Arbeit ablenkt und dir gut tut, umso besser.
❌ Toxische Positivität
Etwas anderes ist es, eigene Gefühle zu verdrängen oder den Sorgen und Ängsten deiner Mitmenschen „Es wird schon alles gut.“ oder „Wir sehen das jetzt mal positiv.“ entgegenzubringen.
Es spricht auch in Krisenzeiten nichts gegen Optimismus und eine zuversichtliche Lebenseinstellung.
Aber ein so starker Fokus auf das Positive, dass es zum Negieren, Ignorieren, Verdrängen oder Abstreiten von bestimmten Emotionen kommt und kein authentisches Empfinden mehr möglich ist, hilft niemandem.
Auch dir nicht.
❌ Zwang und Druck
Ich glaube: Wer sich als Business-Coach nicht dazu motivieren kann, auf den Kanälen Business-Tipps zu geben, kann davon ausgehen, dass es seiner Community ähnlich geht und sie gerade eh keinen Kopf für Businesstipps haben.
Ich würde mich nicht zum Arbeiten zwingen (oder zum Posten, Tippsgeben, Bloggen oder Newsletterschreiben), sondern vielmehr darauf vertrauen, dass ich wieder Freude und Motivation bei meiner Arbeit spüren werde, wenn es mir wieder besser geht.
#2 Menschlich sein
Als Selbstständige wollen wir in erster Linie als Expertin wahrgenommen werden.
Doch meiner Erfahrung nach sind Krisenzeiten eher dafür da, menschlich zu sein – auch unseren Kund*innen, Newsletterabonnent*innen oder Followern gegenüber.
✅ Gefühle teilen
Wer will, kann seine oder ihre Gefühle teilen und erzählen, wie es ihm oder ihr im Moment geht.
Ich habe meine Gefühle angesichts des Kriegs in der Ukraine in meinem Newsletter beschrieben und war überwältigt von den Reaktionen, der Anteilnahme und der Hilfsbereitschaft der Menschen.
✅ Verbindung suchen
Wenn du nicht weißt, was du angesichts der schrecklichen Ereignisse sagen sollst, kannst du auch „nur“ Verbindung suchen.
Einen Dialog starten.
Menschen fragen, wie es ihnen mit der Situation geht.
Zuhören.
Manchmal ist es genug, da zu sein und Kommunikationsräume zu eröffnen – selbst wenn du „im wahren Leben“ Webdesigner*in oder Fotograf*in bist.
❌ Dampf ablassen
Emotionen, die du selbst noch nicht klar gekriegt hast, würde ich persönlich nicht mit deiner Community teilen.
Bereits kategorisierte Gefühle zeigen („Ich bin zutiefst geschockt/traurig/wütend.“) – ja.
Deine Community nutzen, um Dampf abzulassen („Dieses verf*ckte A*schloch soll in der Hölle schmoren!!!“) – nein.
Worte, die du im Newsletter geschrieben oder auf Social Media geteilt hast, kannst du nicht so schnell wieder zurücknehmen.
#3 Solidarität zeigen
Nach dem ersten Schock und der Lethargie merken wir, dass wir dringend etwas tun müssen, weil wir sonst verrückt werden, wenn wir noch mehr von diesen schrecklichen Bildern sehen.
Nicht nur als Menschen, auch in unserer Funktion als Unternehmer*in können wir uns mit den betroffenen Menschen solidarisieren, unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen und Menschen helfen.
✅ Kleine Gesten
Es muss nicht immer gleich der große Wurf sein.
Ich habe, noch bevor ich in der Lage war, auch nur irgendetwas zu tun, ein gelbes und ein blaues Herzchen in meinen Footer eingebunden.
In einem der wenigen Newsletter, die ich noch abonniert habe, wurde eine Playlist mit heilsamen Songs geteilt.
Kleine Geste.
Große Wirkung (für mich persönlich).
Denke immer daran, dass eine (aus deiner Sicht) winzige Kleinigkeit einem anderen Menschen in schwierigen Zeiten eine große Hilfe sein kann.
Also:
Welche kleine Sache kannst du tun, um jemandem in dieser Zeit zu helfen?
✅ Geld spenden
In Krisenzeit wird vor allem Geld gebraucht. Und auch als Unternehmer*in kannst du natürlich einen Beitrag leisten und spenden.
✅ Größere Aktionen
Falls du bereits über ein größeres Netzwerk verfügst, kannst du auch deine Kolleg*innen zusammentrommeln und eine Spendenaktion organisieren.
Ich habe Anfang 2021 zum Beispiel ein „Online Festival“ zum Thema Pinterest veranstaltet.
Wir haben eine Woche lang kostenlos unsere Expertise zur Verfügung gestellt und Spenden für die Coronakünstlerhilfe gesammelt.
Und auch jetzt nutzen viele Influencer*innen ihre Reichweite und stellen größere Aktionen auf die Beine.
✅ Reichweite Betroffenen zur Verfügung stellen
Eine tolle Idee von Biathlet Erik Lesser:
Er stellt seinen Instagram-Account, auf dem er allein 30k russische Follower hat, ukrainischen Sportlern zur Verfügung, damit sie über den Krieg informieren.
❌ Blinder Aktionismus
Der Wunsch zu helfen, ist nur allzu verständlich.
Doch lass dich nicht von blindem Aktionismus anstecken, der weder dir noch den von der Krise betroffenen Menschen weiterhilft.
Wenn du spendest, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Spende bei einer vertrauensvollen Organisation ankommt. Beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen gibt es eine tagesaktuelle Liste von Hilsorganisationen sowie grundsätzliche Tipps fürs Spenden in Katastrophen- und Krisenfällen.
Wenn du spendest, sollte die Spende zielgerichtet sein. Sachspenden sind zwar nett gemeint, aber für die meisten Organisation sind Geldspenden um einiges sinnvoller.
Wenn du deiner Community helfen willst, kannst du überlegen, ob du das wirklich willst oder nur aus „Gruppendruck“ machst.
Nur weil viele deiner Kolleginnen in Krisenzeiten für ihre Community da sein wollen und spontan Workshops und Hilfsangebote auf die Beine stellen, heißt es nicht, dass es dein Weg sein muss.
❌ Über andere Hilfsangebote urteilen
Ich bin mir sicher: Wir alle tun gerade das, was in unserer Macht steht.
Politisches Engagement.
Persönliche Gespräche.
Liebe Nachrichten.
Ehrenamtliche Unterstützung.
Alles ist wichtig und richtig.
Es gibt hier kein Besser oder Schlechter.
Kein Richtig oder Falsch.
Wir brauchen jedes blau-gelbe Herzchen, jede Demo, jedes Gespräch, jeden Anruf, jeden Blogartikel, jede Meditation, jede Spende, jede Aktion, jede Vermittlung, jeder Übersetzung, jedes Lächeln, jede Mail, jedes „Heute lasse ich mein Auto stehen und fahre mit dem Fahrrad – Puck Futin!!!!“ und jeden Musiker, der sich jetzt vor die russische Botschaft stellt und für den Frieden spielt.
Gerade die Fülle und die verschiedenen Arten der Hilfen ist das Wunderbare.
#4 Business as usual?
Und wie geht es nun ganz konkret mit deiner Selbstständigkeit weiter?
✅ Kommunikation nach außen anpassen
In den meisten Fällen wird es das Beste sein, die Kommunikation nach außen anzupassen.
So wie große Fernsehsender auf die veränderte Weltlage reagieren und Sondersendungen bringen, kannst auch du als Selbstständige dein „Programm“ ändern und über die Krise sprechen.
Keine Angst übrigens, dass deine Expertise dadurch Schaden nimmt. Menschen brauchen in Krisenzeiten vor allem eins: andere Menschen.
Ob du deine für die Veröffentlichung geplanten Blogartikel und Social-Media-Posts auf Eis legst, musst du selbst entscheiden.
You do you.
❌ Falsche Informationen teilen
Mit Reichweite kommt Verantwortung.
Je mehr Reichweite wir haben, desto penibler sollten wir darauf achten, welche Informationen wir auf unseren Kanälen weiterverbreiten.
Vor allem Social Media lädt quasi dazu ein, vorschnell etwas zu teilen, das uns emotional berührt – nicht selten bewusst gestreute Falschinformationen.
Wie du Fakten auf ihre Echtheit überprüfst, erfährst du unter anderem hier.
✅ Geld verdienen während einer Katastrophe
Wenn du deine Arbeit plötzlich als banal empfindest … keine Panik. Egal, wie sehr du deinen Job liebst – das meiste auf dieser Welt wird klein und unbedeutend im Angesicht von Krieg, Leid und Pandemien.
Ich würde zu diesem Zeitpunkt deshalb keine voreiligen Entscheidungen („Ich schmeiss alles hin, denn mein gesamtes Business ist total sinnlos.“) treffen, sondern die Reflexion und Transformation auf später verschieben, wenn ich mich an die neue Situation adaptiert habe. (Gleich mehr dazu.)
Du darfst natürlich auch in Krisenzeiten Geld verdienen.
Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Geld verdienen während einer Katastrophe und Geld verdienen mit einer Katastrophe.
die Bäckerin, die weiterhin Brötchen backt
die Busfahrerin, der weiterhin Menschen von A nach B bringt
der selbstständige Yogalehrer, der weiterhin Kurse anbietet
die Marketingberaterin, die weiterhin andere Selbstständige berät
Sie alle haben gemeinsam, dass sie weiterhin ihrem Beruf nachgehen und Geld verdienen.
Daran ist erst einmal nichts Verwerfliches.
Denn egal, ob du nun angestellt, verbeamtet oder selbstständig bist – selbstverständlich brauchst du auch während einer Pandemie oder eines Krieges in Europa Geld zum Leben.
Doch im Gegensatz zu Angestellten bekommst du als Selbstständige kein festes Gehalt auf dein Konto, sondern musst selbst dafür sorgen, dass neue Aufträge reinkommen.
Und das kann in Krisenzeiten, wenn es dir selbst nicht gut geht, eine große Herausforderung und hohe Belastung sein.
Es kann sich merkwürdig anfühlen, Workshops zu halten und Logos zu designen, während es anderen Menschen so schlecht geht.
Verständlich.
Aber du darfst es.
Wirklich.
✅ Auf veränderten Bedarf reagieren
Es ist aus meiner Sicht auch nicht verwerflich, auf einen veränderten Bedarf zu reagieren.
Wenn du Meditationstrainerin bist und nun einen Beitrag leisten kannst, damit Menschen ihre Ängste und Sorgen verarbeiten und in diesen schweren Zeiten etwas Ruhe und Frieden finden, dann brauchen wir dich.
❌ Geld verdienen mit einer Katastrophe
Anders sieht es aus, wenn du Geld mit der Katastrophe zu verdienen planst.
So wie zu Beginn der Corona-Pandemie „clevere“ Unternehmer die damals beim medizinischen Personal so dringend benötigten FFP2-Masken aufkauften, um sie um ein Vielfaches weiterzuverkaufen.
So wie Politiker Maskendeals abschlossen.
Oder wenn jemand vulnerable Gruppen und von der Krise betroffene Menschen ausnutzt, um sich zu bereichern.
Ein ganz klares: Nope.
Mögen diese Menschen im Dunkeln auf einen spitzen Legostein treten.
#5 Heilen
Kommen wir zum letzten Punkt. Der Heilung.
Denn auch wenn wir es uns zu Beginn einer Krise nicht vorstellen können, aber wir Menschen haben die verrückte Eigenart, dass wir uns irgendwie an die äußeren Umstände anpassen.
An Wirtschaftskrisen.
An Pandemien.
An Krieg.
Meist gehen wir gestärkt aus einer Krise hervor und bauen Resilienz auf – auch als Selbstständige.
✅ Zeit zum Trauern
Zunächst einmal brauchen wir aber Zeit zum Trauern.
Selbst wenn wir niemanden im Krieg verloren haben, haben wir etwas anderes verloren: eine bestimmte Art von Zukunft.
Eine Zukunft in Gesundheit.
Eine Zukunft in Frieden.
Eine Zukunft in Sicherheit.
Wir brauchen Zeit, die Zukunft zu betrauern, die wir nicht mehr haben werden, weil jetzt Krieg herrscht.
Diese Tage und Wochen der Trauer fühlen sich schwer an, keine Frage. Aber sie sind so unfassbar wichtig, um weiterzumachen.
✅ Reflexion
Wenn sich die Welt verändert, verändern wir uns auch.
Als Menschen, aber auch als Selbstständige.
Um gestärkt aus einer Krise hervorzugehen, kannst du innehalten und nachspüren, was die Geschehnisse mit dir und deinem Unternehmen gemacht haben.
Frage dich:
Was ist es, das ich jetzt verstanden habe?
Was hat sich als wirklich wichtig herausgestellt?
Was habe ich über mich und andere Menschen gelernt?
Welche Privilegien haben sich in der Krise offenbart?
Haben sich meine Werte verändert?
Haben sich meine Ziele verändert?
Alle Antworten, die du auf deine Fragen findest, sind in Ordnung.
✅ Transformation
Wenn etwas gehen muss, können wir daran festhalten oder es gehen lassen.
Deine Nische.
Deine Produkte.
Deine Website.
Deine Wunschkund*innen.
Wir können alles loslassen, was durch die Erfahrungen aus der Krise nicht mehr passt – und Platz für Neues machen.
💡 Tipp zum Schluss: Notgroschen tut gut
Ich kann die Bedeutung eines Notgroschens für Selbstständige nicht genug betonen.
Selbst wenn in Europa Krieg herrscht – Rücklagen in Höhe von 3–6 Monatsgehältern schaffen zumindest Frieden im Hirn.
Mir persönlich tut es gut, zu arbeiten und mich ein Stück weit abzulenken.
Doch das Wissen, dass ich mir keinen Druck machen muss und einen Plan auch mal verschieben kann, hilft, nicht in Panik zu verfallen und geduldig mit mir zu sein.
Es ist in der Onlinewelt vielleicht ein ungewöhnlicher Rat, aber:
Spar dir das Geld für den drölfzigsten Onlinekurs (ich bin mir sicher, dass du eh schon genug weißt) und leg das Geld lieber beiseite, damit du im Fall der Fälle Rücklagen hast.
Social Media: Nachteile, Risiken, Gefahren
Über die Vorteile und Chancen von Social Media und Social-Media-Marketing reden viele. Doch wie ist es mit den Nachteilen, Risiken oder gar Gefahren? Darum soll es in diesem Blogartikel gehen.
Zu Beginn meiner Selbstständigkeit sah ich Social Media vor allem als Chance:
Mich lockten die kurzfristigen, schnellen Erfolge. Während ich bei meinem Blog Wochen auf neue Leser*innen warten musste, ließen die ersten Reaktionen auf meine Posts (Bots sei Dank!) nicht lange auf sich warten. Likes, Kommentare und Follower – auf Social Media eine Sache von Minuten oder gar Sekunden.
Mich faszinierte die Nähe zu potentiellen Kund*innen und die Möglichkeit, unkompliziert in Kontakt mit meiner Zielgruppe zu kommen. Einfach eine Story machen und eine Frage stellen und Boom: Ich bin um eine wichtige Erkenntnis reicher!
Auch mit ehemaligen Kund*innen blieb ich natürlich via Social Media in Kontakt. Top-of-Mind-Bewusstsein? Mit Social Media die leichteste Übung!
Heute, Jahre später, weiß ich, dass die Chancen von Social Media nur eine Seite der Medaille sind und dass soziale Medien mit einer Menge Nachteilen, Risiken oder gar Gefahren verbunden sind.
Diese Nachteile, Risiken und Gefahren waren für mich so gravierend, dass ich vor einiger Zeit beschlossen habe, keine sozialen Medien mehr für mein Marketing zu nutzen.
Und in diesem Blogartikel möchte ich dich in meine Gedankengänge mitnehmen und die wichtigsten Punkte erläutern.
Aber sei gewarnt: Das wird eine laaaaange Liste.
Inhalt
1. Wir werden abhängig von Algorithmen
2. Die Social-Media-Community gehört uns nicht
3. Soziale Medien haben einen niedrigen ROI
4. Soziale Medien machen unproduktiv
5. Soziale Medien halten uns von den wirklich wichtigen Aufgaben ab
6. Soziale Medien kosten wertvolle Lebenszeit
7. Soziale Medien sind ein Kreativitätshemmer
8. Soziale Medien machen uns zu braven Regelbefolgern
9. Soziale Medien verhindern, dass wir in den Flow kommen
#1 Wir werden abhängig von Algorithmen
Beginnen wir mit einer Tatsache, die manche Selbstständige so lange ignorieren, bis es zu spät:
Social-Media-Plattformen gehören uns nicht.
Wir sind nur Gast und müssen nach den Regeln des Gastgebers spielen, egal, wie willkürlich und sinnlos diese Regeln sein mögen.
Das eindringlichste Beispiel sind für mich Algorithmen.
Denn ob Facebook, Instagram oder TikTok – inzwischen gibt es keine Social-Media-Plattform mehr, die Inhalte chronologisch ausspielt. Entscheidend ist vielmehr eins: Relevanz für die Nutzer*innen.
Was das konkret bedeutet? Ist eine Wissenschaft für sich.
Ich, wie ich früher immer versucht habe, Algorithmen auf Instagram zu entschlüsseln.
Zudem ändert sich die Funktionsweise von Algorithmen permanent.
Anfang 2018 verkündete Facebook zum Beispiel, dass die Reichweite von FB-Seiten zugunsten privater Profile begrenzt wird. Damit war die Reichweite von FB-Seiten quasi über Nacht eingebrochen. Wer als Unternehmen auf seine Facebook-Seite setzte, um Menschen auf die Website zu bringen, musste seine Facebook-Strategie von heute auf morgen grundlegend ändern, um mithalten zu können.
Andere Beispiele für gravierende Änderungen finden wir auch in neuester Zeit: Die Foto-Sharing-App Instagram will plötzlich keine Foto-Sharing-App mehr sein, sondern setzt auf Videos. Pinterest führt ein natives Pin-Format ein und spielt statische Pins, die mit Webseiten verknüpft werden können, nicht mehr so zuverlässig aus wie früher und damit heißt es: zuverlässiger Pinterest-Traffic adé.
In den letzten Jahren habe ich verschiedene Strategien bei Selbstständigen und Einzelunternehmer*innen beobachtet, mit den Anforderungen von Algorithmen umzugehen. Die einen versuchen, den Algorithmus mit Bots, „Like Times“ oder „Engagement Pods“ zu überlisten. Die anderen verfallen in eine chronische Beschwerderitis, suchen sich das nächste „Shiny object“, zahlen für Reichweite, indem sie Ads schalten, oder resignieren.
Wenn der Insta-Post, für den ich zwei Stunden gebraucht habe, fünf Menschen erreicht.
Die meisten Selbstständigen nehmen den Algorithmus allerdings als gegeben hin und denken gar nicht weiter darüber nach, dass sie nun einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit verbringen müssen, immer up to date zu bleiben, sich kontinuierlich zur Plattform weiterzubilden, ihre Social-Media-Strategie dauernd anzupassen, niemals zur Ruhe zu kommen.
Ich war die längste Zeit meiner Selbstständigkeit in solch einem ermüdenden Social-Media-Hamsterrad gefangen. Und nachdem soziale Medien nun seit über einem Jahr keine Rolle mehr für mein Marketing spielen, kann ich dir sagen: Ich will nie wieder Hamster sein!
Was du tun kannst
Mein Vorschlag, um sich unabhängig von Algorithmen zu machen? Aussteigen aus dem Social-Media-Hamsterrad und eine maximal selbstbestimmte und entspannte Selbstständigkeit aufbauen!
Ich persönlich schwöre ja auf die Kombination von Blog und Newsletter. Doch es gibt natürlich noch jede Menge anderer Ideen für ein Marketing, das völlig ohne Social Media auskommt.
#2 Die Community gehört uns nicht
Da verbringen wir Selbstständige Monate oder gar Jahre damit, brav zu interagieren, Kommentare und private Nachrichten zu beantworten, eine Community aufzubauen und dann das:
Die Community, die wir so mühsam auf unseren Social-Media-Kanälen aufgebaut haben, gehört uns gar nicht!
Du kannst deine Instagram-Follower*innen nicht exportieren und einfach zu TikTok mitnehmen, wenn dich Insta nervt. Du bist für den Rest deiner Tage an diese Plattform und ihre Regeln gebunden. Und wenn du mal keine Lust mehr auf einen bestimmten Kanal haben solltest, verlierst du auch deine Community.
Selbst, wenn dir der Algorithmus also wohlgesinnt ist, selbst wenn du meeeega erfolgreich mit einem Social-Media-Kanal bist:
Die Community gehört dir nicht und es kann jederzeit passieren, dass
dein Account geflaggt, gesperrt oder gehackt wird
die Plattform das Zeitliche segnet – auf dem digitalen Friedhof liegen bereits MySpace, StudiVZ, Google Plus, Vine oder Vero
eine Plattform aufgrund technischer Störungen für einen Tag oder länger komplett ausfällt (ziemlich blöd, wenn du gerade im Launch bist …)
Damit ist auch deine mühsam aufgebaute Community weg.
Was du tun kannst
Gefährlich ist die Abhängigkeit vor allem dann, wenn du als Selbstständige keine eigene Website hast und dich ausschließlich auf EINEN Social-Media-Kanal verlässt. In den letzten Jahren hatte ich immer wieder Kund*innen, deren Pinterest- oder Instagram-Konto von heute auf morgen gesperrt wurden. Grundlos.
Und auch mein FB-Werbekonto konnte im Frühjahr 2021 auf einmal keine Werbeanzeigen mehr schalten. Und weder der Kontakt zu Facebook noch Beratungen durch unabhängige FB-Ads-Expert*innen konnten das Problem lösen.
Hier möchte ich nochmal den Vorteil eines Newsletters gegenüber Social-Media betonen:
Wenn mich mein Newsletter-Anbieter nervt, kann ich jederzeit meine Sachen packen, die Newsletter-Abonnent*innen exportieren und zum nächsten Anbieter wechseln. (Was ich in der Vergangenheit auch schon zweimal gemacht habe.)
Mit einer Social-Media-Community geht das nicht.
#3 Soziale Medien haben einen niedrigen ROI
Was bringt dir Social Media wirklich?
Damit meine ich nicht etwa Impressions, Likes und Follower und andere Vanity Metrics – die sind maximal für Influencer*innen spannend. Sondern Zahlen, die für uns Einzelunternehmer*innen wirklich eine Rolle spielen: Website-Besucher*innen, Newsletteranmeldungen und Kund*innen.
Wenn die These, dass wir als Selbstständige unbedingt Social Media brauchen, stimmen würde – müssten wir es dann nicht an den wirklich wichtigen Zahlen sehen?
Lass uns das mal Schritt für Schritt durchgehen
Traffic
Ein Blick in mein Analyse-Tool hat mir Anfang 2021 verraten, dass Instagram und Facebook in den letzten 12 Monaten zusammen gerade mal zwei Prozent meines Gesamttraffics ausmachten.
Kombiniert mit der Tatsache, dass ich rund 1–2 Stunden täglich (!) für Instagram verwendete, war das ein mehr als bescheidenes Ergebnis.
(Zum Vergleich: SEO sorgt bei mir aktuell für rund 40% des Traffics. Und meist brauche ich je nach Thema 10–20 Minuten pro Blogartikel dafür.)
Newsletter-Anmeldungen
Auch Newsletteranmeldungen bekam ich organisch schon lange nicht mehr durch Social Media.
Solange das Businessmodell von Facebook und Co. nämlich darin besteht, ihr Geld mit Werbeanzeigen zu verdienen, ist es auch ihr oberstes Ziel, Nutzer*innen auf Plattformen zu halten, um ihnen möglichst viele Ads zu zeigen.
Deshalb setzen Plattformen auch auf Formate, die gar nicht erst anklickbar sind (Reels, Idea Pins), oder spielen Beiträge mit Links gar nicht mehr aus (einfache Posts auf Facebook, statische Pins auf Pinterest).
Ein Social-Media-Post mit einem Hinweis aufs Freebie hat deshalb kaum eine Chance, durch die Decke zu gehen. Es sei denn natürlich, wir zahlen dafür und schalten Werbeanzeigen.
Kund*innen
Und wie ist es mit Social Media und Kund*innen? Von allen Kennzahlen ist das aus meiner Sicht die Zahl, die am schwierigsten zu messen ist. Denn natürlich ist denkbar, dass mir jemand auf Instagram folgt, all meine Posts liest und erst dadurch überhaupt motiviert ist, auf einen Link im Newsletter zu klicken und eins meiner Programme zu kaufen.
Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als ohne Social Media zu launchen und zu gucken, was passiert.
Das Ergebnis:
Seit meinem Social-Media-Ausstieg habe ich viermal gelauncht, und auch mit kaum oder komplett ohne Social-Media-Marketing habe ich jedes Mal meine Ziele erreicht oder sogar deutlich übertroffen. Deshalb weiß ich, dass Social Media bei mir keine wesentliche Rolle bei der Akquise von neuen Kund*innen spielt.
Übrigens: Wirklich überraschend ist die Erkenntnis, dass Social Media ineffektiv ist, nicht.
Denn auf Social Media erwischen wir unsere potentiellen Kund*innen in ihren unkonzentriertesten Momenten – nämlich dann, wenn sie gerade Pause von ihrer „eigentlichen“ Arbeit machen, zwischen zwei Terminen, auf dem Klo, früh morgens, spät abends, wenn sie müde oder gelangweilt und einfach nur wahllos durch den Feed scrollen und jede Sekunde einen anderen Post sehen. (Oder wir erreichen sogar nur die virtuellen Assistentinnen, an die unsere Wunschkund*innen Social-Media-Marketing ausgelagert haben.)
Unterm Strich gilt für mich (und vielleicht auch für dich) also:
Social-Media-Marketing hat einen niedrigen ROI (Return on Investment) und sorgt nicht (nennenswert) für Website-Besucher*innen, Newsletter-Anmeldungen oder Kund*innen.
Was du tun kannst
Bevor du nun in einem Anflug von Aktionismus all deine Social-Media-Profile löschst oder Social-Media-Expert*innen blind vertraust und meinen Ansatz pauschal für Blödsinn erklärst, empfehle ich dir, dir einfach selbst ein Bild von deiner individuellen Situation zu machen:
Überlege, welche Zahlen dir persönlich wichtig sind. (Websitebesucher*innen? Newsletteranmeldungen? Neue Kundschaft?)
Gucke in dein Website-Analysetool (wie Google Analytics) und überprüfe, welche Rolle deine Social-Media-Kanäle beim Erreichen deiner Ziele spielen.
Mach dir darüber hinaus auch klar, wie viel Zeit für die jeweiligen Social-Media-Kanäle täglich draufgeht und wie hoch der Return on Investment ist.
Frage Kund*innen, wie sie auf dich aufmerksam geworden sind.
Solltest du feststellen, dass du mit Social Media ständig neue Newsletteranmeldungen oder Kund*innen bekommst – good for you!
Solltest du allerdings merken, dass du zwar täglich 2–3 Stunden auf Insta abhängst, es dir aber absolut nichts bringt – kannst du überlegen, ob du die Zeit nicht sinnvoller nutzt 👉 zum Beispiel für einen eigenen Blog. Oder für einen Newsletter.
#4 Soziale Medien machen unproduktiv
Sorry für die vielleicht indiskrete Frage, aber: Hast du schon einmal bekifft gearbeitet?
Forscher der Uni London haben nämlich bereits vor 16 Jahren herausgefunden, dass ständige Unterbrechungen schädlicher für die Produktivität sind als Kiffen.
Untersucht wurden damals im Jahr 2005 zwar noch E-Mails. Inzwischen dürfte das aber natürlich auch für Social-Media-Pushbenachrichtigungen genauso gelten:
Wer seinen Posteingang geöffnet (oder analog die Pushbenachrichtigungen angeschaltet) lässt und permanent durch eingehende Mails (oder Benachrichtigungen) gestört wird, verliert rund zehn IQ-Punkte. (Zum Vergleich: Das Rauchen von Haschisch kostet „nur“ vier IQ-Punkte, eine schlaflose Nacht ebenfalls zehn IQ-Punkte.)
Diese Studie soll natürlich kein Freifahrtschein fürs Kiffen sein als vielmehr deutlich machen, dass „nur mal schnell“ die eingehenden Likes, Kommentare, DMs, Followerstand etc. zu checken keine trivialen Tätigkeiten sind, sondern der Aufmerksamkeit und Konzentration massiv schaden.
Es geht aber nicht nur um die zehn Sekunden, die ich brauche, um zu sehen, warum mein Smartphone eigentlich bimmelt – mein Gehirn braucht auch Zeit, um Aufgabe A abzuschließen und sich auf Aufgabe B einzustellen. 8 Minuten, um genau zu sein.
Das heißt dann aber auch:
Wer alle zehn Minuten sein Smartphone checkt, versucht die gesamte Arbeitszeit, das ursprüngliche Konzentrationslevel wieder zu erreichen, und kriegt nichts „Richtiges“ gebacken.
Übrigens: „Transition“ nennt Autor Brandon Burchard die Zeit zwischen zwei Aufgaben. Und er plädiert dafür, dass wir diese Phase nutzen, um eine kurze Pause einzulegen und eine Intention für die nächste Aufgabe zu setzen, um auch bei der nächsten Aufgabe fokussiert und kreativ arbeiten zu können. (Und eben nicht die Zeit mit Social Media zu verplempern.)
Pushbenachrichtigungen sind doof. Also weg damit? So einfach ist es leider nicht.
Denn wie eine Studie zeigt (und wie ich am eigenen Leib erfahren habe), führt das Abstellen der Pushbenachrichtigungen nicht automatisch zu erhöhter Produktivität, sondern erhöht im Gegenteil FOMO und sogar Ängste.
Bei mir hat das Abstellen der Pushbenachrichtigungen dafür gesorgt, dass ich mein Smartphone öfter gecheckt habe als sonst und deshalb auch nicht wirklich produktiver war.
Egal, wie man es also dreht und wendet:
Soziale Medien machen unaufmerksam, unfokussiert und unproduktiv. Entweder durch die permanenten Störungen oder durch FOMO + ausgeprägte Checkeritis.
Was du tun kannst
Ich habe jahrelang versucht, meine Social-Media-Nutzung zu reduzieren und habe, wie gesagt, eine Menge Strategien getestet. Lass dich gerne in diesem Artikel inspirieren, wisse aber:
Geholfen hat mir letzten Endes aber nur, mein Instagram-Profil und Facebook-Profil zu löschen.
#5 Soziale Medien halten uns von den wirklich wichtigen Aufgaben ab
Weißt du, was für mich immer gruseliger war als jeder Horrorfilm? Wenn der Redaktionsplan sagte, ich müsste mal wieder was auf Instagram posten, ich aber keine Ahnung hatte, was.
Vielleicht weißt du, was ich meine meine:
Shit, ich sollte mal wieder was auf Insta posten …
Ich habe aber nuuuull Ideen!
Hmmm, erstmal einmal was essen …
Vielleicht schreib ich über … Nee, doch nicht.
Kann ich das so posten oder hört sich das doof an?!
DAS HÖRT SICH DOOF AN!!!111!
Ich könnte mal wieder … meine Sockenschubladen ausmisten / einen dreistöckige Kürbistorte mit veganem Frischkäsefrosting backen / den Backofen reinigen.
Und was machte ich? Ich fotografierte meinen Schreibtisch und wünschte meinen Followern einen guten Start in ihren Arbeitstag.
„Prokrastiposting“ nennt das Carina Herrmann von „Um 180 Grad“ sehr treffend.
Denn ganz ehrlich: Diese Art von Social-Media-Marketing ist Prokrastination, weil es uns von den wirklich wichtigen Dingen ablenkt und dafür sorgt, dass wir uns ums Verkaufen drücken.
Oder hast du schon einmal gedacht:
Boah, so einen guten Morgen hat mir noch niemand gewünscht. Ich muss sie jetzt einfach für eine Beratung buchen.
Nein, die meisten Social-Media-Posts sind inzwischen zum Grundrauschen geworden, das wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen.
Und unser Arbeitstag? Dümpelt vor sich hin.
Wir halten uns mit belanglosen Social-Media-Aufgaben busy und kriegen am Ende des Tages nichts wirklich Wichtiges gebacken.
Aber dafür wissen zumindest alle auf Insta, wie aufgeräumt unser Schreibtisch ist.😉
Die Frage aller Fragen:
Bringt mich diese Aufgabe meinem Ziel (zum Beispiel: Kund*innen zu gewinnen), wirklich weiter oder prokrastiniere ich gerade das Verkaufen, weil ich es mich noch nicht traue und es insgeheim gut finde, mich drum drücken zu können?
#6 Soziale Medien kosten wertvolle Lebenszeit
Laut Statista verbrachten im Januar 2021 Menschen in Deutschland fast 1,5 Stunden täglich mit Social Media.
Durchschnittlich, wohlgemerkt.
Gerade für Selbstständige, die Social Media ja nicht nur privat, sondern auch beruflich nutzen, dürfte die Nutzungsdauer um einiges höher liegen.
Ich war seit Beginn meiner Selbstständigkeit um einen bewussten Umgang mit Social Media bemüht. Und dennoch sagte mir Instagram immer wieder, dass ich die App rund 1–2 Stunden am Tag nutzte. Dazu kamen noch Facebook, TikTok und Pinterest … Die Dunkelziffer war also hoch.
Mein typischer Arbeitstag begann jahrelang mit Social Media. Ich öffnete wahllos eine App und ließ mich erst einmal berieseln, während ich meinen Kaffee schlürfte.
Bei TikTok war meine „For You“-Page wie die Pralinenschachtel bei Forrest Gump: Ich wusste nie, was ich bekam.
Hunde, die zu Aerobic-Videos aus den 80ern tanzen.
Katzen, die ihren Besitzern das Gesicht zerkratzen.
Ein Mann, der als Voldemort verkleidet in den Supermarkt geht und fragt, ob ein bestimmtes Produkt vegan ist.
Ich lachte ein bisschen, schenkte mir Kaffee nach, wechselte zu Instagram und schwupps war die erste Stunde des Arbeitstages auch schon rum. Richtig geschafft hatte ich aber noch nichts.
Auf, auf, motivierte ich mich. Jetzt textest du aber endlich die Verkaufsseite, die du eigentlich schon vor Eeeewigkeiten fertigstellen wolltest.
Also schrieb ich ein bisschen.
Und mit „schrieb“ meine ich, dass ich zehn Wörter aneinander reihte, dazwischen Insta checkte, neun Wörter wieder löschte, dann ein paar Minuten auf ein (fast) weißes Blatt starte, zur Sicherheit noch einmal Insta checkte, bevor mich das Planungstool auf meinem Smartphone daran erinnerte, dass es auch schon wieder Zeit war, einen neuen Instapost zu veröffentlichen.
Also unterbrach ich meine Arbeit, um „nur mal schnell“ was zu posten – und blieb natürlich hängen.
Ich scrollte wahllos durch den Feed, der einfach kein Ende nahm.
Ein neuer Tipp, um schneller Videos zu erstellen.
Ein einfaches Rezept mit Kürbis.
Eine Kollegin im Urlaub am Strand.
Ui, ein Like …
Und schwupps war auch die nächste Stunde rum.
Kürzen wir das Thema ab:
Wer – so wie ich früher – zwei Stunden täglich auf Social Media abhängt, verbringt insgesamt 730 Stunden im Jahr in den sozialen Netzwerken. Das sind umgerechnet 30 Tage. Oder vier Wochen im Jahr … nur für Social Media!😱
Was du tun kannst
Gerade wenn du dich chronisch über zu „wenig Zeit“ beschwerst und aufregende berufliche Projekte (wie ein Buch schreiben oder einen Onlinekurs erstellen) immer wieder auf später verschiebst, lohnt es sich genau zu gucken, wie viel Zeit du eigentlich mit Social Media vertrödelst.
Du musst deine Profile nicht gleich löschen, sondern kannst zum Beispiel auch ein Social-Media-Sabbatical einlegen und „Getting shit done“ für eine Zeit zu deinem Motto machen.
Manchen Menschen hilft das Motto Create, Connect, Consume.
Also: Produziere zuerst etwas, verbinde dich dann mit Menschen, bevor du dich vom Feed berieseln lässt. Doch das setzt natürlich Willensstärke oder zumindest gesunde Gewohnheiten voraus.
#7 Soziale Medien sind Kreativitätshemmer
Mein größter Wunsch ist es, ein Buch zu schreiben.
Das weiß Facebook natürlich. Also zeigt es mir Werbeanzeigen von Menschen, die mir erklären wollen, wie ich ein Buch zu schreiben habe. Welche Fehler ich unbedingt vermeiden muss. Warum mein Buch niemals Erfolg haben wird.
Das Übliche also.
Ich soll diesen Blogartikel lesen.
Und mir jenes Video angucken.
Und mich zum folgenden Webinar anmelden.
Mein größter Wunsch ist es immer noch, ein Buch zu schreiben. Aber jetzt bin ich demotiviert.
Laut der Frau im Video (die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe und die mir noch nicht einmal besonders sympathisch ist) gehe ich es nämlich völlig falsch an.
Der Titel, den ich mir für mein Buch ausgesucht habe, ist nicht gut genug.
Das Cover nicht professionell genug.
Der Klappentext nicht pointiert genug.
Und vermutlich hat sie sogar Recht. Schließlich schreibe ich zum ersten Mal ein Buch.
Doch: Diese Informationen hätte ich mir in einigen Wochen auch selbst zusammengesucht, nämlich dann, wenn ich sie gebraucht hätte. Dann, wenn ich gedacht hätte: „Klappentext – wie schreib ich den denn jetzt am besten?“ Oder: „Cover – mach ich es selbst oder soll da nicht lieber gleich ein Profi ran?“
Jetzt bin ich aber in einem Stadium, in dem ich unsicher bin. Und wankelmütig.
Ein leichtes Spiel für Kritik und Menschen, die es besser wissen.
In dem Stadium, in dem ich mich befinde, hätte ich Empathie gebraucht. Cheerleader. Jemanden, die sagt: Hey, ich glaub an dich! Oder: Auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wie du das Cover des Buches gestaltest – mach weiter! Du kümmerst dich darum, wenn es soweit ist.
Doch das weiß der Algorithmus natürlich nicht.
Beziehungsweise: Der Algorithmus ist nicht empathisch. Ihm ist es völlig egal, was ich brauche und wie ich mich fühle.
Es stört ihn nicht, dass die Inhalte, die ich gezeigt bekomme, mich demotivieren. Dass ich den restlichen Tag lustlos am Schreibtisch sitzen und kein Wort mehr zu Papier bekommen werde. Dass ich denken werde: Es wird doch eh nichts mit dem Buch. Du kannst es auch gleich lassen.
Ich finde:
Algorithmen sind Kreativitätshemmer und Träumezerstörer.
Sie wurden erschaffen, um die Verweildauer von Nutzer*innen auf dem sozialen Netzwerk zu maximieren, und nicht, um uns bei unseren Zielen zu unterstützen und zu motivieren.
Einige Fragen zur Reflexion
Inspirieren dich die Menschen, denen du folgst, oder fühlst du dich demotiviert und nicht gut genug, wenn du durch deinen Feed scrollst? Gerade wenn du ein Projekt hast, das dir wirklich am Herzen liegt und das du unbedingt umsetzen willst, ist es wichtig, sich mit Menschen zu umgegeben, die dir Mut machen und dich anfeuern. Hier findest du einige konkrete Ideen, falls dir die sozialen Medien gerade nicht gut tun.
Mir haben diese Strategien allerdings nicht geholfen. Jahrelang hemmten soziale Medien meine Kreativität und nahmen mir jeglichen Spaß, Dinge einfach mal auszuprobieren – egal, wie sehr ich mich bemühte, meinen Social-Media-Konsum zu reduzieren.
Für mich ist es deshalb alles andere als ein Zufall, dass ich mein Vorhaben, ein Buch zu schreiben, erst dann abschließen konnte, nachdem ich mich nicht mehr täglich auf Social Media rumtrieb.
Und welche kreative Projekte verschiebst du auf „später“, weil dich der Social-Media-Content, den du konsumierst, chronisch entmutigt?
#8 Soziale Medien machen uns zu braven Regelbefolgern
Apropos entmutigt:
Je mehr ich auf Social Media präsent war, desto weniger war ich bereit, etwas auszuprobieren.
Testen, experimentieren, vom Expert*innenrat abweichen – für die wenigsten Selbstständigen gehört das zum Alltag.
Kein Wunder, schließlich gibt es auf Social Media ja genügend Menschen, die sagen, wie es „richtig“ geht.
Wie meine Selbstständigkeit auszusehen hat.
Welche Kanäle ich unbedingt brauche.
Wie ich Kund*innen finde.
Wie ich launche. (Oder DASS ich überhaupt launchen muss.)
Für den Beginn einer Selbstständigkeit mögen Anleitungen, Tipps, Hacks, Ideen und Blueprints hilfreich sein, doch sie kommen mit der Gefahr, dass wir die Blueprints von einigen wenigen als Gesetz und unumstößliche Wahrheit begreifen.
Dass wir Tipps blind vertrauen, obwohl sie nicht zu uns und unseren Werten passen.
Dass wir blind Anleitungen befolgen, obwohl wir es uns anders vorgestellt haben.
Dass wir auf Nummer sicher gehen, um ja nichts zu riskieren.
Doch hier ist das Ding:
Unternehmerisch denken bedeutet, rauszustechen, aufzufallen, Dinge anders zu machen, auch mal ein (kalkuliertes) Risiko eingehen.
Es bedeutet, auch mal Fehler zu machen und in Kauf zu nehmen, dass ein Plan auch mal nicht funktioniert.
Es bedeutet, Menschen einen guten Grund zu geben, gerade mit dir zusammenzuarbeiten und nicht mit all den anderen Millionen anderen Menschen, die alle dieselben Regeln befolgen und alle dasselbe denken, posten, kommentieren und tun.
Soziale Medien hatten mir aber jegliche Experimentierfreude geraubt.
Es hat mich zu diesem Karussell-Post produzierenden Zombie gemacht, weil alle meinten, dass Saves die neuen Likes sind.
(Und hätte ich mein Instagram-Konto nicht gelöscht, wäre ich jetzt wohl zum Reels produzierenden, tanzenden Zombie geworden, weil inzwischen Videos der heilige Gral sind.)
Erst als ich einige Wochen nicht mehr auf Instagram war und ich keine Ahnung hatte, was Expert*innen aktuell rieten, begann ich, in mich hineinzuhören und festzustellen,
wer ich war,
was ich wollte,
was ich nicht wollte,
was mir Spaß machte,
was ich blöd fand und
auf welche spontanen Aktionen ich Lust hatte.
All das nahm ich nicht mehr wahr, als ich Social Media nutzte.
Mein Vorschlag
Embrace die Rebellin in dir! Mache etwas anders als alle anderen. Brich eine Regel, die du doof findest. Beuge dich nicht dem Druck, etwas unbedingt machen zu müssen, wenn du keine Lust dazu hast. Geh auch mal ein (kalkuliertes) Risiko ein und probier etwas aus.
#9 Soziale Medien verhindern, dass wir in den Flow kommen
Je länger ich Social Media nutzte, desto seltener hatte ich dieses Flow-Erlebnis. Dieses Gefühl, völlig in einer Aufgabe aufzugehen, in ihr zu verschmelzen. Raum und Zeit zu vergessen.
Wer ständig unterbrochen wird oder den permanenten Drang verspürt, Follower, Likes oder Kommentare zu checken, ist nie wirklich mit ganzem Herz, Verstand und Fokus dabei, sondern unruhig, unkonzentriert und immer „auf dem Sprung“.
Zudem waren die täglichen Pflichten des Social-Media-Marketings (Posten, Liken, Kommentieren) manchmal so banal und anspruchslos, dass es schier unmöglich war, mich dafür zu motivieren.
Dabei ist „im Flow sein“ auch für Selbstständige wichtig, und zwar aus mehreren Gründen:
Regelmäßiges Flow-Erleben ist ein guter Hinweis darauf, dass uns unsere Arbeit weder über- noch unterfordert, sondern genau das richtige Maß an Herausforderung mit sich bringt und zu unseren Fähigkeiten passt.
Regelmäßiges Flow-Erleben sorgt dafür, dass wir unsere Arbeit als erfüllend und sinnvoll empfinden. Für Mihály Csikszentmihalyi, den „Erfinder“ des Flows, ist Flow sogar „das Geheimnis des Glücks“.
Regelmäßiges Flow-Erleben sorgt dafür, dass wir konzentriert an einer Sache arbeiten und herausragende Ergebnisse erzielen (👉 Buchtipp: „Deep Work“ von Cal Newport).
Ein Arbeitsleben so völlig ohne Flow könnte deshalb ein Signal für Überforderung, Unterforderung oder für Stress sein. Es könnte bedeuten, dass uns unsere Arbeit – wenn wir ganz ehrlich zu uns sind – nicht (mehr) erfüllt, dass wir keine herausragenden Leistungen erzielen und … dringend etwas ändern sollten.
Einige Fragen zur Reflexion
Erfüllen dich die Social-Media-Aufgaben, die du tagein, tagaus erledigst? Wann hast du das letzte Mal die Zeit um dich herum vergessen? Das Posten, Liken, Interagieren, Reels drehen, Storys machen … macht dich das eigentlich glücklich? Oder könntest du dir vorstellen, deine Zeit mit spannenderen Tätigkeiten zu verbringen? Etwas, was zu deinen Stärken zählt und dir wirklich Freude macht. Etwas, wozu du intrinsisch motiviert bist?
#10 Soziale Medien sind nicht nachhaltig
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist Nachhaltigkeit in meinem Marketing wichtig.
In dem Sinne, dass ich meine wertvolle Zeit nicht mit Aufgaben verbringen möchte, von denen ich weiß, dass ich sie im Grunde umsonst mache. Und die typischen Social-Media-Aufgaben? Sind unnachhaltig as hell:
etwas zu posten, was nach 24 Stunden eh niemanden mehr interessiert
nach deinen wichtigsten Hashtags suchen und gezielt die Beiträge liken
in FB-Gruppen auf Gesuche antworten und sich auf offene Stellen bewerben
die Posts von anderen kommentieren, um potentielle Kund*innen auf dich aufmerksam machen
you name it
Gerade das Kommentieren mutiert gerne mal zu einer Wissenschaft, die uns den halben Arbeitstag gefangen hält:
„Ah, hier kann ich was kommentieren.“
„Hm, was schreib ich da bloß?“
„Kann ich das wirklich so sagen?“
„Ich mach's jetzt einfach.“
„Ach, shit, ich lösch den Kommentar lieber wieder.“
„HELP!“
Abgesehen davon, dass ich mir schönere Möglichkeiten vorstellen könnte, wie ich meine Zeit verbringe – das Grundproblem ist, dass wir diese Aufgaben jeden Tag aufs Neue erledigen müssen.
Während ein Blogartikel, den du für Suchmaschinen optimierst, dir im Idealfall die nächsten Monate oder gar Jahre neue Besucher*innen auf deiner Website bringt, ist ein Post, den du heute mit einem wertvollen Kommentar versehen hast, morgen schon wieder Schnee von gestern. Außerdem gibt es 2–3 weitere Ausschreibungen in einer FB-Gruppe, auf die du dich unbedingt bewerben musst, und 20 weitere Posts, die unbedingt mit einem wertvollen Kommentar versehen werden wollen.
Und übermorgen? Geht das Spiel wieder von vorne los.
Einladung an dich
Ich schlage vor, eine gnadenlos ehrliche Bestandsaufnahme zu machen: Wie nachhaltig ist dein Social-Media-Marketing wirklich? Wie viele Aufgaben machst du jeden Tag aufs Neue, ohne dass sie zu nennenswerten Ergebnissen führen? Was zahlt sich auch auf lange Sicht für dich aus – und was nicht?
Fazit: Es gibt viele Nachteile, Risiken, Gefahren von Social Media
Du siehst: Soziale Medien haben nicht nur Vorteile und Chancen, sondern kommen auch mit Risiken, Nachteilen und Gefahren. Zehn (von unendlich vielen) habe ich in diesem Blogartikel genannt:
1. Wir werden abhängig von Algorithmen
2. Die Social-Media-Community gehört uns nicht
3. Soziale Medien haben einen niedrigen ROI
4. Soziale Medien machen unproduktiv
5. Soziale Medien halten uns von den wirklich wichtigen Aufgaben ab
6. Soziale Medien kosten wertvolle Lebenszeit
7. Soziale Medien sind ein Kreativitätshemmer
8. Soziale Medien machen uns zu braven Regelbefolgern
9. Soziale Medien verhindern, dass wir in den Flow kommen
10. Social-Media-Marketing ist nicht nachhaltig
Trotz aller Risiken, Nachteilen und Gefahren halten die meisten Selbstständigen und Einzelunternehmer*innen an Social Media fest. Sie denken: „Selbstständig ohne Social Media? Das funktioniert doch eh nicht!“
Und du?

Themenwünsche?
Wenn dir ein wichtiges Thema im Blog fehlt, sag mir gerne Bescheid. Ich freue ich mich auf deine Nachricht.