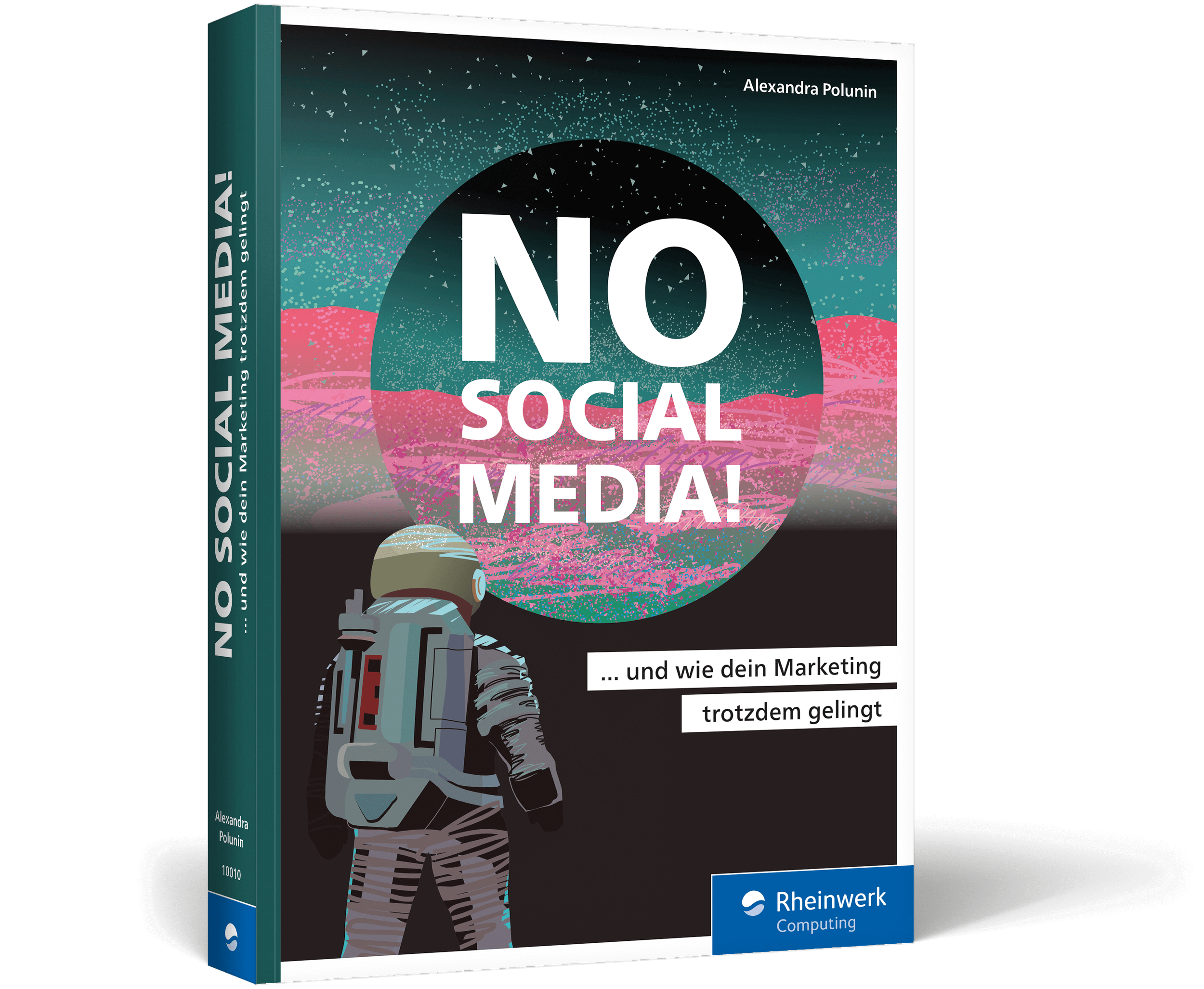Blog
Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.
Instagram Detox: 5 Gründe dafür und 5 dagegen
Ein Instagram Detox ist in aller Munde, doch ist es wirklich eine so gute Idee? Ich glaube: Es kommt darauf an. In diesem Blogartikel habe ich fünf Gründe für und fünf Gründe gegen einen Instagram Detox gesammelt.
Ein Instagram Detox ist in aller Munde, doch ist es wirklich eine so gute Idee? Ich glaube: Es kommt darauf an.
In diesem Blogartikel habe ich fünf Gründe für und fünf Gründe gegen einen Instagram Detox gesammelt.
Doch first things first:
Instagram Detox – was ist das eigentlich?
Ein Instagram Detox ist eine fest definierte Auszeit von Instagram, eine Instagram-Pause.
Dabei steckt im Wort „Detox“ das Wort „toxisch“ = giftig. Bei einem Instagram Detox „entgiften“ wir uns also von Instagram.
Wissenschaftlich lässt sich die Wirkung eines Digital Detox übrigens nicht belegen.
Instagram Detox: 5 Gründe dafür
Es gibt Fälle, da kann ein Instagram Detox tatsächlich eine gute Idee sein. Hier kommen fünf davon:
Du brauchst dringend Abstand von Instagram
Sobald du an Instagram denkst und ein Gefühl von „Ich kann grad einfach nicht mehr“ bekommst, ist es Zeit, die Reißleine zu ziehen.
Gesundheit ist das Allerwichtigste, auch im Businesskontext.
Gerade für Kreative gilt: Erschöpfte können meist nicht schöpferisch tätig sein. Als Selbstständige sind wir unsere wichtigste Ressource, und wenn es uns nicht gut geht, können wir meist auch keine gute Arbeit leisten.
Solltest du also einen Gedanken wie „Es geht nicht mehr“ haben, ist eine kurzfristige Instagram-Auszeit das einzig Richtige. Alles andere ist sekundär.
Du brauchst „richtige“ Erholung
Selbst wenn du dich auf Instagram wie ein Fisch im Wasser fühlst und deine Community abgöttisch liebst, brauchst du möglicherweise von Zeit zu Zeit eine Pause.
Schließlich hängen wir ja auch nicht jede einzelne Sekunde des Tages mit unseren Lieblingsmenschen ab, sondern nehmen uns auch Zeit für uns und andere Menschen und Interessen.
So ist es mit Instagram auch: Eine Pause ist immer eine gute Idee!
Eine Instagram-Auszeit kann eine hervorragende Möglichkeit sein, um eine Balance von online und offline oder „innen“ und „außen“ zu erreichen und langfristig bei Kräften zu bleiben.
Und wenn es dir mit Instagram grundsätzlich gut geht und du dich einfach mal „richtig“ erholen willst oder einen Spontantrip nach Paris planst, bei dem du nicht jedes Pain au Chocolat dokumentieren willst – go for it!
Du brauchst deinen Fokus für ein anderes Projekt
Instagram kann ein richtiger Zeitfresser sein.
Und wenn es ein anderes spannendes berufliches oder privates Projekt gibt, das all deine Zeit, deine Energie und deinen Fokus benötigt, kann es eine gute Idee sein, für ein paar Wochen (oder gar Monate) auf Instagram zu verzichten und ein „Sabbatical“ einzulegen.
Zum Beispiel wenn du ein Buch schreibst, einen Podcast startest, in Babypause gehst oder, oder, oder.
Wenn du sagst „Es gibt gerade Wichtigeres als Instagram, und zwar …“, kann ein Instagram Detox eine gute Sache sein.
Du bist neugierig, wie es dir ohne Instagram geht
Ich hätte von mir nie gedacht, dass ich ein Problem mit Zucker hätte. Doch als ich mir mal für drei Monate vorgenommen hatte, keinen Gramm Zucker zu essen, habe ich erst einmal verstanden, dass Zucker nahezu überall ist!
Ein spannendes Experiment, das mir jede Menge Aha-Erlebnisse beschert hat und einen nachhaltigen Einfluss auf meine Ernährung hatte.
Vielleicht geht es dir auch so oder so ähnlich mit Instagram.
Vielleicht bist du einfach neugierig, wie (d)ein Leben ohne Instagram aussehen könnte. Was fängst du mit der freigewordenen Zeit an? Was passiert mit deinen Kontakten?
Der Ausgang dieses Expertiments? Komplett offen. Und vielleicht liegt darin ja auch der Reiz.
Die Basis für eine gesunde Instagram-Nutzung stimmt
Bis auf den letzten Punkt („Du bist neugierig, wie es dir ohne Instagram geht“) haben die Gründe gemeinsam, dass die Basis für eine gesunde Instagram-Nutzung stimmt.
Wenn Instagram für dich grundsätzlich eine gute Zeit bedeutet, wenn dich die Plattform anderen Menschen näher bringt und du keinerlei oder kaum negative Auswirkungen auf deine (mentale) Gesundheit spürst, ist ein Instagram Detox eine gute Möglichkeit, mal eine Pause von Instagram einzulegen.
Sei es, weil gerade andere Projekte oder Lebensereignisse wichtiger sind oder weil du ein paar Tage oder Wochen zur „richtigen“ Erholung mit möglichst viel Offline und möglichst wenig Online brauchst.
Instagram Detox: 5 Gründe dagegen
Wenn die Basis für eine gesunde Instagram-Nutzung allerdings nicht stimmt, wird ein Instagram Detox meist nicht viel bringen bzw. die Situation ggf. noch verschärfen.
Das könnte zum Beispiel in folgenden Fällen der Fall sein:
Deine (mentale) Gesundheit leidet grundsätzlich unter Instagram
Wenn es kein konkreter Anlass ist, der dir Instagram madig macht, sondern du merkst, dass Instagram grundsätzlich einen negativen Einfluss auf deine (mentale) Gesundheit hat, stellt sich die Frage, was ein Instagram Detox in solch einem Fall überhaupt bringen würde.
Die Funktionsweise von Instagram zielt direkt auf unsere Psyche: Jeder Like, jeder Kommentar, jeder Share sorgt dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird.
Kurzfristig empfinden wir das als Belohnung, doch langfristig als Belastung:
Wir wollen immer mehr Likes, Kommentare, Shares und damit Dopamin. Und sogenannte Attention Engineers designen die App bewusst so, dass sie uns maximal „hooked“ macht. Selbst die kurze Pause, wenn wir unseren Feed neu laden, erfüllt einen Zweck. (Vorfreude steigern!)
Doch es muss nicht immer gleich eine Instagram-Sucht sein:
Für viele Menschen stellt Instagram eine Reizüberflutung dar, die über längere Zeit dafür sorgt, dass sie sich erschöpft und gestresst fühlen. Sie empfinden Instagram oft als zu viel, zu schnell und zu laut.
Auch Depressionen, Ängste und Burnout werden in Studien immer wieder mit Instagram in Verbindung gebracht.
Wenn Instagram diesen Effekt auf deine Gesundheit hat, ändert sich das vermutlich nicht, wenn du ein paar Tage der Plattform fernbleibst.
Ähnlich sieht es für mich aus, wenn dein Selbstwert unter Instagram leidet.
Wenn dich die kuratierten Highlights von Fremden im Internet nicht inspirieren, sondern lähmen, unter Druck setzen und stressen, ist das ein grundsätzliches Problem.
Wenn die Vergleicheritis kickt, sobald du die App öffnest, und du dich als chronisch nicht gut genug fühlst (Imposter Syndrom!), werden ein paar Tage Instagram Detox vermutlich nicht so viel daran ändern.
Ja, die Likes sind ein kleiner, netter Ego-Boost, doch auch sie können langfristig dafür sorgen, dass unser Selbstwert abhängig von diesen äußeren Faktoren wird und dass er einstürzt, sobald sich äußere Bedingungen ändern und die Likes mal ausbleiben.
Auch hier hilft nicht ein Instagram Detox, sondern der Aufbau eines Selbstwertes, der nicht an äußere Faktoren wie Likes geknüpft ist. Und das wiederum gelingt vermutlich besser ohne Instagram.
Du hangelst dich von Instagram Detox zu Instagram Detox
Die Betonung liegt hierbei auf dem Wort „hangeln“. Wenn deine Gesundheit und dein Selbstwert unter Instagram Schaden nehmen und der Leidensdruck hoch ist, stellt sich die Frage, ob es wirklich ein Instagram Detox ist, den du brauchst, oder nicht vielmehr ein Leben völlig ohne Instagram?
Gerade wenn du schon mehrere Instagram-Detox-Versuche hinter dir hast und bereits wenige Tage später merkst, dass die alten ungesunden Gewohnheiten schneller wieder da sind, als du „Instagram Detox“ sagen kannst, wird sich das Problem mit Instagram vermutlich nicht mit einem erneuten Detox lösen lassen, sondern mit einer anderen Strategie wie
Instagram an eine virtuelle Assistenz auslagern oder
dein Instagram-Konto vollständig löschen
Vielleicht brauchst du nicht den 13. Instagram Detox dieses Jahr als vielmehr eine Instagram-Exit-Strategie? (In diesem Fall: Lass uns gerne miteinander sprechen!)
Dir geht es ohne Instagram deutlich besser
Wenn du schon mehrere Instagram-Detox-Versuche hinter dir hast und jedes Mal merkst „Mir geht es ohne Instagram so viel besser!“, stellt sich ebenfalls die Frage, was dir ein Instagram Detox genau bringen soll.
Jeder Instagram Detox neigt sich irgendwann mal dem Ende zu. Und wenn dein Alltag ohne Instagram schöner ist als mit, stellt sich die Frage, warum du dann überhaupt noch zu Instagram zurückgehst.
Warum begibst du dich freiwillig immer wieder an einen Ort, der dir so offensichtlich nicht gut tut?
Genau das stört mich am Konzept „Instagram Detox“, „Social Media Detox“ oder „Digital Detox“:
Schon im Begriff „Detox“ steckt das Wort „Gift“ drin und damit die Erkenntnis, dass wir uns Tag für Tag freiwillig einem „Gift“ aussetzen.
Warum sollten wir das tun?
Instagram ist nicht mit deinen Werten vereinbar
Doch nicht nur die Gesundheit, auch deine Werte können ein Grund dafür sein, warum nicht ein Instagram Detox, sondern ein Instagram-Ausstieg angebracht wäre.
Wenn das Geschäftsmodell hinter Instagram, das Mikrotargeting oder die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Menschen mit deinen Unternehmenswerten in Konflikt stehen, ist das ein grundsätzliches Problem und kein Problem, das sich mit einer Instagram-Pause lösen lässt.
Dann bringt es nichts, sich von Zeit zu Zeit von Instagram zu entgiften, sondern eher, sich zu fragen, wie Marketing aussehen müsste, damit es mit den Unternehmenswerten in Einklang ist.
Instagram-Marketing passt nicht zu deinen Stärken
Und schließlich bringt ein Instagram Detox nichts, wenn Instagram einfach nicht zu deinen Stärken passt.
Wenn du täglich auf Instagram präsent bist und dich stets redlich bemühst, obwohl das, was Instagram da von dir verlangt, überhaupt nicht zu deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeit und Interessen passt, wirst du den Grundkonflikt nicht lösen, indem du für ein paar Tage der Plattform fernbleibst.
Stattdessen steht eine Entscheidung an: Soll sich dein Marketing an deinen Stärken orientieren?
Wenn ja, bringt es vermutlich nichts, sich täglich zu Storys und Reels zu zwingen. Sinnvoller wäre es, Marketingstrategien zu nutzen, die besser zu deinen Stärken passen.
Fazit: Ein Instagram Detox ist nicht immer eine gute Idee
Ein Instagram Detox ist hip, doch er ist nicht immer eine sinnvolle Sache.
Entscheidend ist zu verstehen, ob du nur eine kurzfristige Pause von Instagram benötigst oder ein grundsätzliches Problem mit Instagram besteht.
Fünf Gründe, die für einen Instagram Detox sprechen, sind:
Du brauchst dringend Abstand von Instagram.
Du brauchst richtige Erholung.
Du brauchst deinen Fokus für ein anderes Projekt.
Du bist neugierig, wie es dir ohne Instagram geht.
Die Basis für eine gesunde Instagram-Nutzung stimmt.
Fünf Gründe, die gegen einen Instagram Detox sprechen, sind:
Deine (mentale) Gesundheit leidet grundsätzlich unter Instagram.
Du hangelst dich von Instagram Detox zu Instagram Detox.
Dir geht es ohne Instagram deutlich besser.
Instagram ist nicht mit deinen Werten vereinbar.
Instagram-Marketing passt nicht zu deinen Stärken.
Es liegt nun an dir zu entscheiden, was bei dir und Instagram der Fall ist.
Weiterlesen
Instagram löschen – ja oder nein? Ich helfe dir, dich zu entscheiden
Instagram löschen: Meine Erfahrung mit einem Instagram-Ausstieg als Selbstständige
Instagram vs. Realität: Wie sieht eine Selbstständigkeit ohne rosaroten Instagram-Filter aus?
Instagram-Konto löschen oder deaktivieren: Link + einfache Anleitung
Instagram löschen – ja oder nein?
Instagram löschen – soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein? Wenn dir diese Frage bekannt vorkommt, weil du sie dir täglich und dreimal an Ostern stellst, welcome to this Blogartikel! Schnapp dir Stift und Papier oder öffne ein digitales Dokument und lass die Entscheidungsfindung – für oder gegen Instagram – beginnen!
Instagram löschen – soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein?
Wenn dir diese Frage bekannt vorkommt, weil du sie dir täglich und dreimal an Ostern stellst, welcome to this Blogartikel!
Hier ist nicht der Ort, an dem ich dir sagen werde: Mach es!
Vielmehr möchte ich dir mit meinen ausgewählten Fragen dabei helfen, eine eigene Pro- und Kontra-Liste zu erstellen.
Schnapp dir also Stift und Papier oder öffne ein digitales Dokument und lass die Entscheidungsfindung – für oder gegen Instagram – beginnen!
Instagram löschen: Ja
Was spricht dafür, deinen Instagram-Account zu löschen? Aus meiner Sicht sind es vor allem diese Punkte hier:
#1 Instagram bringt dir keine Ergebnisse
Stell dir vor, du mühst dich Tag für Tag mit Instagram ab, doch es bringt dir keine oder kaum Ergebnisse.
Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich stellte fest: Ich brauche jeden Tag etwa 1–2 Stunden fürs Instagram-Marketing, doch die Resultate waren eher bescheiden:
Die wenigsten Menschen, die meine Website besuchten, kamen von Instagram (weniger als 5%).
Die wenigsten Menschen, die mit mir zusammenarbeiteten, wurden auf Instagram auf mich aufmerksam. Anfragen, Aufträge und Verkäufe kamen eher durch Newsletter, mein Netzwerk und Empfehlungen zustande.
Nun hätte ich natürlich sagen können (und habe es jahrelang getan): „Dann muss ich mich halt noch mehr zu Instagram-Marketing weiterbilden!“
Doch ich hatte einfach keine Lust auf diese ewige Weiterbildungsspirale, die entsteht, wenn man mit den Veränderungen und Trends einer Social-Media-Plattform mithalten will.
Du auch nicht? Dann mache nun einen dicken, fetten Strich auf der Pro-Seite deiner „Instagram löschen – ja oder nein?“-Pro-und-Kontra-Liste!
#2 Instagram ist ein Hamsterrad für dich
Was uns auch schon zum nächsten Punkt bringt: Du empfindest Instagram als ein Hamsterrad. Es ist anstrengend für dich, es stresst dich und bereitet dir Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte.
Wie lange willst du dich in diesem Instagram-Hamsterrad noch abstrampeln? Und wo soll das Ganze enden?
Wenn du keine Antwort auf diese Frage findest, machst du am besten einen weiteren Strich auf der Pro-Seite.
#3 Instagram ist schlecht für deine (mentale) Gesundheit
Oft genug endet Instagram in einem Burnout, einer Depression oder einer anderen (psychischen) Erkrankung.
Das muss nicht so sein, kann es aber.
Und deshalb ist es zentral, sich zu beobachten und gnadenlos ehrlich zu sich zu sein:
Hat Instagram einen negativen Effekt auf meine (mentale) Gesundheit?
Wenn die Antwort hier „ja“ lautet und bisherige Versuche, Social Media achtsam zu nutzen oder einen Social Media Detox einzulegen, nichts gebracht haben, hilft meist nur, Instagram zu verlassen – für immer.
#4 Instagram hat negative Auswirkungen auf deinen Körper
Marketing hat nicht nur mit Strategien und Zahlen zu tun, sondern auch viel mit unserem Körper.
Denn auch wenn KI-Anwendungen boomen: Letzten Endes müssen immer noch Menschen aus Fleisch Blut Marketing betreiben und verantworten.
Deshalb lohnt es sich, dich mal auf deinen Körper zu fokussieren und dich zu fragen:
Was passiert mit meinem Körper, wenn ich an Instagram (oder eine Instagram-Aufgabe) denke?
Wird er eng, hart, verkrampft? Schlägt das Herz schnell(er)? Knotet sich alles im Bauch zusammen?
Wenn hier die Antwort „ja“ ist, ist die Gefahr groß, dass Instagram Stress für deinen Körper bedeutet. Möchtest du deinen Körper jeden Tag aufs Neue diesem Stress aussetzen?
#5 Instagram macht dich unproduktiv
Es spricht natürlich nichts dagegen, dann und wann seine Zeit mit Instagram zu verdaddeln.
Doch wenn wir uns jeden Tag dabei erwischen, wie wir auf Instagram doomscrollen, statt unsere Aufgaben zu erledigen, sollten wir uns fragen, ob uns Instagram nicht von den wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben abhält.
Dabei geht es mir gar nicht darum, Produktivität als Wert hochzuhalten oder zu sagen, dass das Wichtigste im Berufsleben ist, dass wir effektiv und effizient arbeiten.
Auch ich bin großen Fan von Pausen, Auszeiten, unverplanter Arbeitszeit, sich mal treiben zu lassen oder auch mal Zeit mit seichten, südkoreanischen Serien zu verdaddeln.
Doch Instagram ist meist mehr als das: Es ist oft eine ständige Ablenkung, Störung und Prokrastination.
Wer alle zehn Minuten sein Smartphone checkt, weil eine neue Pushbenachrichtigung aufgeploppt ist, verbringt seine Arbeitszeit mehr damit, wieder zu seiner eigentlichen Aufgabe zurückzufinden und Konzentration aufzubauen, als zu arbeiten. Deep Work oder gar ein Flow sind so nicht möglich.
Wie wollen wir so auf Dauer gute Arbeit leisten?
#6 Instagram passt nicht zu deinen Stärken
Stell dir vor, du verbringst jeden Tag zwei Stunden damit, Videos zu drehen, in Reels zu tanzen und Bilder zu bearbeiten. Zwei Stunden am Tag sind 730 Stunden im Jahr, und da es so viel Zeit ist, muss die Frage erlaubt sein:
Gehört das, was Instagram von mir jeden Tag aufs Neue verlangt, eigentlich zu meinen Stärken?
Wenn die Antwort „nein“ lautet, hilft ein Reality-Check:
Du kannst natürlich grundsätzlich auch neue Dinge lernen und neue Fähigkeiten entwickeln. Doch wenn das, was du jeden Tag auf Instagram machst, dir einfach nicht liegt, verbringst du eine Menge Zeit damit, an deinen Schwächen rumzudoktern.
In dieser Zeit könntest du auch die sensationellen Stärken nutzen, die du bereits hast, und richtig, richtig gut in dem werden, was dir liegt!
Wenn du zum Beispiel – so wie ich – merkst, dass Schreiben zu deinen Kernfähigkeiten gehört, und deshalb Schreiben deine Marketingstrategie sein soll, kannst du statt auf Instagram dich lieber auf einen Blog oder Newsletter fokussieren.
Klingt das nicht gleich so viel entspannter (und effektiver!), als sich mit seinen Schwächen zu beschäftigen und mit viel Glück maximal semigut zu werden?
#7 Instagram passt nicht zu deinen Werten
Wenn du Unternehmenswerte definiert hast und über die Entwicklungen der Social-Media-Plattformen im Bilde bist, stellst du möglicherweise fest:
Instagram passt nicht zu meinen Werten.
Möglicherweise findest du Metas Geschäftsmodell mit den Daten (Daten werden ohne Zustimmung gesammelt und an Werbetreibende weiterverkauft) problematisch. Oder du kannst es nicht mit deinem Gewissen vereinbaren, deine Kundinnen und Kunden auf eine Plattform zu lenken, die vielen Menschen erwiesenermaßen nicht gut tut.
Was auch immer es bei dir ist: Ein Wertekonflikt ist ein legitimer Grund, sich von einer Plattform zu verabschieden und mehr Integrität ins Marketing und Berufsleben zu holen.
Es geht nicht immer um Wachstum und Reichweite – ethische Prinzipien und Übereinstimmung mit deinen Werten sind genauso wichtige Kriterien, um die Eignung einer Plattform fürs eigene Marketing zu beurteilen.
#8 Dein Bauchgefühl
Die Entscheidung für oder gegen Instagram ist keine reine Verstandentscheidung, sondern kann natürlich auch dein Bauchgefühl einschließen.
Vielleicht hast du bei den Punkten bisher mit dem Kopf geschüttelt, dennoch sagt irgendwas in dir drin: Instagram ist keine so gute Idee.
Mein Rat lautet da: Nimm diese Stimme ernst, selbst wenn sie etwas diffus ist oder dir noch die Worte fehlen für das, was mit dir auf Instagram passiert.
Natürlich ist die Aufzählung oben nicht vollständig und es gibt jede Menge weitere Punkte, die ich an dieser Stelle hätte erwähnen können.
No Social Media – und wie dein Marketing trotzdem gelingt
Wenn du noch tiefer in das Thema „Social Media – ja oder nein“ einsteigen willst: In meinem Buch „No Social Media“ findest du noch Futter für deine Pro- und Kontra-Liste.
Instagram löschen: Nein
Jetzt haben wir viele Gründe, die für eine Löschung des Instagram-Accounts sprechen, gesammelt. Was spricht nun dagegen, Instagram zu löschen?
Drehen wir den Spieß doch einfach mal um.
#1 Instagram bringt dir Ergebnisse
Wenn du etwas postest, eine Story oder ein Reel erstellst, kommst du mit Menschen ins Gespräch. Interessierte fragen nach deinen Angeboten oder Kennenlerngesprächen.
Und wenn du deine Kundschaft fragst „Wie bist du auf mich aufmerksam geworden?“, sagen Menschen immer wieder: „Auf Instagram.“
Ist das bei dir der Fall?
Wenn Instagram für dich und dein Marketing funktioniert – was auch immer dieses Wort für dich persönlich bedeuten mag –, ist das ein valides Argument, Instagram weiterhin zu behalten.
Das gibt einen dicken, fetten Strich auf der „Nein“-Seite der „Instagram löschen – ja oder nein?“-Pro-und-Kontra-Liste.
#2 Instagram macht Spaß
Instagram ein Hamsterrad?
Wenn du gar nicht weißt, was ich damit meinen könnte, weil Instagram für dich überwiegend Spaß, Freude und eine gute Zeit bedeutet, spricht natürlich vieles dafür, Instagram weiterhin zu behalten.
#3 Instagram hat keine Auswirkung auf deine (mentale) Gesundheit
Wenn du merkst, dass Instagram keine oder kaum Auswirkungen auf deine (mentale) Gesundheit hat, ist das ein gutes Zeichen.
Wenn du immun gegenüber der inszenierten Bilder bist und dich die sorgfältig kuratierten Highlights von Bekannten, Freundinnen und Fremden nicht in eine Vergleichsspirale bringen …
Wenn dein Selbstwert von den schlanken, schönen und erfolgreichen Menschen auf Instagram unberührt bleibt …
Wenn dein Schlaf wegen Instagram nicht leidet und du nicht nachts wach liegst, weil du Argumente für eine hitzige Diskussion mit Fremden im Internet sammelst …
… dann ist die Notwendigkeit, dein Instagram-Konto zu löschen, womöglich nicht so stark gegeben wie bei Menschen, die an Instagram leiden oder gar Symptome einer Depression oder eines Burnouts entwickeln.
#4 Instagram hat keine negative Auswirkungen auf deinen Körper
Ähnliches gilt, wenn Instagram keine negativen Auswirkungen auf deinen Körper hat. Wenn du weiterhin entspannt bleibst, selbst wenn du eine Stunde auf Instagram abgehangen hast, wirst du vermutlich kein großes Problem mit Instagram spüren.
Und natürlich musst du in solch einem Fall dein Instagram-Konto auch nicht unbedingt löschen, wenn du nicht willst.
#5 Instagram hat keine Auswirkungen auf deine Produktivität
Kannst du dich trotz Instagram immer noch gut konzentrieren und fokussieren? Halten sich Doomscrollen und Prokrastination in Grenzen? Erledigst du immer noch die Dinge, die erledigt werden müssen?
Dann kann es sein, dass deine Instagram-Nutzung keine Auswirkung auf deine Produktivität hat und dass du Instagram in einem für dich vernünftigen Rahmen nutzt.
Wenn du für dich eine gute Balance aus Instagram und Arbeit gefunden hast und wichtige Aufgaben nicht chronisch auf „später“ verschiebst, muss Instagram auch nicht zwingend gelöscht werden.
#6 Instagram passt zu deinen Stärken
Selfies machen, Grafiken erstellen, Videos drehen, in Reels tanzen – fühlst du dich bei den Anforderungen, die Instagram an die Creator stellt, wie ein Fisch im Wasser? Passt der Fokus aufs Visuelle zu deinen Stärken?
Wunderbar! Dann bist du und Instagram ein guter Match. Und dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, Instagram weiterhin in deinem Leben und Marketing zu behalten.
#7 Instagram passt zu deinen Werten
Ähnlich sieht es für mich aus, wenn Instagram nicht mit deinen Werten in Konflikt steht, also wenn du sagst:
„Alles, was mir wichtig ist, kann ich auf / mit Instagram umsetzen. Und Metas Geschäftsmodell mag zwar nicht unproblematisch sein, aber hält mich jetzt nicht nachts wach …“
Wenn du hier kein Konfliktpotenzial siehst, spricht aus meiner Sicht vieles dafür, Instagram weiterhin zu behalten und zu bespielen.
#8 Dein Bauchgefühl
Die besten Argumente nützen nichts, wenn du dein Bauchgefühl ignorierst. Wenn du also – trotz aller Argumente – in deinem Bauch eine Stimme findest, die sagt
„Passt schon.“
„Ist zwar manchmal nervig, aber alles in allem okay.“
„Meist ist es doch ganz lustig hier.“
glaub ihr ruhig.
Ist es sinnvoll, Instagram zu löschen?
Diese Frage kannst aus meiner Sicht nur du beantworten!
Statt dich auf pauschale Ratschläge von Marketingcoaches zu verlassen, empfehle ich dir, dir selbst ein Bild davon zu machen, welche Rolle Instagram privat und beruflich in deinem Leben spielt.
Bringt Instagram Ergebnisse – ja oder nein?
Ist Instagram ein Hamsterrad für dich – ja oder nein?
Hat Instagram negative Auswirkungen auf deine (mentale) Gesundheit – ja oder nein?
Hat Instagram negative Auswirkungen auf deinen Körper – ja oder nein?
Hat Instagram negative Auswirkungen auf deine Produktivität – ja oder nein?
Passt Instagram zu deinen Stärken – ja oder nein?
Passt Instagram zu deinen Werten – ja oder nein?
Was sagt dein Bauchgefühl?
Erstelle mit diesen Fragen deine eigene Pro- und Kontra-Liste und fälle deine persönliche Entscheidung!😊
Auch interessant:
Die besten Instagram-Alternativen 2025
Du hast beschlossen, dich von Instagram zu verabschieden oder sogar dein Instagram-Konto zu löschen? Herzlichen Glückwunsch!
Doch was jetzt? Wie kannst du auch ohne Instagram deine Bilder teilen, Marketing betreiben und neue Menschen erreichen?
Darum soll es in diesem Blogartikel gehen.
Ich stelle dir Alternativen zu Instagram vor – sowohl Social-Media-ähnliche Bildernetzwerke als auch Social-Media-freie Möglichkeiten am Schluss.
Inhalt
Instagram light: Welche Bildernetzwerk-Alternativen gibt es zu Instagram?
Social-Media-frei: Instagram-Alternativen ohne Social Media
Warum braucht es überhaupt Instagram-Alternativen?
Bevor wir uns den vielen verschiedenen Instagram-Alternativen zuwenden, sollten wir noch mal über die drei wichtigsten Gründe sprechen, Instagram zu verlassen und sich Alternativen zu suchen.
#1 Instagram kann einen negativen Effekt auf die mentale Gesundheit haben
Auch wenn sich ein Kausalverhältnis in Studien nicht sauber nachweisen lässt, lässt sich zumindest eine Korrelation zwischen einer (erhöhten) Instagram-Nutzung auf der einen Seite und Depressionen, Angst- und Essstörungen uvm. auf der anderen Seite feststellen.
Auch kann es sein, dass das ständige Vergleichen mit anderen Menschen auf Instagram – der Influencerin mit dem durchtrainierten Körper, dem Kollegen, der mehr Umsatz macht, der Freundin, die immer gut drauf ist und der scheinbar alles mühelos gelingt – mit der Zeit am Selbstwert kratzt und man sich nach der Instagram-Nutzung schlechter fühlt als vorher.
Es heißt also nicht, dass Instagram zwingend depressiv macht. Es heißt lediglich, dass eine Instagram-Nutzung und eine Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit oft Hand in Hand gehen.
Jede*r sollte deshalb für sich prüfen, welchen Effekt Instagram auf die mentale Gesundheit hat.
Und wenn das Ergebnis der Prüfung ist, dass Instagram eine Herausforderung für die mentale Gesundheit darstellt, ist es völlig legitim, Instagram zu verlassen und sich nach Alternativen umzuschauen.
#2 Instagram kann nicht zu den eigenen Werten passen
Instagram gehört zu dem Unternehmen Meta, das unter anderem auch Facebook betreibt. Und das Geschäftsmodell, das sowohl Instagram als auch Facebook zugrunde liegt, ist das Geschäft mit den Daten:
Bei der Nutzung von Instagram (oder Facebook) fallen Daten an. Meta sammelt, analysiert, kategorisiert und speichert diese Daten, um sie dann an Werbetreibende zu verkaufen. Diese nutzen diese Daten wiederum zum sogenannten Mikrotargeting, also um ihrer Zielgruppe passgenaue Werbeanzeigen auszuspielen.
Dieses Geschäftsmodell ist nicht nur ethisch bedenklich, rechtlich nicht mit der DSGVO vereinbar, sondern wurde in letzter Zeit immer häufiger auch zur Wahlbeeinflussung eingesetzt und stellt damit eine Bedrohung für demokratische Werte dar.
Wer sagt „Instagram ist nicht mit meinen Werten vereinbar“, muss das Geschäftsmodell der Meta-Plattformen natürlich nicht zwingend weiterhin unterstützen, sondern kann auch Instagram verlassen und auf Alternativen setzen.
#3 Instagram kann ein Zeitfresser sein
Früher habe ich ein bis zwei Stunden auf Instagram verbracht – täglich. Klingt vielleicht nicht viel, doch in der Woche sind das schon 7 bis 14 Stunden, im Monat 30 bis 60 Stunden und im Jahr 365 bis 730 Stunden.
Und bei diesen hohen Zahlen muss die Frage erlaubt sein: Ist das wirklich gut investierte Zeit?
Ich kann die Frage jetzt natürlich nicht für dich beantworten.
Für mich habe ich aber erkannt, dass die Zeit nicht gut investiert war:
Ich habe Instagram genutzt, um wirklich wichtige Dinge zu prokrastinieren, und auch wenn ich durchaus mit Menschen auf der Plattform in Kontakt gekommen bin, hatte Instagram einen bescheidenen Return on Investment für mich. Die wenigsten Menschen, die meine Website fanden oder mit mir zusammenarbeiteten, kamen tatsächlich von Instagram. Der Aufwand, den Instagram von mir forderte, stand nicht im Verhältnis zum Nutzen, den ich durch Instagram-Marketing bekam.
Ist es bei dir ähnlich? Du könntest jetzt natürlich sagen:
„Dann muss ich mich halt fortbilden und Instagram-Marketing lernen!“
Du könntest aber auch sagen:
„Instagram bringt mir nichts und hält mich von schöneren Dingen im Leben ab. Deshalb such’ ich mir eine Alternative!“
Und das ist absolut legitim, finde ich.
No Social Media! – Mein Buch im Rheinwerk Verlag
Noch mehr gute Gründe, die gegen Instagram und andere Social-Media-Kanäle sprechen, habe ich in meinem Buch „No Social Media!“ gesammelt.
Welche Bildernetzwerk-Alternativen gibt es zu Instagram?
Wenn wir über Instagram-Alternativen reden, denkt man natürlich zuerst an alternative Bildernetzwerke und damit Möglichkeiten, seine Bilder zu teilen. Vor allem, wenn das Visuelle eine große Rolle bei deinem Beruf spielt.
Hier sind einige Alternativen:
Als ehemalige Pinterest-Beraterin ist Pinterest natürlich die erste Alternative, die mir zu Instagram einfällt.
(Quelle)
Pinterest ist ein Mix aus sozialem Netzwerk und einer Suchmaschine, und Nutzer*innen können dort sowohl spannende Ideen zu den verschiedensten Themen finden als auch eigene Inhalte posten, indem sie sogenannte Pins erstellen.
Gerade im Bereich Fotografie, Food, Design, Mode, Reisen (also überall, wo es schöne Bilder gibt) ist Pinterest eine naheliegende Alternative zu Instagram.
tumblr
tumblr ist ein soziales Netzwerk, auf dem Bilder, Zitate, Links, Videos usw. geteilt werden können.
(Quelle)
2019 hatte tumblr fast ein Drittel seiner User verloren, nachdem sexuelle Inhalte verboten wurden.
Inzwischen ist es eher zu einer Nischenplattform geworden, die vor allem junge Menschen nutzen, um sich zum Beispiel über Fandoms auszutauschen.
Für eine private Nutzung könnte die Mikrobloggingplattform ggf. eine Alternative sein, als Marketingkanal taugt tumblr aber nicht.
flickr
flickr ist ein klassisches Bildernetzwerk. Hier können eigene Fotos oder kurze Videos hochgeladen und mit anderen Menschen geteilt werden.
Auch können die auf flickr hochgeladenen Fotos bewertet oder kommentiert werden.
(Quelle)
Seit 2019 ist flickr nicht mehr kostenlos und kostet knapp 50 Dollar im Jahr. Bei der kostenlosen Version können bis zu 1000 Bilder und Videos gespeichert werden.
Weitere Alternativen zu Instagram sind:
der Bildermarktplatz EyeEm (ausgesprochen: „I am“)
die Social-Media-Plattformen Plattformen TikTok, Snapchat, Facebook, LinkedIn oder Reddit
die Unterhaltungsplattform 9GAG
für Kunst oder Fotografie vor allem Behance, Dribble oder DeviantArt
Bildbearbeitungstools wie Snapseed oder VSCO
Open-Source-Alternativen wie Mastodon (vor allem, wenn du eine datenschutzfreundliche Alternative zu Instagram suchst)
Instagram-Alternativen ohne Social Media
Sucht man online nach „Instagram-Alternativen“, fällt auf, dass es meist andere soziale Netzwerke sind, die empfohlen werden.
„Du willst nicht mehr auf Instagram sein? Dann geh doch zu Pinterest!“, heißt es oft.
Das ist sicherlich richtig. Nur weil es mit einer Social-Media-Plattform nicht passt, muss es nicht zwingend bedeuten, dass die anderen Social-Media-Plattformen ebenfalls keine gute Idee sind. Vielleicht fühlt sich jemand, dem Instagram nicht liegt, auf Pinterest wie ein Fisch im Wasser?
Möglich.
Und dennoch möchte ich an dieser Stelle auch über Instagram-Alternativen sprechen, die völlig ohne soziale Medien auskommen.
Gerade Selbstständige und Onlineunternehmer*innen, bei denen das Visuelle keine entscheidende Rolle spielt – ich denke da zum Beispiel an textende, lektorierende, beratende, coachende Menschen –, brauchen ja nicht zwingend ein weiteres Bildernetzwerk, sondern einfach nur eine alternative Möglichkeit, um Menschen online zu erreichen.
Und die gibt es – zuhauf!
Website
Alles beginnt bei mir immer mit der Website. Die Website ist die „Homebase“, der Ort, den wir angeben, wenn uns jemand fragt:
„Und wo kann ich dich online finden?“
Natürlich könnten wir auch antworten: auf Instagram. Nur gehört uns Instagram leider nicht, und so kann es jederzeit passieren, dass unser Account gehackt, gesperrt oder gelöscht wird.
Bei einer Website kann das theoretisch auch passieren, kommt bei Selbstständigen und Einzelunternehmer*innen in der Praxis aber viel seltener vor.
Auch können wir auf unserer Website die Regeln selbst bestimmen: Was wir wann wie und warum posten, wird nicht mehr von Algorithmen vorgegeben, sondern von uns. Die Website ist die Homebase, in die Mark Zuckerberg nicht reinredet.
Blog
Auf der Mikrobloggingplattform Instagram darf eine Bildbeschreibung maximal 2200 Zeichen betragen. Gerade wer hier an seine Grenzen kommt, wird mit einem Blog vermutlich glücklicher.
Hier gibt es keine Zeichenbegrenzung, und Texte können so kurz oder lang sein wie gewünscht. Und natürlich können wir auch auf dem Blog unsere Texte mit Bildern oder Videos ergänzen (müssen es aber nicht).
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Auch online gefunden zu werden klappt ganz ohne Instagram.
Die Kombination aus Website und Blog ist vor allem dann mächtig, wenn wir unsere Website-Inhalte für Suchmaschinen wie Google optimieren.
Selbst mit dem Aufkommen von KI gilt: Solange Menschen googeln, können wir unsere Website-Inhalte so aufbereiten, dass sie als relevante Suchergebnisse ganz weit oben angezeigt werden.
Das ist entspannter als Instagram und nachhaltiger ist es auch:
Denn wenn ein Blogartikel erst einmal rankt, bleibt er meist oben und bringt noch die nächsten Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre neue Menschen auf unsere Website.
Newsletter
Wer Marketing ohne Instagram betreibt, kommt meiner Erfahrung nach in den seltensten Fällen ohne Newsletter aus.
Wenn eine Website deine Homebase ist, ist ein Newsletter deine Fanbase – ohne Social Media.
Hier kannst du dich – so wie auf Instagram – regelmäßig melden, Informationen teilen oder persönliche Geschichten erzählen. Du kannst einmal im Monat einen Newsletter schreiben oder zweimal die Woche. Du entscheidest.
Solange du den Anmeldeprozess transparent gestaltest, ist aus meiner Sicht (fast) alles möglich.
Podcast
Und wenn du nicht gerne schreibst? Dann könnte ein Podcast eine gute Alternative zu Instagram sein.
Hier kannst du über dein Thema sprechen und so deine Expertise und Vertrauen aufbauen. Fast genauso wie mit Instagram, nur in Audio. Perfekt, wenn mensch eh nie Bock auf Fotos und Videos hatte.
Fazit: Es gibt eine Menge Instagram-Alternativen!
Es gibt eine Menge Gründe, Instagram zu verlassen und – neben anderen Bildernetzwerken – mindestens genauso viele gute Instagram-Alternativen, die völlig ohne Social Media auskommen, allen voran:
Website
Blog
SEO
Newsletter
Podcast
Ähnliche Artikel
Instagram löschen – ja oder nein? Ich helfe dir, dich zu entscheiden
Instagram löschen: Meine Erfahrung mit einem Instagram-Ausstieg als Selbstständige
Instagram vs. Realität: Wie sieht eine Selbstständigkeit ohne rosaroten Instagram-Filter aus?
Instagram-Konto löschen oder deaktivieren: Link + einfache Anleitung
Social Media Detox? Bringt nichts!
Wenn soziale Medien einen negativen Einfluss auf unsere (mentale) Gesundheit haben – uns überfordern, überreizen oder stressen –, suchen viele Menschen eine schnelle Lösung und legen einen Social Media Detox ein. In diesem Blogartikel möchte ich mich kritisch mit dem Thema „Social Media Detox“ auseinandersetzen und dir verraten, warum ich persönlich kein großer Fan dieser Methode bin.
Wenn soziale Medien einen negativen Einfluss auf unsere (mentale) Gesundheit haben – uns überfordern, überreizen oder stressen –, suchen viele Menschen eine schnelle Lösung und legen einen Social Media Detox ein.
Einerseits ist das verständlich. Oft ist der Leidensdruck so groß, dass man am liebsten vorgestern schon eine Lösung dafür hätte. Andererseits ist ein Detox meist nicht die Lösung für die Probleme, die Social Media mit sich bringen.
In diesem Blogartikel möchte ich mich kritisch mit dem Thema „Social Media Detox“ auseinandersetzen und dir verraten, warum ich persönlich kein großer Fan dieser Methode bin.
Aber jetzt noch mal Schritt für Schritt und der Reihe nach:
Was ist ein Social Media Detox überhaupt?
Während bei einem Digital Detox Menschen auf sämtliche digitalen Geräte und Anwendungen verzichten, geht es bei einem Social Media Detox darum, für einen bestimmten Zeitraum keine sozialen Medien mehr zu nutzen.
Facebook.
Instagram.
TikTok.
X (ehemals Twitter).
Pinterest.
LinkedIn.
All diese Plattformen (und noch viele mehr) können Gegenstand eines Social Media Detox werden.
Wie funktioniert ein Social Media Detox? Die Methoden
Manche sagen: „Ich nutze eine Woche lang keine sozialen Medien mehr.“ Andere nehmen sich vor, für einen Monat (oder noch länger) auf Social Media zu verzichten. Wiederum andere fokussieren sich auf eine einzige Social-Media-Plattform und legen beispielsweise „nur“ einen Instagram Detox ein.
In dieser Zeit sind die Menschen nicht auf Social Media aktiv: Sie posten nichts und konsumieren nichts. Sie loggen sich nicht mehr in ihre Accounts ein und streichen soziale Medien für diese Zeit völlig aus ihrem Leben.
Oft deinstallieren sie ihre Social-Media-Apps vom Smartphone, um nicht „in Versuchung“ zu kommen, doch noch mal nachzuschauen, was es Neues gibt.
Gerade wer soziale Medien beruflich nutzt, sagt vorab gerne seinen Followern Bescheid, dass für einen bestimmten Zeitraum kein neuer Content kommt und man nicht auf Anfragen und Nachrichten reagieren wird. So kommt man nicht in die Situation, dass Menschen auf eine Antwort oder Reaktion unnötig warten und dann möglicherweise enttäuscht sind.
Inzwischen gibt es auch Social Media Detox Apps, die bei der Entgiftung helfen können, oder sogar kostenpflichtige Social Media Detox Retreats, bei denen man sich mit anderen Menschen zusammenschließt, um sich gemeinsam von sozialen Medien zu „entgiften“.
Welche Social-Media-Detox-Methode geeignet ist, darf jede*r für sich selbst entscheiden. Auch Fragen nach der „richtigen“ Dauer (7 Tage, 14 Tage, 30 Tage oder noch länger) oder dem „richtigen“ Zeitpunkt brauchen individuelle Antworten.
Welche Vorteile hat ein Social Media Detox?
Viele Menschen haben inzwischen einen Social Media Detox gemacht. Und wenn man die zahlreichen Erfahrungsberichte im Netz liest, scheint ein Social Media Detox – auf den ersten Blick – viele Vorteile zu haben:
Menschen berichten, dass der Drang, Instagram zu öffnen, nach ein paar Tagen nachlässt, und sie sich weniger fremdbestimmt fühlen.
Da man nun nicht mehr alle paar Minuten seine Likes und Kommentare checkt, wird die Aufmerksamkeit nicht mehr fragmentiert. Die Folge: Konzentration und Produktivität steigen.
Beziehungen verbessern sich, weil man nun weniger am Smartphone ist und mehr mit Menschen redet, die einem gegenüber sitzen.
Das Vergleichen mit Fremden im Internet wird reduziert. Wir fühlen uns (wieder) wohler mit uns und unserem Körper.
Wie sinnvoll ist ein Social Media Detox wirklich? (Meine Argumente dagegen)
Klingt toll, was gäbe es da an einem Social Media Detox überhaupt auszusetzen? Ich habe die fünf wichtigsten Argumente gegen einen Social Media Detox zusammengetragen:
#1 Das Gewohnheitsargument
Auch ich habe früher, als ich noch auf Social Media war, oft einen Social Media Detox gemacht. Oder sollte ich lieber sagen: Mich von Social Media Detox zu Social Media Detox gehangelt?
Denn genau das ist der erste Nachteil eines Social Media Detox: Der Effekt ist kurzfristig.
Das liegt daran, wie Gewohnheiten funktionieren. Sie haben einen Auslöser (z.B. Ich habe eine Aufgabe beendet.) und ein mit dem Auslöser verbundenes Verhalten (z.B. Ich öffne eine Social-Media-App.). Wenn wir das Verhalten an den Tag legen, wird unser Belohnungszentrum aktiviert und Dopamin ausgeschüttet. Wir fühlen uns gut (Ein Like!) und legen das Verhalten auch das nächste Mal an den Tag.
Bis sich Gewohnheiten ändern, kann es aber bis zu drei Monate dauern. Deshalb wird ein Social Media Detox von 7, 14 oder 30 Tagen meist nichts bringen. Unsere ungesunden Social-Media-Gewohnheiten sind immer noch in uns, wir haben sie nicht grundlegend verändert.
Und wenn wir dann nach 7, 14 oder 30 Tagen zu Social Media zurückgehen, sind die alten Gewohnheiten meist auch wieder da. Wir können uns vielleicht noch ein paar Tage disziplinieren, doch spätestens nach ein paar Wochen geht es uns wieder nicht gut und wir denken schon über den nächsten Social Media Detox nach.
Ein Teufelskreis. Und vor allem: Wie lange soll das so weitergehen?
#2 Das Giftargument
In diesem Zusammenhang stellt sich noch eine weitere Frage:
Wenn soziale Medien so schädlich sind, dass wir sie sogar als „Gift“ bezeichnen – schließlich heißt „Detox“ so viel wie „entgiften –, warum setzen wir uns dann die übrige Zeit überhaupt diesem Gift aus?
Das wäre so, als würden wir an 351 Tagen im Jahr jeden Tag 200g Zucker (oder 2 Flaschen Wein) zu uns nehmen und es aber okay finden, weil wir ja zweimal im Jahr für 7 Tage fasten.
Es stimmt zwar schon, dass die insgesamt 14 Tage Fastenzeit im Jahr dem Körper dann gut tun und positive Effekte haben. Doch relevanter ist, dass wir die meisten Tage im Jahr unseren Körper Giften aussetzen, die ihn schädigen. Da fällt die Fastenzeit dann kaum mehr ins Gewicht.
Auch finde ich es spannend, wie wir Social Media in Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen diskutieren:
Da ist uns allen klar, dass sie negative Auswirkungen auf die Gehirne junger Menschen haben können und wir junge Menschen vor dem oft schädlichen Einfluss sozialer Medien schützen wollen. So weit, so gut. Doch warum schützen wir unsere Kinder, aber uns nicht?
#3 Das Wissenschaftsargument
Und was sagt die Wissenschaft zum Thema „Entgiften“ bzw. Social Media Detox?
Der Begriff „Detox“ kommt ursprünglich aus der Ernährung und bezeichnet eine „Entgiftung“.
Die Annahme: Durch ungesunde Gewohnheiten sammeln sich in unserem Körper schädliche Stoffe (sogenannte „Schlacken“) an, von denen wir uns regelmäßig „reinigen“ müssen.
Tatsächlich ist eine positive Wirkung von Entgiftungskuren wissenschaftlich nicht nachzuweisen, sodass aktuell nicht unbedingt ein „Detox“ als vielmehr eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, viel Bewegung und Schlaf empfohlen wird.
So ist es mit einem „Social Media Detox“ auch: Klar können wir uns täglich in digitalen Räumen aufhalten, die uns nicht guttun, und uns, wenn es gar nicht mehr geht, „entgiften“. Doch wissenschaftlich belegen lässt sich die Wirksamkeit einer solchen Entgiftungskur nicht.
Eine systematische Evaluation von 21 Studien zu Digital Detox kam 2021 sogar zu dem Ergebnis, dass Digital Detox oft keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung von Symptomen bringt. Manche Studien kamen auch zu gemischten Ergebnissen. (Quelle)
Vor allem FOMO (Fear of Missing Out) ist eine häufige „Nebenwirkung“ eines Social Media Detox.
Und: Die Rückfallquote ist bei einem Digital Detox meist hoch. In der bitkom-Studie aus dem Jahr 2022 kam heraus, dass die Hälfte derjenigen, die einen Digital Detox einlegen, bereits nach wenigen Stunden wieder aufgaben. (Quelle)
Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie, sieht die Forschung zum Digital Detox insgesamt eher kritisch. Zum einen, weil die Definition oft unklar ist. („Was ist ein Digital Detox oder Social Media Detox überhaupt? Was beinhaltet er genau und was nicht?“) Und zum anderen, weil sich bei nicht selbst auferlegten Einschränkungen von vornherein ein negatives Gefühl einstellt und sich Studien somit nicht gut durchführen lassen. (Quelle)
#4 Das Verantwortungsargument
Und schließlich das Verantwortungsargument. Die Diskurse rund um einen Social Media Detox kreisen immer um das Individuum und die Frage, wie ein Individuum mit den Herausforderungen sozialer Medien umgehen kann.
Natürlich ist diese Frage nicht unwichtig, doch damit tritt eine viel wichtigere Frage in den Hintergrund, nämlich:
Wer ist überhaupt dafür verantwortlich, dass es Social-Media-Usern gut geht?
Wer über Social Media Detox schreibt oder Digital Detox Retreats anbietet, stellt stillschweigend voraus, dass das Individuum verantwortlich ist. Mit den richtigen Strategien, so die Annahme, können wir gesunde Gewohnheiten bei unserer Social-Media-Nutzung etablieren, z.B. indem wir uns in Achtsamkeit üben oder uns von Zeit zu Zeit entgiften.
Ich teile diese Annahme nicht, denn ich denke, dass die Betreiber sozialer Medien dafür verantwortlich sind, sichere Räume für die Menschen zu schaffen, die ihre Social-Media-Plattform nutzen.
Oder anders gesagt:
👉 Warum dürfen Betreiber ihre Social-Media-Plattformen so gestalten, dass sie Menschen schaden? Und warum werden diese Menschen dann alleine gelassen und sind auf einmal selbst dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht? 👈
Für mich ist das nur schwer nachzuvollziehen.
#5 Das Anlagenargument
Das heißt aber auch: Wir können uns noch so viel um Achtsamkeit bemühen, wir können noch so viel atmen, meditieren oder uns „entgiften“: Der Fakt, dass soziale Medien in ihrer Anlage problematisch sind, bleibt:
Algorithmen spielen emotionalisierende Inhalte bevorzugt aus und werden uns somit immer (!) Inhalte zeigen, von denen sie „denken“, dass sie uns zu einer Reaktion bewegen können.
Durch Mikrotargeting werden wir Werbeanzeigen sehen, die perfekt auf uns zugeschnitten sind und uns somit immer zum unnötigen Konsumieren verleiten.
Soziale Medien setzen immer unbezahlte Arbeit von unserer Seite voraus: unbezahlte Contentarbeit, unbezahlte Emotionsarbeit, unbezahlte ästhetische Arbeit, unbezahlte Arbeit an sich selbst (Selbstoptimierung), unbezahlten Mental Load.
Soziale Medien werden von Attention Engineers so designt, damit sie möglichst viel Dopamin ausschütten und uns dazu verleiten, uns länger dort aufzuhalten, als uns lieb ist.
Wir können natürlich Tag für Tag gegen diese Mechanismen ankämpfen, aber es wird vermutlich nicht allen Menschen gleich gut gelingen. (Mir zum Beispiel ist es nicht gelungen.)
Und was ist eine Alternative zu einem Social Media Detox?
Ein Social Media Detox mag kurzfristig etwas Abhilfe schaffen, doch langfristig werden die Probleme mit Social Media ja nicht gelöst, die problematischen Strukturen bleiben.
Wer merkt, dass soziale Medien nicht gut tun und die Mechanismen (Algorithmen, Mikrotargeting, unbezahlte Arbeit, Dopamin) die mentale Gesundheit belasten, ist aus meiner Sicht besser damit beraten, das Thema gleich langfristig zu lösen. Wie? Das kann für jede*n etwas anderes sein.
Manche lagern ihr Social-Media-Marketing aus und können, wenn sie das Glück haben, eine passende virtuelle Assistenz zu finden, das Thema Social Media zu einem großen Teil aus ihrem Kopf bekommen.
Andere sehen keinen anderen Weg, als sich von Social Media vollständig zu verabschieden und andere Marketingwege zu gehen. Man muss ja auch nicht gleich alle Social-Media-Kanäle löschen, sondern kann vielleicht mit dem starten, der am meisten belastet.
Sich Onlineräume zu suchen, die einem prinzipiell gut tun (oder zumindest: nicht schlecht), ist langfristig die beste Option.
Dann braucht es auch keinen Social Media Detox mehr und man hat mehr Zeit und Energie für die schönen Dinge im Leben.
Instagram-Entzug: 6 Tipps, damit du es schaffst ✌️
Hast du schon mal versucht, deinen Instagram-Account stillzulegen, zu deaktivieren oder gar vollständig zu löschen? So ein Instagram-„Entzug“ hat es ganz schön in sich, und deshalb möchte ich mir in diesem Blogartikel angucken, wie du ihn dieses Mal wirklich meisterst.
Hast du schon mal versucht, deinen Instagram-Account stillzulegen, zu deaktivieren oder gar vollständig zu löschen?
Oder tut dir Instagram nicht gut und du hast dir vorgenommen, einen Social Media Detox einzulegen und ein paar Tage weniger Instagram zu nutzen?
Was auch immer der Grund dafür sein mag, dass du für kurz oder lang auf Instagram verzichten willst – vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass die ersten Tage ohne Instagram eine große Herausforderung sein können.
Die Hand greift wie von selbst nach dem Smartphone und öffnet die Instagram-App …
Du ertappst dich zum zwölften mal am Tag dabei, wie du ein Foto für eine Instagram-Story schießt …
Oder du kannst an nichts anderes denken, als daran, was du gerade auf Instagram verpasst und wie sich Menschen ohne dich amüsieren und worüber sie reden …
So ein Instagram-„Entzug“ hat es ganz schön in sich, und deshalb möchte ich mir in diesem Blogartikel angucken, wie du ihn dieses Mal wirklich meisterst.
Doch halt: Können wir wirklich von Instagram-„Entzug“ sprechen?
Macht Instagram süchtig?
Wer von einem „Entzug“ spricht, meint damit stillschweigend mit, dass Instagram eine Sucht ist. Denn nur wenn wir süchtig nach etwas sind, machen wir einen Entzug durch. Doch ist das bei Instagram wirklich der Fall?
Meine Beobachtung ist, dass das Wort „Sucht“ recht schnell mit Social Media und insbesondere Instagram in Zusammenhang gebracht wird.
Sobald Instagram unseren Alltag bestimmt und wir uns schwer damit tun, unsere Gewohnheiten zu ändern, sagen wir schnell: „Ich bin süchtig nach Instagram!“, „Ich kann mir ein Leben ohne Social Media einfach nicht mehr vorstellen!“ oder „Ich brauche Instagram wie die Luft zum Atmen!“
Wie kommt es dazu?
Die Rolle von Dopamin
Wenn die Instagram-App geöffnet wird und wir neue Likes, Kommentare oder DMs sehen, wird Dopamin ausgeschüttet. Das fühlt sich für uns wie eine Belohnung an und wir wollen mehr davon. Deshalb halten wir uns immer mehr auf Instagram auf. Oder wir posten nur nach das, von dem wir (glauben zu) wissen, dass es uns neue Likes bescheren wird.
Diesen Mechanismus finden wir nicht nur bei Instagram, sondern auch bei anderen Social-Media-Plattformen, bei E-Mails, Netflix, beim Live-Ticker einer Nachrichtenplattform oder Onlineshopping.
Der Psychologe und einer der bekanntesten Behavioristen B.F. Skinner hat das Phänomen bereits in den 30er-Jahren in der später nach ihm benannten Skinner-Box untersucht. Die Skinner-Box war ein Käfig, in dem Skinner Ratten dazu brachte, einen Hebel zu drücken, wenn sie bestimmte Reize sahen oder hörten.
Skinner sprach von einer operanten Konditionierung: Gewünschtes Verhalten wird durch Belohnung verstärkt und – etwas weniger verlässlich – unerwünschtes Verhalten durch Bestrafung unterdrückt.
Auf Social Media wird der Skinner-Box noch eins draufgesetzt. Denn nun gibt es die sogenannten Attention Engineers – „Aufmerksamkeitsingenieure“, deren alleinige Aufgabe es ist, Social-Media-Apps so zu designen, dass möglichst viel Dopamin ausgeschüttet wird und wir sie infolgedessen möglichst lange nutzen.
In den letzten Jahren hat Dopamin ein schlechtes Image bekommen, und es gibt inzwischen nicht wenige Menschen, die Dopamin „fasten“, indem sie auf möglichst viele Dinge verzichten, die für eine Dopaminausschüttung sorgen.
Tatsächlich ist Dopamin aber nicht per se schlecht, denn Dopamin ist zunächst einmal ein zentraler Botenstoff des Körpers, der für Antrieb, Motivation, Kreativität, Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen und mentale Gesundheit wichtig ist.
Lernen ohne Dopamin würde zum Beispiel gar nicht so richtig funktionieren. Und auch evolutionär betrachtet, hat Dopamin das Überleben gesichert, denn es wurde vor allem bei (kalorienreicher) Nahrung, sozialer Nähe und – erneut – Lernen ausgeschüttet. Ein Zuwenig Dopamin ist deshalb ähnlich doof wie ein Zuviel.
Das Problem ist also nicht, dass durch Instagram Dopamin ausgeschüttet wird – das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, in der von allen Seiten um unsere Aufmerksamkeit gekämpft und sich die operante Konditionierung zu Nutze gemacht wird.
Blöde Gewohnheit oder Instagram-Sucht?
Es ist also erst einmal eine „normale“ Reaktion unseres Körpers auf einen Botenstoff, wenn wir Instagram gut finden und davon „nicht loskommen“.
Problematisch wird es dann, wenn unser Instagram-Verhalten einen großen Leidensdruck in unserem Leben erzeugt und sämtliche Lebensbereiche Instagram untergeordnet werden.
Deshalb müssen wir an dieser Stelle gut unterscheiden:
Eine blöde Instagram-Gewohnheit lässt sich aus eigener Kraft ändern, z.B. mit dem Inhalt aus diesem Blogartikel.
Bei einer „richtigen“ Instagram-Sucht lässt sich das Verhalten nicht (mehr) aus eigener Kraft ändern. Es wird professionelle Unterstützung von ausgebildeten medizinischen Fachpersonal benötigt. Und Bücher oder Blogartikel (so wie dieser hier) sind wirkungslos bis schädlich.
Deshalb solltest du dir unbedingt klarmachen, zu welcher der beiden Gruppen du mit deiner Instagram-Nutzung gehörst. (Das kann ich aus der Ferne natürlich nicht einschätzen. Und einen laienhaften „Instagram-Sucht-Test“ wirst du an dieser Stelle auch nicht finden.)
Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, sprich bitte unbedingt mit deinem Hausarzt und lass dir helfen.
Instagram-Sucht: Studien
Inzwischen gibt es einige Studien, die das Thema Social-Medie-Sucht empirisch untersuchen.
So kam eine Untersuchung von DAK-Gesundheit und Deutschem Zentrum für Suchtfragen zu dem Ergebnis, dass 2,6 Prozent aller 12- bis 17-Jährigen die Kriterien für eine Abhängigkeit nach der sogenannten „Social Media Disorder Scale“ erfüllen. (Quelle)
Doch tatsächlich ist die Lage nicht so eindeutig. Niklas Ihssen, ein Psychologie-Professor an der Durham University in Großbritannien, betont, dass Studien meist widersprüchliche Ergebnisse aufweisen, und rät dazu, Social-Media-Gewohnheiten nicht vorschnell zu pathologisieren. (Quelle)
Fazit: Instagram kann süchtig machen, muss es aber nicht. Empirisch lässt es sich zumindest nicht immer eindeutig belegen.
Wie kommt man wieder weg von Instagram?
Sucht hin oder her – viele kennen sicherlich das Gefühl, dass Instagram einfach nicht gut tut und die psychische Gesundheit belastet. Und natürlich ist dann der Wunsch, Instagram zu verlassen, verständlich. Doch wie gelingt das?
Hier kommen fünf erprobte Tipps:
#1 Gewohnheiten verstehen
Wenn man weiß, wie Gewohnheiten „funktionieren“, ist das – in der Theorie zumindest – nicht besonders kompliziert:
Auslöser: Jede Gewohnheit beginnt mit einem Auslöser, z.B.: Ich habe eine Aufgabe beendet.
Verhalten: Mit dem Auslöser ist ein bestimmtes Verhalten verknüpft, z.B.: Ich öffne die Instagram-App.
Belohnung: Ich scrolle durch den Feed, bekomme neue Nachrichten und Likes – dadurch wird Dopamin ausgeschüttet.
Wer eine neue Gewohnheit etablieren will, muss den Auslöser mit einem neuen Verhalten verknüpfen, das ebenfalls als Belohnung empfunden wird. Gucken wir uns das im Fall von Instagram an:
Auslöser: Ich habe eine Aufgabe beendet.
Neues Verhalten: Ich lasse das Smartphone links liegen und hol mir stattdessen ein Glas Wasser, das ich langsam trinke, während ich am offenen Fenster stehe und ein paar tiefe Atemzüge mache. Oder: Ich mache fünf Sonnengrüße. Oder: Ich setze mich ans Klavier und übe fünf Minuten ein neues Stück. Oder: Ich schnappe mir den Hund und lauf einmal um den Block.
Belohnung: Da mir das neue Verhalten wirklich guttut (Wasser, frische Luft, Bewegung, Kreativität etc.), empfinde ich das neue Verhalten bald ebenfalls als Belohnung.
Etwas Geduld: Nach ein paar Wochen stellt sich ein neuer Automatismus ein: Ich beende eine Aufgabe und denke gar nicht daran, mir das Smartphone zu nehmen, sondern lege, ohne großartig darüber nachzudenken, das neue Verhalten an den Tag. (Oder sogar: Ich freue mich bereits auf den kurzen Spaziergang so wie ich mich früher darauf gefreut habe, auf Instagram abzuhängen.)
#2 Langfristig denken
Bis alte Gewohnheiten verschwinden und neue etabliert werden, dauert es ein paar Wochen. Wie viel genau – darüber ist sich die Forschung uneins. Von 28 bis 66 Tagen ist alles dabei.
Das heißt: Der Anfang kann hart sein. Und bis es uns wirklich leichtfällt, nicht mehr an Instagram zu denken und die Hände nicht automatisch zum Smartphone greifen, können bis zu drei Monate vergehen.
Deshalb ist es wichtig, den Instagram-Ausstieg langfristig zu denken und nicht schon nach zehn Tagen wieder aufzugeben.
#3 Leerlauf und Pausen aktiv gestalten
Gerade Leerlauf, Zwischenzeiten und drohende Langeweile sind meiner Erfahrung nach kritisch, wenn es um „Rückfälle“ geht. Doch gerade sie lassen sich mit ein bisschen Planung und aktiver Pausengestaltung gut in den Griff kriegen.
Es gibt eine Menge Ideen für Pausen, die völlig ohne Smartphone auskommen.
Statt also den Instagram-Ausstieg einfach auf dich zukommen zu lassen, kannst du bereits im Vorfeld überlegen, wie du Pausen von nun an ohne Instagram verbringen willst. Mit Essen, Trinken, einem Spaziergang, Sport oder mit Musik?
Und vielleicht kannst du dir für die ersten Wochen ohne Instagram sogar ein paar Termine mehr einplanen, sodass du gut beschäftigt bist?
Der erste Schritt ist, die ersten vier bis sechs Wochen zu überstehen. Danach wird es meist einfacher.
#4 Eine starke Motivation finden
Warum willst du Instagram verlassen? Meine Erfahrung ist: Wenn du dir die Gründe bewusst machst, ist es einfacher, am Ball zu bleiben, wenn es mal schwierig wird.
Weil es dir ohne Instagram psychisch besser geht?
Weil du dich wohler in deinem Körper fühlst?
Weil du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast?
Weil deine Beziehungen ohne Instagram schöner sind als mit?
Weil du dich wichtigen beruflichen Projekten widmen kannst?
Notier dir deinen Grund, rahm ihn ein, häng ihn auf. Lass dich jeden Tag daran erinnern.
#5 Gleichgesinnte finden
Natürlich kannst du einen Instagram-Ausstieg auch alleine durchziehen. Habe ich 2020/21 ja auch gemacht. Doch du musst es nicht, wenn du nicht willst.
Es ist ein bisschen so wie mit Sport: Manche Menschen machen das lieber alleine und sind motiviert genug, um sich früh morgens, während alle anderen schlafen, die Joggingschuhe anzuziehen und mit einer Stirnlampe um den Neckar zu laufen.
Andere sind nicht so diszipliniert, sondern brauchen andere Menschen, mit denen sie sich verabreden und austauschen können.
Beides ist natürlich absolut fein.
Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, kann es aber hilfreich sein, sich Menschen zu suchen, die dasselbe vorhaben wie du: Instagram verlassen.
Und schließlich:
#6 Alternativen zu Instagram suchen
Wer sich vor dem Instagram-Ausstieg überlegt, wie auch ohne Instagram Kontakte gehalten oder Marketing betrieben werden kann, ist auf der sicheren Seite.
Und dann ist man nicht plötzlich überrascht, sondern kann sich von Anfang an auf die Alternativen zu Instagram fokussieren. Beim Marketing wären das zum Beispiel:
Kann uns ein Social-Media-Detox helfen?
Statt einer nachhaltigen Veränderung der Gewohnheiten oder einer völligen Instagram-Abstinenz versuchen es viele Menschen zuerst mit einem Social-Media-Detox: Sie verzichten für ein paar Tage (oder länger) auf das „Gift“ Instagram und „entgiften“ sich, indem sie Instagram für eine vordefinierte Zeit nicht nutzen.
Kann das helfen? Aus meiner Sicht nur bedingt, und zwar aus folgendem Grund:
Wer eine schädliche Gewohnheit hat, kann sich gerne ein paar Tage „zusammenreißen“ und die Orte meiden, die diese Gewohnheit begünstigen. Doch sobald man die Orte wieder regulär aufsucht, sind meist auch die schädlichen Gewohnheiten wieder da.
Ein Social-Media-Detox kann damit eine erste sinnvolle Maßnahme sein, wenn Instagram und Co. so sehr überfordern, dass man weder ein noch aus weiß. Doch eine nachhaltige Lösung ist das nicht.
Auch gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass ein Digital Detox wirklich funktioniert. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Effekt maximal kurzfristig ist, und Metastudien, die keine Effekte feststellen.
Deshalb gilt: Soll sich nachhaltig etwas mit Instagram ändern, müssen wir an die Gewohnheiten ran! Erst, wenn wir unsere Gewohnheiten nachhaltig verändern, ist der Effekt langfristig spürbar.
In diesem Artikel nehme ich den Social Media Detox noch genauer unter die Lupe.
tl;dr
Auch wenn in Kombination mit Social Media oft etwas vorschnell von „Sucht“ gesprochen wird, ist die erste Zeit ohne Instagram definitiv eine Herausforderung, die sich wie ein „Entzug“ anfühlen kann (aber nicht muss).
Was hilft, ist:
Verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren, und einen Auslöser mit einer neuen Gewohnheit verknüpfen
Zeit einplanen: Es dauert ein bis drei Monate, bis neue Gewohnheiten etabliert sind.
Rückfälle vermeiden, indem Pausen und Leerlauf aktiv gestaltet werden
Persönlichen Grund für den Instagram-Ausstieg finden – und sich täglich daran erinnern
Gleichgesinnte finden, denn schwierige Schritte sind manchmal einfacher, wenn man sie mit anderen Menschen geht
Alternativen zu Instagram suchen – und sie mit genau derselben Ernsthaftigkeit betreiben wie Instagram
Vielleicht interessiert dich auch das:
Instagram löschen – ja oder nein? Ich helfe dir, dich zu entscheiden
Instagram löschen: Meine Erfahrung mit einem Instagram-Ausstieg als Selbstständige
Instagram vs. Realität: Wie sieht eine Selbstständigkeit ohne rosaroten Instagram-Filter aus?
Instagram-Konto löschen oder deaktivieren: Link + einfache Anleitung
Instagram löschen: Meine Erfahrung mit einem Instagram-Ausstieg als Selbstständige
In diesem Blogartikel berichte ich, wie mein eigener Instagram-Ausstieg abgelaufen ist: Wie ich den Instagram-Abschied gestaltet habe. Wie der Instagram-Entzug für mich war. (Ich verrate dir, wie es mir jeweils nach einer Woche, einem Monat und einem Jahr ging.) Was ich mit meinem Instagram-Konto gemacht habe. Wie es jetzt für mich ist, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten.
In diesem Blogartikel berichte ich, wie mein eigener Instagram-Ausstieg abgelaufen ist:
Wie der Instagram-Entzug für mich war. (Ich verrate dir, wie es mir jeweils nach einer Woche, einem Monat und einem Jahr ging.)
Wie es jetzt für mich ist, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten.
Und schließlich: Gehe ich wieder zu Instagram zurück?
Irish Goodbye: Warum ich kein großes Tamtam um meinen Instagram-Abschied gemacht habe
Eigentlich hatte ich 2020 gar nicht direkt vor, mein Instagram-Konto zu löschen. Ich habe hin und wieder mit dem Gedanken gespielt, ja. Doch dieser Gedanke hatte für mich immer was von „Ich wandere nach Guernsey aus und züchte Alpakas“ – eine grandiose Spinnerei, mehr nicht.
Damals kannte ich niemanden – NIEMANDEN! –, der oder die keine soziale Medien fürs Marketing nutzte. Und dass es tatsächlich auch ohne ginge – das kam mir damals gar nicht in den Sinn.
Ich war einfach nur müde von der Plattform – vom Posten, Liken, Tanzen, Livegehen, Kommentieren – und ich wollte ein Päuschen einlegen, um wieder Kraft zu tanken.
Doch aus einer Woche Instagram-Pause wurden schnell zwei, dann drei. Und dann war auch schon ein Monat rum. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich merkte: Das Leben und Arbeiten ohne Instagram ist viel zu schön, um wieder zurückzugehen.
Deshalb gab es bei meinem Instagram-Ausstieg auch nie einen offiziellen Abschiedspost von mir. Oder eine Strategie, die Menschen auf Instagram auf andere Kanäle von mir aufmerksam zu machen. So still und heimlich, wie ich mir damals einen Account angelegt hatte, ging ich auch wieder.
Rückblickend hätte dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Planung gut getan. Doch andererseits: Wenn es gar nicht mehr geht, ist das Wichtigste, wieder Kraft zu tanken. Alles andere ist sekundär.
Der Instagram-Entzug: It’s f*cking real!
Auch wenn ich Instagram vor allem aus gesundheitlichen Gründen verließ, merkte ich, dass mein Hirn zunächst gar nicht damit einverstanden war …
Die erste Woche ohne Instagram
Viele Menschen, die soziale Medien verlassen, klagen über FOMO („Fear Of Missing Out“). Mich persönlich plagte die Angst, etwas zu verpassen, wenn ich nicht mehr auf Instagram bin, nicht.
Die erste Woche ohne Instagram war trotzdem hart. Zu der großen Erschöpfung, die ich damals spürte, gesellte sich der Drang, ständig nach meinem Smartphone zu greifen und Instagram zu öffnen.
Doch jedes Mal, wenn ich das Smartphone in die Hände nahm und den Bildschirm entsperrte, merkte ich: Da ist nichts. Mein Hirn war maximal irritiert und suchte sich sofort andere Beschäftigungen: Nachrichten checken zum Beispiel. Oder Onlineshopping-Apps.
Irgendwo musste doch die nächste Dopamin-Quelle sein!
Gleichzeitig fühlte ich mich erschöpft. Ich schlief so viel, wie schon lange nicht mehr. Mir kam es vor, als hätte ich die letzten Jahre mit Social Media meine Müdigkeit verdrängt: Ich hatte „Pausen“ mit Social Media gemacht, mich mit Social Media „entspannt“, die Zeit mit Social Media vertrödelt. Doch richtig erholsam war das Ganze nie und über die Jahre sammelte sich eine Menge Müdigkeit an. Dazu kamen die vielen Inhalte, Informationen und Reize – Instagram war einfach von allem zu viel!
Jetzt, wo ich mich – das erste Mal seit Jahren – endlich wieder „richtig“ erholen durfte, schlief ich und schlief und schlief …
Der erste Monat ohne Instagram
Irgendwann ließ der Drang, ständig Instagram zu öffnen, nach, doch ich hatte mir eine neue Gewohnheit gesucht: E-Mails und die Weltlage checken.🙄
Auch hier gab es:
einen Live-Ticker, der sich ständig aktualisiert
Dopamin, wenn tatsächlich eine neue Mail eintrudelt
usw.
Ich merkte: Instagram nicht mehr zu nutzen, heißt nicht automatisch, dass „alles gut ist“. Ich muss mein gesamtes Smartphone-Verhalten in den Blick nehmen.
Ich begann, meine Smartphone-Gewohnheiten zu hinterfragen – nicht, um sie zu „optimieren“, sondern weil sie mir so, wie sie waren, gesundheitlich nicht gut taten.
Ich schuf Smartphone-freie Zeiten und Räume. Nachdem ich mehrere Jahre permanently online permanently connected war, zog ich den Stecker und übte mich darin, immer öfter im Hier und Jetzt zu sein statt im World Wide Web.
Ich gestaltete meine Pausen aktiv, verbrachte sie nicht mehr am Smartphone, sondern an der frischen Luft, mit Essen oder mit Löcher in die Luft starren.
Eine App aus Gewohnheit öffnen? Oder das Smartphone entsperren, weil ich gerade nichts zu tun habe? Wird immer seltener …
Das erste Jahr ohne Instagram
Nach ein paar Wochen kippte ein Schalter im Kopf und ich hörte auf, über Instagram nachzudenken.
Ich ging spazieren, ins Restaurant, ich traf mich mit Menschen und arbeitete, ohne mich ständig zu fragen, ob ich davon eine Story posten soll. Den Gedanken „Das könntest du auf Insta posten“ gab es in meinem Kopf einfach nicht mehr. Wenn meine Kund*innen in einer Beratung mal über Instagram sprachen, dachte ich immer: „Stimmt, Instagram gibt es ja auch noch!“
Instagram aus meinem Kopf zu verbannen, war eine große Erleichterung und gab mir – so pathetisch das klingen mag – ein Stück Freiheit zurück.
Jetzt, wo ich nicht mehr alle paar Minuten mein Smartphone checkte, schrieb ich – eine Menge. Ins Tagebuch oder an einem Sonntag mal dutzende Gedichte. Schreiben half mir, den Social-Media-Abschied zu verarbeiten und zu reflektieren, was in den letzten Jahren auf Social Media eigentlich mit mir passiert war.
Mir wird klar: Ich war in einer Filterblase. Ich war wie „gebrainwasht“. Jahrelang.
Meine Ansichten, meine Gewohnheiten, meine Sprache – alles kommt mir auf einmal seltsam und bescheuert vor. Habe ich wirklich Countdowntimer genutzt, um Menschen Druck zu machen, etwas bei mir zu kaufen?😱 Veranstalte ich echt immer „Bootcamps“ und „Challenges“, um Menschen „aufs nächste Level“ zu bringen.🤣 Arbeite ich echt immer an meinem „Mindset“?🤪
Wie haben es die „echten“ Menschen um mich herum die letzten Jahre nur mit mir ausgehalten?
Langsam, ganz langsam höre ich, was ich eigentlich denke, fühle, brauche und will. Nicht die Menschen, Expertinnen und Gurus da draußen auf Instagram, sondern ich. Die Jahre auf Social Media wurde das immer von Content überlagert.
Ich komme endlich wieder in Kontakt zu mir, meinen Bedürfnissen, Ideen und Werten.
Mir wird egal(er), was Menschen über mich denken oder wie „man“ es „richtig“ macht. Da ich nicht mehr sehe, was ich – angeblich – machen muss, um erfolgreich zu sein, und es die für Instagram so typischen „Machst du diese X Fehler mit Y?“-Inhalte nicht mehr in mein Hirn schaffen, bin ich seltsam zufrieden mit mir. Das Imposter-Syndrom, das mich jahrelang immer auf Instagram plagte, verschwindet zwar nicht völlig, aber wird deutlich besser.
Ich denke nicht mehr jeden Tag, dass ich nicht schön, erfolgreich, reich, kreativ und schlank genug bin, und werde dankbarer für das, was ich schon habe und wer ich bin. Weniger Vergleiche = mehr Dankbarkeit ist eine Gleichung, die für mich definitiv aufgeht.
Mein Interesse für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung schwindet. Ich will nichts mehr entwickeln, nichts verwirklichen, nicht wachsen – ich will einfach nur sein.
Dafür entdecke ich den Feminismus wieder und damit kritischere Gedanken, Marketingethik und Kapitalismuskritik. Und ich fange an, nicht nur wahrzunehmen, dass soziale Medien mir persönlich nicht guttun, sondern wie problematisch das Geschäftsmodell mit den Daten grundsätzlich ist. Was das für die Gesellschaft und Demokratie bedeutet.
All das schaffte es damals nicht in meine Instagramblase. Dort gab es nur sechststellige Launches und Mindset-Shifts und aufzulösende Glaubenssätze, doch nur wenig Kritik an der glitzernden Marketingwelt.
Jetzt gibt es die kritischeren Themen wieder in meinem Leben: Was eine Bereicherung!
Was ich mit meinem Instagram-Konto gemacht habe
Was ist nun konkret mit dem Instagram-Konto passiert?
Instagram-Konto stillgelegt
Zunächst einmal habe ich das Instagram-Konto nur stillgelegt: Ich habe im Sommer 2020 aufgehört zu posten, entfolgte allen Accounts und deinstallierte die App vom Smartphone.
Ich konnte es mir damals nicht vorstellen, als Selbstständige Instagram von heute auf morgen zu löschen. (Auch wenn ich inzwischen ein paar Menschen kennengelernt habe, die kurzen Prozess mit ihrem Instagram-Konto gemacht haben.) Und die Stilllegung des Accounts war mein allererster Schritt. Er fühlte sich zwar immer noch beängstigend an, aber dennoch war er so klein und nicht endgültig, dass ich mich traute, ihn zu gehen.
Der Nachteil an diesem Schritt war: Auch wenn ich nicht mehr auf Instagram aktiv war, hatte ich immer noch ein Instagram-Konto. Und Menschen schrieben mich immer noch via Instagram an und ich fühlte mich verpflichtet, darauf zu reagieren.
Deshalb kam ich doch alle paar Tage wieder mit der Plattform in Kontakt. Da ich niemandem mehr folgte, sah ich zwar keine Beiträge mehr, doch die Plattform nahm immer noch Headspace bei mir ein. (Auch wenn es im Vergleich zu früher natürlich nur noch ein Bruchteil war.)
Instagram-Konto deaktiviert
Rund ein Jahr ließ ich das Instagram-Konto links liegen, beobachtete genau, wie sich meine Sichtbarkeit und mein Umsatz entwickelten, sodass ich irgendwann wusste: Ich brauche Instagram nicht, um selbstständig zu sein.
Und das gab mir den Mut, den nächsten Schritt zu gehen und den Account zu deaktivieren.
Bei einer Deaktivierung ist der Account zwar nicht mehr auf Instagram auffindbar, doch er ist noch vorhanden: Die Fotos, die Follower, die Posts, die Likes … alles noch da.
Sollte ich es mir also doch anders überlegen, bräuchte ich mich nur noch einmal in mein Instagram-Konto einzuloggen und er wäre sofort wieder online. Das gab mir Sicherheit.
Instagram-Konto gelöscht
Es dauerte danach nur noch wenige Wochen, bis mir klar wurde: Jetzt kann ich es auch ganz beenden! Und so beantragte ich – rund ein Jahr und paar Wochen nach der Stilllegung meines Instagram-Accounts – die endgültige Löschung.
Ich sage „beantragte“, weil sich das Instagram-Konto nicht sofort löschen lässt, sondern man immer noch 30 Tage Zeit erhält, seine Meinung zu ändern.
Am 21. Oktober 2021 war es dann endlich soweit: Mein Instagram-Konto gab es nicht mehr.
Wie es ist, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten
Und wie ist es nun, ohne Instagram zu leben und zu arbeiten? Da gäbe es so viel zu erzählen, ich könnte damit ein ganzes Buch füllen! Das Wichtigste:
Zeit
All die Sachen, für die ich nie Zeit hatte (oder immer dachte, keine Zeit zu haben), sind seit dem Instagram-Ausstieg auf einmal realistisch.
Früher war ich immer 1–2 Stunden täglich auf Instagram unterwegs. Das summiert sich – vor allem, wenn wir das aufs Jahr oder drei Jahre hochrechnen.
Und so konnte ich seit meinem Instagram-Ausstieg auf einmal Dinge machen, die ich früher immer auf später verschob:
ein Buch schreiben (Und dann noch eins. Und noch ein weiteres beim Verlag.)
Klavier lernen
wieder mehr Sport machen
Koreanisch lernen
Auf einmal hatte ich wieder etwas, von dem ich dachte, dass Erwachsene (mit Kindern) es einfach nicht mehr haben: Hobbys.
Platz im Kopf
Diese Fragen gibt es in meinem Leben nun nicht mehr:
Was soll ich nur posten?
Kann ich das so posten?
Wie viele Likes hat der Post bekommen?
Hat jemand kommentiert?
Soll ich diesen Post kommentieren?
Damit hatte ich deutlich mehr Platz im Hirn und mehr Kapazitäten für Dinge, die mich wirklich interessieren (siehe oben).
Frieden im Kopf
Mit dem Platz ist auch der Frieden in meinem Kopf eingekehrt. Ohne die für Instagram so typische toxische Positivität, Hustle Culture und Vergleicheritis geht es mir deutlich besser.
Da ich mein Behind-the-Scenes-Ich nicht mehr jeden Tag mit der auf Hochglanz polierten Version von einem Fremden im Internet vergleichen muss, fing ich sogar an, mein Behind-the-Scenes-Ich zu mögen. Jeden Tag ein bisschen mehr.
Spaß bei der Arbeit
Stockfotos aussuchen, Karussellposts erstellen, Hashtags recherchieren, Beiträge liken und kommentieren … Social-Media-Marketing ist für mich eine zu einem großen Teil eher langweilige, anspruchslose Tätigkeit gewesen, die mich nie – auf die gute Art – forderte.
Seit ich mich nach meinem Instagram-Ausstieg auf Marketingstrategien wie Blog, Newsletter und Podcast fokussiere, habe ich auch viel mehr Spaß bei der Arbeit.
Es heißt nicht, dass alle Tage leicht sind und es nie Herausforderungen oder Lernkurven gibt. Es heißt vielmehr, dass es eine maximale Schnittmenge zwischen meinen Stärken, Werten und Interessen gibt, die es so in der Form bei Instagram nicht gab.
Die Wiederentdeckung der Langeweile
Seit meinem Instagram-Ausstieg ist mir immer öfter mal langweilig. Und dann sitze ich auf dem Sofa und überlege, was ich als nächstes mit meiner Zeit anstellen will. Oder ich warte an der Bushaltestelle ganz oldschool, indem ich einatme, ausatme und Löcher in die Luft starre.
Klingt negativ?
Tatsächlich ist es schön, mal wieder Langeweile zu spüren und nichts zu machen, außer zu atmen. Es erdet, beruhigt und macht kreativ, wie inzwischen in Studien untersucht wurde.
Auch die Stille und die Ruhe habe ich für mich wiederentdeckt.
„Social“ sein
Doch es ist natürlich nicht nur so, dass ein Instagram-Ausstieg nur mit Vorteilen daherkommt, sondern dass es auch einige Nachteile gibt.
Privat habe ich eh selten mit Menschen über Social Media kommuniziert, beruflich allerdings schon.
Und so hat sich Kontakte halten ohne Instagram als deutlich herausfordernder herausgestellt als mit. Es ergibt sich nicht so schön nebenbei, indem man auf eine Story mit einem Emoji antwortet. Wir müssen das Kontaktehalten nun selbst aktiv gestalten und:
Initiative ergreifen
Menschen anschreiben
virtuelle oder persönliche Treffen vorschlagen
Auch heute fällt es mir nicht unbedingt leicht und ich muss mich gezielt daran erinnern, „social“ zu sein und Menschen anzuschreiben.
Doch möglich ist Netzwerken ohne Social Media auf jeden Fall. Das Soziale haben Social Media nicht für sich gepachtet bzw. inwiefern sie überhaupt noch „sozial“ sind, sei mal dahingestellt.
Seit ich kein Instagram mehr nutze, treffe ich meine Kundinnen und Kolleginnen viel öfter live und in Farbe. Mal zum Mittagessen oder gleich für mehrere Tage in einem Hotel.
Natürlich kann ich das nicht jeden Monat so machen. Doch weniger ist für mich inzwischen mehr.
Und gehe ich wieder zu Instagram zurück?
Natürlich weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Doch aktuell sehe ich für mich keine Notwendigkeit, Instagram zu nutzen. Weder privat noch beruflich als Marketingkanal.
Seit ich Instagram verlassen habe, habe ich:
mehr Zeit für spannende berufliche Projekte oder private Hobbys
ein besseres Selbstwertgefühl
mehr Platz im Kopf für Dinge, die mir wirklich wichtig sind
mehr Freude im Arbeitsalltag
mehr Stille, Ruhe und Langeweile
berufliche Kontakte, die tiefer gehen, weil sie über die Antwort-Emojis auf Social Media hinausgehen
Warum sollte ich da jemals zu Instagram zurückgehen?
Noch mehr Texte zum Thema „Instagram löschen“
Warum ich ab sofort mit einem sozialen Preismodell arbeiten werde
Bei einem sozialen Preismodell steht im Fokus, dass auch diejenigen bei einem Kurs oder einem Programm partizipieren können, die über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügen. Im Blogartikel erzähle ich, warum Selbstständige ein soziales Preismodell etablieren können und wie das soziale Preismodell konkret aussehen kann.
Ich selbst bin mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, als ich knapp acht Jahre alt war. Wir kamen mit vier Koffern und jede Menge Träumen, doch gerade die ersten Jahre waren hart:
Neben finanziellen Herausforderungen galt es Deutsch zu lernen, einen Job zu finden (für meine Eltern), in der Schule zurechtzukommen (für meinen Bruder und mich) und sich als Familie eine neue Heimat zu schaffen.
Nun könnte ich meine Integration auf meine eigene Leistung schieben, doch die Wahrheit ist:
Ohne die Unterstützung von anderen Menschen hätte ich das nie so schnell geschafft. Es waren vor allem Eltern von einigen Mitschülerinnen, die sich dachten:
„Oh, ein neues Kind, das kaum Deutsch spricht – laden wir sie doch zu uns zum Spielen ein / machen wir doch zusammen Ausflüge / nehmen wir sie doch in den Turnverein mit!“
Sie schenkten großzügig ihre Zeit – und oft auch ihr Geld –, ohne jemals eine Gegenleistung von mir zu verlangen. Einfach nur, weil sie mir ermöglichen wollten, schnell Teil der Schulklasse zu werden und neue Freund*innen zu finden.
Deshalb weiß ich nicht nur genau, wie herausfordernd es ist, wenn man zu wenig Kohle für geile Dinge hat. Ich weiß auch ganz genau, wie wichtig Solidarität für eine Gesellschaft ist.
Und dass Solidarität das Leben von Menschen tatsächlich verändern kann.
Auch ich als Selbstständige möchte nun – nicht zuletzt aufgrund meiner eigenen persönlichen Erfahrungen – solidarisch mit anderen Selbstständigen sein.
Konkret geht es mir darum, möglichst vielen Selbstständigen zu ermöglichen, etwas Neues zu lernen und beruflich weiterzukommen – völlig egal, über wie viele finanzielle Ressourcen jemand verfügt.
Deshalb habe ich mich entschieden, ab sofort mit einem sozialen Preismodell zu arbeiten.
Was ist ein soziales Preismodell?
Bei einem sozialen Preismodell steht im Fokus, dass auch diejenigen bei einem Kurs oder einem Programm partizipieren können, die über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügen.
Finanzielle Ressourcen und Vermögen haben nämlich meist weniger mit der individuellen Leistung eines Menschen zu tun als mit gesellschaftlichen Strukturen, die diskriminierend sein können:
50% der alleinerziehenden Frauen haben zum Beispiel ein Einkommen von 1.700 Euro und weniger. (Quelle)
Menschen mit Migrationshintergrund verdienen laut einer Studie von McKinsey 25% weniger als Menschen ohne Migrationshintergrund. (Quelle)
Rentnerinnen bekommen im Durchschnitt knapp 400 Euro weniger als Rentner. (Quelle)
Usw.
Ein soziales Preismodell erkennt diese strukturellen Unterschiede an und will sie ein Stück weit ausgleichen, indem es Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen auf verschiedene Arten ermöglicht, an einem Programm doch teilzunehmen.
Gründe für ein soziales Preismodell
Warum sollten Onlineunternehmer*innen das tun und soziale Preismodelle etablieren? Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür:
Gesellschaftliche Realitäten anerkennen
Zunächst einmal geht es mir darum, gesellschaftliche Realitäten anzuerkennen. Die Lebenshaltungskosten sind dank Inflation gestiegen, und die Studien, die ich weiter oben zitiert habe, zeigen, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die kaum genügend Geld haben, um jetzt über die Runden zu kommen, geschweige denn, um sich Onlineprogramme leisten zu können.
Nun können wir als Selbstständige sagen: „Solange es mir gut geht, ist das nicht mein Problem!“
Wir könnten uns aber auch fragen: „Wie kann ich solidarisch mit Menschen sein, die über weniger finanzielle Ressourcen verfügen als ich?“
Oder: „Wie kann ich Verantwortung übernehmen?“
Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
So ermöglichen wir letzten Endes gesellschaftliche Teilhabe – zumindest im Kleinen.
Diese bleibt gerade Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen oder Menschen in Armut verwehrt. Sie können sich oft nicht den Kaffee, das Kinoticket, die Konzertkarte oder den Kurztrip leisten. Und erst recht haben sie nicht mehrere hundert oder gar tausend Euro für Onlineprogramme auf der hohen Kante.
Feminismus statt Pinkwashing
Wie können wir davon sprechen, dass wir mit unserem Angebot Frauen stärken wollen, wenn wir Programme anbieten, die sich nur privilegierte Frauen leisten können?
Das ist für mich ein Widerspruch, und deshalb finde ich es so wichtig, Worten Taten folgen zu lassen und es so vielen Frauen, wie nur möglich, zu ermöglichen, an Wissen zu partizipieren.
Wie mein soziales Preismodell aussieht
Bei mir ist das so:
Onlinekurse zum fairen Preis
Ein erster Pfeiler meiner sozialen Preismodelle sind meine Onlinekurse.
Hier habe ich mein Marketingwissen in Textform aufgearbeitet, ohne die Erstellung der Onlinekurse durch Videos oder umfangreiche Workbooks unnötig zu verkomplizieren.
Somit musste ich mir keine externe Unterstützung holen und kann die Onlinekurse zu einem – aus meiner Sicht – fairen Preis von 100,- Euro anbieten.
Ratenzahlung ohne Aufpreis
Gerade wenn es um höhere Beträge geht, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass sich nicht alle Menschen die Einmalzahlung leisten können.
Hier können Ratenzahlungen, die den Gesamtbetrag in mehrere kleine Häppchen aufsplitten, helfen.
Dabei finde ich es wichtig, Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen nicht zusätzlich zu benachteiligen, indem Ratenzahlungen insgesamt teurer sind als die Einmalzahlungen.
Somit gehört es zu meinem sozialen Preismodell, dass Menschen immer denselben Gesamtbetrag zahlen – völlig egal, ob auf einmal oder in zehn Raten.
Gutscheine von bis zu 50%
Früher habe ich Frühbucherrabatte, Webinarrabatte und ähnliche Preisnachlässe genutzt, um – so ehrlich muss ich an dieser Stelle sein – dank FOMO und Co. mehr zu verkaufen.
Jetzt möchte ich denjenigen Menschen Preisnachlässe gewähren, die sie – statistisch gesehen – auch wirklich gut gebrauchen könnten:
Alleinerziehende
Rentner*innen
Menschen mit einer Erkrankung oder Behinderung
Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte oder mit Diskriminierungserfahrung
usw.
Denn es sind gerade diese Menschen, die statistisch weniger Geld verdienen und – so zumindest meine Erfahrung in meinen Programmen in den letzten Jahren – auch seltener an kostenpflichtigen Onlineangeboten partizipieren.
Ich finde: Das muss sich dringend ändern, und deshalb möchte ich ab sofort Menschen, die über nicht genügend finanzielle Ressourcen verfügen, entgegenkommen und einen Gutschein von bis zu 50% des Gesamtpreises erstellen.
Wichtig: Ich möchte bei den Gutscheinen auf Vertrauensbasis arbeiten. Das heißt: Niemand muss mir großartig was erklären, rechtfertigen oder gar nachweisen.
Eigene Ideen
Möglicherweise sind auch die 50% immer noch viel zu viel für jemanden. Hier möchte ich grundsätzlich offen für weitere Ideen sein, wie auch die restlichen 50% alternativ finanziert werden können.
Das Wörtchen „nur“
Und schließlich hat das Wörtchen „nur“ für mich nichts mehr auf Verkaufsseiten verloren.
Auch 100 Euro können für Menschen eine Menge Geld sein. Und deshalb finde ich Marketingbotschaften wie
„Jetzt für NUR 100 Euro kaufen“
alles andere als sozial. Für jede*n bedeuten 100 Euro etwas anderes.
Sind soziale Preismodelle wirtschaftlich tragbar?
Letzten Endes bin ich selbst Unternehmerin und brauche natürlich Geld für mein Gehalt, für Rücklagen und Co. Niemandem ist geholfen, wenn ich nach ein paar Monaten noch nicht mal mehr über die Runden komme.
Deshalb werde ich mein soziales Preismodell das nächste halbe Jahr laufen lassen und es danach evaluieren. Möglicherweise werde ich es danach ergänzen, verändern oder etwas ganz anderes tun.
Ich habe mich bei der Recherche für diesen Artikel übrigens gefreut zu sehen, dass es bereits Selbstständige gibt, die ein soziales Preismodell praktizieren, zum Beispiel:
Und vielleicht bald auch du?😊
Hochpreis-Coachings im Female Empowerment: the bad and the ugly
Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen: Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? Meine Kritik an Hochpreis-Coachings
Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen:
👉 Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? 👈
Ein paar Zahlen:
Das Durchschnittsbruttoeinkommen von Frauen in Deutschland liegt bei 3.699 Euro. (Quelle)
Bundesweit haben nur 10% aller Frauen zwischen 30 und 50 Jahren ein Nettoeinkommen von mehr als 2.000 Euro. (Quelle)
19% der Frauen haben kein eigenes Einkommen und 63% unter 1000 Euro.(Quelle)
Die Durchschnittsrente für Frauen liegt aktuell bei unter 900 Euro im Monat. (Quelle)
Das Armutsrisiko für Frauen liegt aktuell bei 16%. (Quelle)
Bekommt eine Frau ein Kind, verdient sie bis zu ihrem 45. Geburtstag bis zu 251.000 Euro weniger als eine Frau ohne Kinder. (Quelle, S. 112)
Wie kommt man angesichts dieser Zahlen eigentlich auf die Idee, dass Frauen irgendwo einen höheren vier-, fünf- oder sechsstelligen Betrag rumliegen hätten, der nur darauf wartet, in ein „empowerndes“ Coaching „investiert“ zu werden?
Nun soll dieser Text weder ein Plädoyer gegen hochpreisige* Coachings werden noch gegen Female Empowerment als vielmehr eine Erinnerung:
Wer hochpreisige* Onlineprogramme verkauft, macht Produkte nicht für „Frauen“, sondern für einen kleinen Teil wohlhabender Frauen. Das kann man natürlich gerne tun, nur dann hat es eben wenig mit „Female Empowerment“ zu tun.
Wer ausschließlich hochpreisige* Produkte anbietet, kann das Wort „Female Empowerment“ oder „Feminismus“ nicht in den Mund nehmen, ohne „Pinkwashing“ zu betreiben (= das Pflegen eines feministischen Images bei Handlungen, die diesem Image widersprechen).
Wie hochpreisige Produkte gerechtfertigt werden
Wer selbst mal ein Business-Coaching macht, erfährt früher oder später am eigenen Leib:
Es ist in den letzten Jahren geradezu verpönt geworden, bezahlbare** Kurse und Programme anzubieten. Business-Coaches haben eine Menge Argumente parat, warum wir als Selbstständige und Onlineunternehmer*innen unbedingt hochpreisige Produkte anbieten sollten.
Hier die drei beliebtesten:
#1 „Wenn deine Angebote nicht hochpreisig sind, zeugt das vom ,falschen’ Money Mindset.“
Die Vorstellung, dass wir unser „richtiges“ Money Mindset unter Beweis stellen, wenn unsere Produkte hochpreisig sind, hält sich hartnäckig. Doch: WTF?!
Zunächst: Wer soll überhaupt entscheiden, was ein „richtiges“ und was ein „falsches“ Money-Mindset ist? Der Business-Coach? Und wenn ja – wie kommt er oder sie zu diesem Recht?
Unser Job als Selbstständige und Online-Unternehmer*innen ist es, Preise realistisch zu kalkulieren. So, dass unsere Ausgaben gedeckt sind und wir Gewinn machen können, den wir in Rücklagen, Vorsorge und Co. stecken können.
Preise zu würfeln oder beliebige Zahlen aneinanderzureihen, nur damit der Preis ein bestimmtes Money Mindset an den Tag legt, „schön“ aussieht oder besonders „energetisch“ wirkt („7777 Euro“), ist nicht sehr verantwortungsbewusst gegenüber Menschen, die sich unter Umständen jeden Cent absparen, um sich ein hochpreisiges Produkt zu kaufen. Oder gar anfangen, sich zu verschulden, Kredite aufzunehmen oder Flaschen zu sammeln. (Ja, alles schon gehört.)
#2 „Verlange die Preise, die du wert bist.“
Die Verknüpfung von Geld und Wert ist ein besonders mächtiges Argument. Denn natürlich wollen wir alle wertvoll sein – und dass andere Menschen unseren Wert auf den ersten Blick anhand des Preises unserer Produkte sehen.
Doch die Verknüpfung von Geld und Selbstwert ist problematisch.
Unser Wert als Mensch sollte überhaupt nichts mit Geld zu tun haben und unsere Finanzen sollten für unseren Selbstwert idealerweise überhaupt keine Rolle spielen. (Auch wenn das in der Praxis natürlich leichter gesagt als umgesetzt ist.)
Denn wenn Geld wirklich Ausdruck unseres Selbstwertes wäre, hieße das, dass …
… sich mein Wert als Mensch nach – je nach finanzieller Lage – ändert. Zum Beispiel, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit weniger wertvoll war als jetzt.
… der reichste Mann Deutschlands (Dieter Schwarz) 44,7 Milliarden Mal wertvoller ist als jemand, der überhaupt kein Vermögen hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss.
… usw.
Ist es nicht so viel sinnvoller anzunehmen, dass unser Wert rein gar nichts mit Geld zu tun hat und dass wir, egal, ob unser Produkt 5, 50, 500, 5.000 oder 50.000 Euro kostet, einen unveränderlichen Wert als Mensch haben?
Ich würde noch weitergehen und behaupten:
Ein Selbstwert, der von äußeren Faktoren wie Geld (wie dem Preis unserer Produkte) abhängig ist, ist ein Selbstwert, der einstürzt, sobald sich äußere Bedingungen ändern. Seinen Selbstwert an Geld zu koppeln, führt deshalb zu einem kontingenten Selbstwert – keinem echten.
Stattdessen sollten wir unseren Selbstwert von äußeren Faktoren entkoppeln:
vom Umsatz
von der Anzahl der Kundinnen oder Followern
von Produktivität und von den abgehackten Punkten auf der To-do-Liste
und vielem anderen mehr, das die Hustle Culture uns erfolgreich eingeredet hat.
All diese Dinge sollten idealerweise überhaupt keine Rolle für unseren Selbstwert spielen.
#3 „Ob sich Menschen deine Programme leisten können, ist nicht deine Verantwortung.“
Ich finde: Auch als Selbstständige tragen wir gesellschaftliche Verantwortung. Das gilt umso mehr, wenn wir Reichweite haben und mit unseren Ansichten viele Menschen erreichen.
Wir können – angesichts der vielen individuellen finanziellen Situationen, in denen Frauen sich befinden – vielleicht nicht die individuellen Situationen an sich lösen, ja.
Doch wir tragen mit unseren unternehmerischen Entscheidungen dazu bei, dass sich bestimmte Strukturen und Systeme verfestigen – oder eben nicht.
Wenn wir zum Beispiel in unserem Marketing Frauen als defizitäres Wesen inszenieren und ihnen vermitteln, dass sie nicht gut genug sind, ihnen danach ein passendes hochpreisiges Coaching andrehen, das ihr vermeintliches Problem löst, und sie zusätzlich noch in einen Kredit treiben, weil wir Druck beim Verkaufsgespräch ausüben und keine Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, können wir nicht einfach sagen: „Ist nicht mein Problem, wenn du dir das nicht leisten kannst.“
Dann sind wir das Problem.
Wie das Marketing für hochpreisige Produkte oft aussieht (und was es mit Female Empowerment zu tun hat)
Apropos Marketing: Gerade im Hochpreis-Coaching-Bereich werden eine Menge Marketingtaktiken, -tricks und -strategien an den Tag gelegt, die problematisch sind. Schauen wir sie uns im Einzelnen an.
Eigenen Lifestyle zur Schau stellen
Wenn jede*r plötzlich eine Personal Brand ist, heißt das auch, dass die Grenzen zwischen „privat“ und „beruflich“ verschwimmen. Für viele Coaches bedeutet das, Menschen auf Social Media hinter die Kulissen ihres Alltags mitzunehmen und ihnen die Errungenschaften ihres Erfolgs nach dem Motto „Mein Haus, mein Auto, mein Team“ zu präsentieren.
Wir sehen, wie sie vor ihrem Sportauto posen sich fotografieren lassen.
Oder mit ihrer Mastermind-Gruppe Privatjet fliegen. (Und es abfeiern.)
Oder in Luxushotels einchecken, die sich die meisten ihrer Follower niemals leisten können werden.
Oder ganz nach Dubai ziehen, weil sie dort kaum Steuern zahlen müssen dort jeden Tag die Sonne scheint.
Das soll in erster Linie zeigen: „Schau her, wie weit ich es gebracht hab! Schau her, wie erfolgreich ich bin! Schau her, was ich mir leisten kann!“
Doch es ist noch mehr:
Mythos Meritokratie
Diese Zurschaustellung des fancy Lifestyles wird in zweiter Linie genutzt, um in rosa-pastelligen Posts oder extrem „männlichen“ Inspirationszitaten, auf den Löwen abgebildet sind, mantraartig die immergleiche Botschaft zu teilen:
„Wenn ich das geschafft hab, schaffst du es auch!“
„Wenn Kundin X die Erfolge erzielt hat, kannst auch du erfolgreich werden!“
Das ist das typische neoliberale Narrativ, das Grundversprechen des Kapitalismus, der klassische American Dream:
„Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du dich dafür anstrengst.“
Doch die Meritokratie ist – das gilt 2024 mehr denn je – ein Mythos. Es mag sein, dass ein gewisses Maß an Leistung sich positiv auf unser Leben auswirkt und dass wir sogar erfolgreich werden in dem, was wir tun. Doch entscheidender für die meisten Menschen ist laut Statistik immer noch, in welche Familie sie hineingeboren wurden.
So wird Vermögen meist über Generationen vererbt – nicht verdient.
Und auch soziale Mobilität kommt in der Praxis viel seltener vor, als wir es uns wünschen würden. (Die Aufwärtsmobilität lag für Frauen in Deutschland 2021 bei 34% im Westen bzw. 33% im Osten.)
Auch wenn Ausnahmen sicherlich die Regel bestätigen: Am wahrscheinlichsten ist das Szenario, dass nicht die „richtige“ Business- oder Marketingstrategie, das „richtige“ Mindset und erst recht nicht das „richtige“ Onlineprogramm Einfluss darauf hat, ob wir erfolgreich werden oder nicht, sondern unsere Herkunft.
Das ist traurig und ein Skandal, keine Frage. Doch es ist ein Fakt, den wir, wenn wir Marketing machen, auf jeden Fall kennen und beachten sollten und vor allem: nicht einfach das Gegenteil behaupten, weil es gerade so schön ins Marketing passt.
Wenig Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen
Mit dem Meritokratie-Mythos ist oft auch ein mangelndes Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen verbunden. Denn auch wenn Business-Coach Tobi, 23, es vielleicht nicht glauben mag, aber:
Für die meisten Menschen dieser Erde gibt es aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, körperlichen Verfassung, ihrem Aussehen oder sozioökonomischem Hintergrund gewisse Grenzen, Herausforderungen, Diskriminierungen oder Behinderungen. Da können sie noch so viel „wollen“ und „Affirmationen aufsagen“ und „an ihrem Mindset arbeiten“.
Ich erspare mir an dieser Stelle eine ausufernde Liste, doch nur so viel: Phrasen wie
„Ausrede“
„Falsches Mindset“
„Es ist leicht, das zu tun.“
sind nichts weiter als ein Zeichen der Privilegien derjenigen, die sie unreflektiert äußern, und sollten im Marketing 2024 nun wirklich nicht mehr verwendet werden. Erst recht nicht, um hochpreisige Coachings an die Frau zu bringen.
Druck und Psychospielchen
Du siehst vielleicht: Mit „Female Empowerment“ hat diese Art von Marketing nur wenig zu tun, denn es geht hier ja nicht darum, alle (oder möglichst viele) Frauen erfolgreich zu machen, sondern nur diejenigen, die bereit sind, diese hohen Preise zu zahlen.
Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt: Wie bringen diese Business-Coaches Frauen eigentlich dazu, ihre Preise zu zahlen?
Zunächst einmal, indem sie Menschen in einen ausgeklügelten Sales Funnel packen, aus dem es dank künstlicher Verknappung, Druck und FOMO kaum einen Weg mehr nach draußen gibt.
Nicht selten werden zunächst neue Probleme, neue Bedarfe kreiert, die vorher so noch nicht da waren.
Wir alle kennen diese Werbungen:
„Du wolltest schon immer schneller die Schuhe binden als deine Nachbarin? Mit MEINER METHODE kannst du sie in nur sieben Wochen um drei Sekunden übertrumpfen! Ich stehe jeden Morgen auf und bin überglücklich, weil ich weiß, wie ich mir mit der richtigen Methode die Schuhe binde – ich bin endlich ganz, geheilt, erleuchtet – und mit meinem nagelneuen Onlineprogramm ‚Erfolgreich Schuhebinden in 7 Wochen‘ kannst du es für nur 7777,- Euro nun auch! Aber weil ich WIRKLICH will, dass sich was bei dir ändert, habe ich dir meine wichtigsten Tipps in eine Masterclass gepackt, für die du dich JETZT kostenlos anmelden kannst. Aber SCHNELL, es melden sich so viele Menschen an, dass ich die Türen für mein automatisiertes Webinar BALD SCHLIESSEN muss! Also melde dich am besten jetzt sofort an, um ja NICHTS ZU VERPASSEN, und VERÄNDERE DEIN LEBEN für immer!“
Und wenn Menschen dann anbeißen – denn wer will nicht ganz, geheilt, erleuchtet sein? – und sich für die Masterclass anmelden, kommen sie in einen aggressiven Strudel aus Retargeting-Ads und Verkaufsmails. Und wenn sie dann einem 1:1-Verkaufsgespräch zustimmen, bekommen sie meist folgende Botschaften zu hören:
„Du musst Vertrauen haben!“
In den Coach. In die Methode. Ins Universum. Wenn du den Preis für das Coaching anzweifelst, hast du kein Vertrauen, und wie willst du mit dieser Einstellung überhaupt erfolgreich werden?
„Du musst in dich investieren!“
Wenn du zehntausend Euro für mein Coaching ausgibst in dich investierst, mit dem Wissen dann aber hunderttausend Euro verdienst, hast du das Geld schneller wieder drin, als du „Manipulation“ sagen kannst. Was, du brauchst eine Garantie? Guck doch mich und meinen Lifestyle an, Baby! Ich bin der beste Beweis dafür, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur willst. Und überhaupt: Hast du denn überhaupt kein Vertrauen ins Universum?!
„Es geht nur mit meinem Programm!“
Du willst ohne mein Programm ein Business aufbauen / Marketing machen / erfolgreich werden / ein Trauma heilen? LOL. Viel Glück! Weißt du denn nicht, dass ICH bereits dort bin, wo du gerne sein möchtest? Dass ICH bereits alle Schritte gegangen bin, die noch vor dir liegen? Wenn du jetzt Geld für andere Kurse, Methoden oder Mentor*innen ausgeben würdest, wärst du schön blöd!
„Kein Geld ist eine Ausrede!“
Was, du hast kein Geld? Weißt du: Es ist nicht wirklich Geld, es ist nur das, was wir darüber denken. Für mich ist Geld einfach nur Energie. Energie fließt zu mir und wieder von mir weg. Ein natürlicher Lauf der Dinge. Jeder hat Energie – auch du!
Wenn du es wirklich wollen würdest, wenn du es wirklich ernst meinen würdest, dann würdest du deine Energie in mein Programm stecken. Ich habe Kunden, die nehmen sogar einen Kredit auf, weil sie ALL IN gehen.
„Der Preis steigt!“
Entscheide dich schnell, denn der Preis steigt – täglich! Heute kostet das Schuhebinden-Coaching 7777,- Euro, morgen 8888,- Euro, übermorgen 9999,- Euro und in drei Tagen 123.456,- Euro. Warum? Weil ich es kann!
Neben diesen Psychospielchen zeichnet sich das Marketing der Hochpreis-Branche oft durch mangelnde Transparenz aus.
Was nun genau im Coaching enthalten ist, welche Inhalte vermittelt werden oder wie eine Zusammenarbeit genau aussieht, wird oft unter Verschluss gehalten, denn: Du musst Vertrauen haben! Nachfragen oder gar Kritik äußern? Nicht erwünscht.
Früher, als ich noch auf Social Media und insbesondere in Facebook-Gruppen unterwegs war, war ich oft live dabei, als kritische Kommentare gelöscht („Das hier soll ein positiver Ort sein!!!“) und Menschen, die nachfragten, zum Schweigen gebracht wurden.
Nicht selten entwickelte sich in diesen Gruppen eine merkwürdige Dynamik: Die Coachin, die für ihre Coachings einen sechsstelligen Betrag verlangte, als Marketing lediglich Fotos von sich im teuren Porsche postete und sonst nur wenig über die Inhalte des Coachings preisgab, wurde von den Facebook-Gruppen-Mitgliedern leidenschaftlich in Schutz genommen. Die Menschen hingegen, die nachfragten oder Kritik äußerten, wurden bloßgestellt („Das sagt ja viel über dein eigenes Mindset aus!!!“), beleidigt und – man könnte vielleicht sagen – letzten Endes rausgemobbt.
Merke: In der Coaching-Bubble dürfen Frauen anscheinend alles (Porsche fahren, sich teure Villen mieten, Privatjet fliegen, sechsstellige Preise für ihre Coachings verlangen) – außer kritisch nachzufragen.
Das ist nicht Female Empowerment. Das sind sektenartige Strukturen inkl. Brainwashing.
Der Elefant im Raum: Wie können wir mit unseren Angeboten nun Frauen stärken?
Und doch gibt es einen Elefanten im Raum (er heißt Hugo), über den ich ebenfalls sprechen möchte.
Denn natürlich ist es absolut fein,
als Selbstständige oder Onlineunternehmer*in Geld für Beratung, Produkte, Coachings etc. zu bekommen (schließlich können wir alle nicht von Luft und Liebe leben)
ggf. auch viel Geld für Beratung, Coachings etc zu bekommen, weil viel von unserer Zeit, unserem Wissen, Können etc. in den Produkten steckt
und dabei gleichzeitig Frauen stärken zu wollen (schließlich ist das ein notwendiges Anliegen – wenn wir in dem Tempo so weitermachen, sind wir erst in 131 Jahren gleichberechtigt)
Die Frage ist: Wie können wir das tun, ohne dass es zu einem Widerspruch („Pinkwashing“) kommt?
Vielleicht so:
Wertschätzendes Marketing
Wir könnten damit starten, Frauen in unserem Marketing wertschätzend zu behandeln, indem wir folgende Dinge – für mich inzwischen absolute Red Flags – vermeiden:
Mangelnde Informationen über Ablauf, Inhalte und Preis des Coachings
Unhaltbare und pauschale Versprechen („Nach meinem Coaching hast du sechsstellige Launches“)
Heilversprechen, die laut HWG verboten sind
Schwammige Versprechen wie „Transformation“
eine „Geheimstrategie“, die angeblich für alle funktioniert, unabhängig von ihrer individuellen Situation
Hohe Preise, die – selbst bei jahrelanger Erfahrung – jeglicher wirtschaftlicher Grundlage entbehren
Angel Numbers wie 7777,- Euro
Aggressives Marketing mit ausgeklügelten Funnels und Verkaufsmails
Schwammige Begriffe wie „Energie“ (im esoterischen Sinn, nicht im Sinne von „Kraft“), „Universum“ etc.
Gezieltes Auslösen von FOMO
Aggressiven Einsatz von Testimonials
keine Zeit, um eine Nacht drüber zu schlafen
Obsession mit Zahlen („Sechsstelliger Launch“, „Siebenstelliges Business“, „Zehntausend Follower“)
Lovebombing und keine Wahrung von Grenzen („Hallo du Liebe“, „Hallo mein Herz“)
In Strukturen denken, nicht in individueller Selbstverwirklichung
Auch wenn es schön ist, dass es einzelne Frauen „schaffen“ und erfolgreich werden mit dem, was sie tun, geht es im Feminismus darum, dass es alle (oder zumindest möglichst viele) Menschen „schaffen“. Unabhängig von ihrem Geschlecht, sexueller Identität, Herkunft, Behinderung etc.
Nur wenn es für alle Menschen die gleichen Chancen gibt, haben wir es „geschafft“ – nicht wenn einzelne Frauen wie Sheryl Sandberg oder Angela Merkel mal für wenige Jahre an der Spitze eins Unternehmens oder Staates stehen, wir mal für ein paar Jahr einen Schwarzen Präsidenten im mächtigsten Land der Welt haben oder wenn hundert Onlineunternehmerinnen siebenstellig im Jahr verdienen.
Denn auch der Trickle-down-Effekt, die Hoffnung, dass sich Geld, Macht oder was auch immer von „oben“ nach „unten“ verteilt, ist ein Mythos.
Deshalb muss die Frage nicht lauten: „Wie kann ich mit dem, was ich tue, einzelne (weiße, wohlhabende, hetero) Frauen dabei unterstützen, erfolgreich zu werden?“
Sondern: „Was kann ich für möglichst viele Frauen tun?“
Wie das aussehen mag, mag von Coach zu Coachin und Angebot zu Produkt variieren. Deshalb müssen wir anfangen, mehr darüber nachzudenken und zu reden und Dinge auszuprobieren.
(Und wie ich es persönlich handhabe, werde ich in einem separaten Blogartikel nächste Woche erzählen.)
Walk the walk
Es geht nicht darum, theoretisch für Female Empowerment zu sein, sondern das Gesagte auch in der Praxis umzusetzen, z.B. indem wir
die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, angemessen und pünktlich bezahlen und wertschätzend
für Diversität sorgen, sollten wir ein Team haben
in unserem Marketing Frauen nicht als defizitäres Wesen inszenieren
etc.
Nur wenn das, was wir nach außen kommunizieren, zu dem passt, was wir in unserem Unternehmen leben, können wir guten Gewissens behaupten:
Mir ist die Stärkung von Frauen ein Herzensanliegen.
Anmerkungen
*Mir ist natürlich bewusst, dass „hochpreisig“ ein höchst subjektiver Begriff ist, der für jede*n etwas anderes bedeutet. Ich verstehe in diesem Text unter „hochpreisig“ einen Preis, den sich eine Frau mit einem Durchschnittsgehalt in Deutschland statistisch nur schwer leisten könnte.
**Dasselbe gilt für „bezahlbar“.
So schreibst Du lebendiger: 7 Einladungen zur neuen Freundlichkeit
In ihrem Gastartikel hat Autorin und Schreibmentorin Anke Ernst 7 Einladungen mitgebracht, freundlich(er) mit sich selbst beim Schreiben zu sein. So entsteht eine lebendige Schreibroutine und Schreibblockaden lösen sich auf.
Dies ist ein Gastartikel von Anke Ernst. Anke ist Schreibmentorin, selbst Autorin (unter anderem für Dudenverlag) und zertifizierte Bildungsreferentin. Ihr Motto: Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen, sollten gelesen werden. Deshalb unterstützt sie Soloselbständige dabei, Texte über ihre Expertise zu schreiben – mit Herz, handfesten Tipps und Strategien, die sich in ihrem Alltag als Autorin bewähren. Sie bloggt auf In Deinen Worten und schreibt einen wöchentlichen Newsletter.
Zähne zusammenbeißen, dreimal knirschen, durchziehen. Klar, auch so entstehen Texte. Meist sind das die, bei denen Du alle Checkboxen korrekter Texte abhaken kannst. Es sind selten die, die Deine Leser*innen berühren.
Zwischen den Zeilen lesen wir, wie die Autor*innen ihre Schreibroutine gestalten. Wie die Substanz des Textes entstanden ist – die, die auch die beste Lektorin nicht hinzuzaubern kann.
Das ist eine gute Nachricht.
Die Substanz entsteht im Zwiegespräch zwischen Dir und Deinem Text. Ist das Zwiegespräch freundlich, trauen sich auch die lebendigen Gedanken und Worte raus. Du weißt schon, die, die Dich ausmachen.
Bereit für die neue Freundlichkeit? Heute lade ich Dich sieben Mal dazu ein.
1. Einladung: Dich beim Schreiben selber mitnehmen
Zu oft schreiben wir, weil’s eben zum Business gehört. Mehr Blogartikel, größere Reichweite, bitte noch zehn Herzchen bis heute Abend.
Aber wozu bist Du eigentlich angetreten?
Ach ja, richtig. Du willst Dich mitteilen und andere unterstützen. Und zwar nicht irgendwen, sondern die Menschen, die für Dich zählen.
Du erinnerst Dich an Deine ursprüngliche Motivation, indem Du Deinen Leser*innen schon vor dem Schreiben die Hand reichst.
Die Antworten auf diese Fragen helfen Dir dabei:
Wo holst Du Deine Leser*innen ab, wohin bringst Du sie?
Was sollen Deine Leser*innen durch die Lektüre lernen, verstehen, anders machen?
Übrigens, vergessen wir oft: Unser Körper gehört auch zu uns. Wie sonst würden die Worte ins Dokument finden? Dafür braucht er Pausen: spazieren, tanzen, Schultern rollen. Tief ein- und ausatmen hat sich auch bewährt.
2. Einladung: Dich vom Leben inspirieren lassen
„Gute Texte entstehen, indem wir uns täglich zum Schreiben zwingen.“
Können wir bitte gegen diesen Glaubenssatz rebellieren?
Schöner ist‘s doch, die eigene Lebenszeit wertzuschätzen.
Das meine ich in doppelter Hinsicht.
1. Das Schreiben darf Dir Freude machen. Du darfst offen sein, spielen, kreativ verknüpfen. Du darfst Dich von Schreiborten inspirieren lassen. Ob alleine im Café, virtuell Seite an Seite mit anderen, unterm Tisch mit Cookies in Reichweite – Deine Schreibroutine darf sich gut anfühlen.
2. Wenn Du lebst, machst Du Erfahrungen. Manche kannst Du nicht beeinflussen. Aber Du kannst sie Dir alle zu eigen machen und in Deine Worte fassen. So entstehen Bedeutung, Kunst und gute Texte.
Autorin und Schreibmentorin Anke Ernst
3. Einladung: Deinen Text-Ideen ein bis fünf Chancen geben
So viele Ideen modern in virtuellen Schubladen. Oft liegt es daran, dass die Schreibenden sich in ihren Worten verheddert haben, sie Gedankenknoten nicht lösen konnten oder ihr Mut nur fürs erste Drittel gereicht hat.
Deine Idee wird klarer, wenn Du Deinen Text vor dem Schreiben skizzierst.
Es geht nicht darum, den perfekten (einschüchternden) Masterplan zu schmieden. Es reicht, ein paar Zwischenüberschriften zu setzen, in Stichpunkten. Hauptsache, sie flüstern Dir zu: „Ich bin hier, um dich zu unterstützen und zu verhindern, dass Du Dich verirrst. Es ist auch völlig OK, wenn ich mich verändere.“
Und wenn Du mit Deinen Stichpunkten nirgendwo hingelangst? Möglich, dass Dein Unterbewusstsein für Dich auf die Suche geht und Dir bald die Lösung eingibt.
4. Einladung: Deinem Wissen als Expert*in vertrauen
Recherchierst Du so lange, dass Deine eigenen Gedanken zu kurz kommen?
Umfassende Recherche führt nicht zwangsläufig zum besseren Text. Wenn wir uns reinsteigern, kann uns die Recherche sogar blockieren.
Leichter wird‘s, wenn Du erstmal aufschreibst, was Du weißt.
Wieso ich das behaupten kann? Ohne Wissen hättest Du Deinen Text nicht skizzieren können (siehe Einladung 3).
Die folgende Übung zeigt Dir, was ich meine. Sagen wir, wir sollen einen Text zu einem unbekannten Thema skizzieren, zum Beispiel „bioluminiszente Lebewesen“.
Puh.
Mir fiele sowas ein wie:
Eigenschaften
Lebensraum
Leuchtkraft (Latinum sei Dank)
Spannend ist der Aufbau nicht, von Storytelling bin ich weit entfernt. Hier würde eine ausführliche Recherche definitiv helfen.
(Wichtig ist trotzdem: Wir müssen keine Anthologien verfassen. Das wäre auch unfreundlich unseren Leser*innen gegenüber, denn zu viele Quellen und Unterpunkte verwirren.)
Bei vertrauten Themen aber können wir so vorgehen:
Wir wählen einen Aspekt unseres Themas aus. (Auch das können wir nur mit Vorwissen.)
Nach dem Schreiben recherchieren wir gezielt.
Das Vorgehen ist nicht nur leichter, sondern macht auch mehr Freude. Denn wir erleben, wie sich unser Wissen in Text verwandelt.
Ich habe übrigens schon oft erlebt, bei Kund*innen und mir selbst, dass wir positiv überrascht wurden. Was wir nicht alles wissen – aber vergessen hatten, dass wir es wissen!
5. Einladung: Weise wählen, wer Deinen Text beeinflusst
Du kannst Deinen Text alleine schreiben oder Du gehst in den Austausch. Ist beides legitim.
Wenn Du Dich austauschen möchtest, sind gesunde Grenzen … nun ja … gesund.
Hier lohnt es sich, wachsam zu sein:
1. Bei Menschen, die Dir Text-Feedback geben.
Statt Herrn Miesepeter von nebenan eignet sich eher jemand, die oder der selbst schreibt und deren Ansichten Du schätzt. Konstruktives Feedback erkennst Du daran, dass Du danach konkrete Aspekte Deines Textes verbessern kannst und Dich nicht weinend auf dem Klo verkriechen willst.
Mit konkreten Fragen machst Du es Dir und Feedback-Gebenden leichter. „Wie findest Du den Text?“ ist viel zu allgemein. Es birgt so viele Möglichkeiten für ungesundes Feedback wie Menschen Macken haben. Geeigneter sind Fragen wie: Sind meine Argumente schlüssig, die Übergänge flüssig, mein Schreibstil interessant?
2. Bei Künstlicher Intelligenz.
KI kann Dir helfen, Deine Leser*innen besser zu verstehen, Ideen zu wälzen, einen roten Faden zu stricken, Rechtschreibfehler zu korrigieren. Ihr Einsatz wird immer mehr Teil des Schreibprozesses werden – und das dürfen wir nutzen.
KI stößt an ihre Grenzen, sobald es um die Persönlichkeit geht. Nur Du kannst Deine Erfahrungen, Worte und Metaphern in Deine Texte einfließen lassen! So werden Deine Texte einzigartig. Das ist nicht nur wichtig, damit sie gelesen werden. Sondern auch, damit Du Dir die Freude am Schreiben erhältst.
3. Bei Dir selbst. Ha, erwischt! Sprichst Du freundlich mir Dir selbst? So grundsätzlich und speziell beim Schreiben? Auch Dein innerer Dialog trägt dazu bei, ob Du das Schreiben genießen kannst.
Und damit wäre ich bei der nächsten Einladung:
6. Einladung: Das Schreiben genießen
„Morgen blocke ich mir den ganzen Tag, um endlich meinen Text zu schreiben.“
Hast Du Dir das auch schonmal vorgenommen? Lass mich raten – es hat nicht geklappt. Oder Du musstest erstmal eine Schreibblockade lösen.
Du kannst Dich in einem Hotelzimmer einschließen, um ein Buch zu schreiben. Du kannst einen Tag lang ausschließlich an einem Text sitzen. Aber das führt dazu, dass Du einmal schreibst und selten wieder.
Motiviert bleibst Du, indem Du in kurzen Zeitblöcken schreibst (ja, auch zehn Minuten können reichen).
Ich kann Dir gar nicht sagen, wie viele Vorteile das hat. Hier meine Top zwei:
Es ist alltagstauglich und lässt sich lange durchhalten, ohne Dich zu überfordern.
Das PR-Ich, wie ich die innere Kritikerin nenne, hat weniger Chancen, dazwischen zu pfuschen. Dein Allrounder-Argument: „Das muss jetzt nicht perfekt sein. Denn morgen schreibe ich wieder.“
7. Einladung: Deinen Gut-genug-Text feiern
Was ist ein perfekter Text? ← Konnte mir bisher niemand überzeugend sagen.
Trotzdem trauen sich so viele Menschen nicht, ihre Texte zu veröffentlichen. Weil sie nicht perfekt sind.
Fragen wir mal umgekehrt: Wann hast Du je gedacht, dass es Texten anderer Autor*innen an Perfektion fehlt? Eben.
Überarbeitungsschleifen können endlos sein, und sie machen Texte nicht immer besser.
Du machst es Dir leichter, wenn Du „fertig“ definierst.
Nach einer halben Stunde? Nach zwei Überarbeitungen? Zum Abendessen? Und genau das gibt’s jetzt bei uns.
Ich hoffe, Du nimmst ein, zwei oder gleich sieben Einladungen zur neuen Freundlichkeit an.
Einmal Achtsamkeit und zurück: Ein kritischer Blick auf die Achtsamkeitsbubble
Achtsamkeit kann eine hilfreiche Praxis fürs Individuum sein, doch sie ist im Kern unpolitisch. Denn wenn jeder vor sich hin meditiert, journalt oder affirmiert – wer geht dann auf Demos und setzt sich für gesellschaftlichen Wandel ein? Im Blogartikel werfe ich einen kritischen Blick auf die Achtsamkeitsbewegung.
Als ich mich 2020 von Social Media verabschiedete, war ich vor allem eins: müde.
Jahrelange Dauerpräsenz in den sozialen Medien hat dafür gesorgt, dass ich keine Wochenenden, Feierabende oder Urlaub mehr hatte und den Kontakt zu mir und meinen Bedürfnissen (fast) verlor.
Und als ich – gerade nochmal rechtzeitig, bevor ich „so richtig“ erkrankte – die Reißleine zog, war Achtsamkeit wie ein Rettungsboot. Vor allem mit …
der Erinnerung, meine Bedürfnisse, Gefühle und meinen Atem wieder in den Fokus zu nehmen und radikal zu akzeptieren, was ich da finde.
den vielen hilfreichen Gewohnheiten, mit denen ich besser abschalten und in Balance bleiben konnte.
der Verbindung, die ich wieder zu mir bekam, nachdem Instagram und Co. mir das jahrelang abtrainierten.
Hätte ich damals die Achtsamkeit nicht entdeckt – wer weiß, was passiert wäre?
Deshalb habe ich auch auf dieser Website hin und wieder über Achtsamkeit geschrieben und zwei Jahre lang eine Mastermind für „Achtsames Marketing“ angeboten.
Doch irgendwann – ich kann gar nicht genau sagen, wann das war – begann ich, die vielen Probleme zu sehen, die es in der Achtsamkeitsbubble gibt. Und in mir entstand der Wunsch, mich von dieser Bubble zu distanzieren.
Aber der Reihe nach:
Achtsamkeit kann eine hilfreiche Praxis fürs Individuum sein
Noch immer halte ich eine achtsame Haltung gegenüber sich selbst, anderen Menschen und dem Planeten für eine wunderbare Art und Weise, durchs Leben zu gehen. Einen Blick dafür zu haben, was wir, andere Menschen und unsere Welt brauchen – das kann aus jeder erdenklichen Perspektive nur sinnvoll sein.
Deshalb finde ich die Grundgedanken der Achtsamkeit immer noch wichtig und richtig – auf einer individuellen Ebene.
Jedes Individuum darf für sich entscheiden, welche der vielen Werkzeuge, die das Konzept der Achtsamkeit bietet, hilfreich sind, um in Kontakt mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen zu kommen (oder zu bleiben).
Das kann Meditation sein oder Yoga. Journaling oder Affirmationen. Spezielle Atemtechniken oder Dankbarkeitstagebücher. Doch das kann auch etwas ganz anderes sein.
„Ich dachte von dir immer, du meditierst jeden Morgen und schreibst in einem Dankbarkeitstagebuch und so Sachen“, sagte mal eine Kollegin zu mir. Da musste ich doch sehr lachen.
Mein Alltag ist mehr Heavy Metal als Meditation. Und ich lese öfter seichte Romane, als dass ich in ein Dankbarkeitstagebuch schreibe. Dennoch fühlt sich das für mich im Großen und Ganzen nach einem „achtsamen“ und präsenten Leben an – auf meine eigene Weise eben.
Doch egal, wie eine Achtsamkeitspraxis nun im Einzelnen aussehen mag, sie hat Grenzen – und genau das ist das erste Problem, auf das ich auf meiner Achtsamkeitsreise gestoßen bin:
Die Achtsamkeitsbubble ist im Kern unpolitisch
Wenn jetzt jede*r vor sich her meditiert, journalt und affirmiert – wer stürzt dann das Patriarchat? Wer setzt sich gegen Neonazis ein und für Demokratie? Wer geht auf Demos?
„Du hast selbst die Wahl, ob du das Geschirrspülen genießt oder dich darüber aufregst“, hab ich sinngemäß mal in einem Achtsamkeitsbuch (von einem Mann geschrieben) gelesen. Wirklich? Und zu den gesellschaftlichen Strukturen, die Frauen mehr Geschirrspülen als Männern aufbürden, gibt es dann rein gar nichts mehr zu sagen? Schon praktisch.
Natürlich will ich damit nicht sagen, dass Achtsamkeit und gesellschaftlicher Wandel oder Aktivismus sich grundsätzlich ausschließen. Grundsätzlich ist natürlich auch vorstellbar, dass jemand morgens meditiert und abends ehrenamtlich geflüchteten Menschen hilft.
Doch in der Praxis hat ein Tag nun mal 24 Stunden und wenn ich diese Stunden damit verbringe, mir passende Apps für meine Achtsamkeitspraxis rauszusuchen, habe ich möglicherweise weniger Zeit, Energie und Headspace, um mich mit anderen Themen zu beschäftigen.
Mir ging es zumindest so.
Ich war lange Zeit in dieser Ommmm-Blase gefangen und so mit Ein- und Ausatmen beschäftigt, dass ich nicht mehr wahrnahm, was da um mich in der Welt alles passierte.
Spiritual Bypassing nennt sich das und meint, dass alles „Negative“, was einem auf dem erleuchteten Weg stört, aus dem Leben eliminiert wird.
„Ich konsumiere schon seit X Jahren keine Nachrichten mehr“ ist in diesem Zusammenhang eine Auszeichnung, mit der immer noch (zu) viele Achtsamkeitscoaches prahlen und „Was, du liest immer noch Nachrichten?“ eine Frage, die Menschen sofort in eine Rechtfertigungsposition bringt und den Eindruck erweckt, dass sie halt „selbst Schuld“ daran sind, wenn ihnen angesichts der Weltlage mal nicht die Sonne aus dem Popo scheint.
Doch wir können es uns nicht mehr erlauben, unpolitisch zu sein – auch als Selbstständige*r.
Denn die Demokratie und die Werte, für die wir als Gesellschaft stehen, werden gerade ernsthaft bedroht. Das ist keine Übertreibung. Und das ist keine Übung.
Gerade in letzter Zeit passieren Dinge, die 2024 wirklich nicht mehr passieren sollten.
Wir können es uns nicht mehr erlauben, uns in unser stilles Kämmerlein einzusperren und den Weltschmerz wegzuatmen oder ihn gar nicht mehr an uns ranzulassen. Wir müssen laut und aktiv werden – jetzt.
Für mich haben soziale Medien, die Hass, Hetze und Falschinformationen mit Reichweite belohnen und die Möglichkeit zu Mikrotargeting bieten, einen großen Anteil daran, dass Europa und Deutschland wieder nach rechts rücken. Deshalb „nerve“ ich weiterhin Menschen mit diesem Thema und werde nicht müde, darüber auf dem Blog und im Newsletter zu schreiben oder auf dem Podcast zu sprechen.
Es wird viel Unfug im Namen der Achtsamkeit getrieben
Kennt eigentlich noch jemand die Ursprünge der Achtsamkeit? Sie liegen im Buddhismus und ganz wichtig: Achtsamkeit ist dort keine herausgelöste, für sich stehende Technik, sondern eingebettet in Fragen der Ethik.
Löst man Achtsamkeitstechniken nun völlig aus ihrem Kontext, geht das nicht immer gut.
Die Achtsamkeitsbubble ist – wie vermutlich jede Bubble – wild durchmischt. Reflektierte Achtsamkeitsansätze sind genauso Teil der Bewegung wie pseudowissenschaftliche, esoterische oder allgemein völlig unkritische Ansätze.
Ich bin mehr als einmal mit Menschen in Kontakt gekommen, die wirklich wilde Theorien vertraten, und ich musste höllisch aufpassen, dass ich nicht zu tief in den Kaninchenbau falle und auf einer Seite auftauche, auf der ich eigentlich gar nicht sein will.
Wo Achtsamkeit draufsteht, ist auch nicht immer Achtsamkeit drin. Wenn große Unternehmen mit ausbeuterischen Strukturen der Belegschaft ein Achtsamkeitstraining spendieren, aber nichts an den Strukturen ändern, ist das genauso, wie wenn ein Unternehmen sich ein grünes Image aufbaut, während es weiterhin munter die Umwelt verschmutzt: ein Widerspruch, den man Achtsamkeitswashing nennen könnte.
Und dann so zu tun, als wäre das Individuum dafür verantwortlich, dass es ihm in ausbeuterischen Strukturen gut geht, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf.
Nicht nur große Unternehmen, sondern auch namhafte Achtsamkeitscoaches sind davor nicht gefeit. Achtsamkeit ist eben zur lukrativen Nische geworden und manch eine*r scheint zu denken, dass der Zweck die Mittel heiligt.
Überhaupt ist die Achtsamkeitsbewegung extrem kompatibel mit der Hustle Culture und der neoliberalen Logik: Statt Strukturen zu verändern, geht es darum, dass das Individuum durch Atemtechniken und Co. besser mit Hustle Culture zurechtkommt.
Im Grunde bleibt also alles so, wie es ist, nur dass ich abends etwas besser einschlafen kann …
Achtsamkeit und ich
Fazit: Auf einer individuellen Ebene kann Achtsamkeit eine wunderbare Möglichkeit sein, mit der VUCA- oder sogar BANI-Welt zurechtzukommen. Und wen soziale Medien überfordern, findet eine Menge Werkzeuge, die dabei helfen können, seine Bedürfnisse zu spüren und wieder in Balance zu kommen.
Doch – und das ist für mich das Entscheidende – was passiert dann?
Gehe ich – gestärkt durch meine Achtsamkeitspraxis – mit meinen Themen nach draußen, suche Verbindung zu anderen, versuche gezielt, etwas in der Welt zu verändern? Werde ich aktiv?
Oder kapsel ich mich ab, rede mir ausbeuterische gesellschaftliche Strukturen schön und lasse überhaupt keine Weltereignisse mehr an mich heran? Geht es mir nur noch um „Good Vibes“? Verfestige ich sogar ausbeuterische Strukturen, indem ich ausnahmslos dem Individuum die volle Verantwortung für sein Wohlergehen zuweise, und ihm sage „Meditieren ist die Lösung“?
Ich will jedenfalls nicht zu dieser zweiten Gruppe gehören. Oder auch nur den Anschein erwecken, dass ich unter Umständen zur zweiten Gruppe gehören könnte. Das tue ich nämlich nicht.
Ich will von Social Media erschöpften Menschen nicht sagen: „Atme den Social-Media-Stress doch einfach weg.“
Ich will ihnen vielmehr zeigen, wie die Strukturen sozialer Medien überhaupt erst zu dieser Erschöpfung beitragen. Und dass es eine valide Möglichkeit ist, Social Media zu kritisieren, zu boykottieren und vielleicht sogar zu verlassen.
Deshalb wird Achtsamkeit weiterhin ein Teil meines privaten Lebens bleiben, aber es wird nicht (mehr) das sein, worum all meine Gedanken kreisen und worum es hier auf meiner Website gehen soll. Dafür ist mir der gesellschaftspolitische Aspekt an Social Media zu wichtig.
Und ist Marketing, das ethisch ist und nicht mit der Psyche der Menschen spielt, nicht automatisch auch achtsam? Marketing, das Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellt, muss umgekehrt nicht immer ethisch sein …
Content-Fatigue: Ich bin so müde
Ich habe Content-Fatigue. Will heißen: Ich bin müde von dem immergleichen, aalglatten, nichtssagenden „Content“, den ich online finde. Ich will etwas lesen, das nach etwas schmeckt und riecht, das Ecken und Kanten hat, an denen ich mich festhalten kann …
Ich habe Content-Fatigue.
Will heißen: Ich bin müde von dem immergleichen, aalglatten, nichtssagenden „Content“, den ich online finde.
Ich will etwas lesen, das nach etwas schmeckt und riecht, das Ecken und Kanten hat, an denen ich mich festhalten kann. Etwas, was ich nicht gleich wieder vergesse, sobald ich auf das nächste Suchergebnis klicke.
Ich habe Contentplan-Fatigue.
Will heißen: Ich bin müde von Redaktionsplänen, die mir sagen, wann ich was wie zu „produzieren“ habe. Wann mein Blog, Podcast oder Newsletter befüllt werden muss. Und womit.
Ich will etwas veröffentlichen, weil alles in mir darauf drängt, es zu tun. Weil die Botschaft zu wichtig ist, um sie nicht zu teilen. Weil ich es will – nicht weil ich es muss. Weil es mir gerade in den Kram passt – nicht weil der Plan es sagt.
Ich habe Content-Marketing-Fatigue.
Will heißen: Ich bin müde von der Art von Marketing, die sich hohler Marketingphrasen bedient, statt wirklich etwas zu sagen. Marketing, bei dem das, was man schreibt oder sagt, nur einen Zweck hat: zu verkaufen.
Ich will etwas schreiben, das nicht nur im Kontext meiner Produkte Bedeutung hat, sondern darüber hinaus. Etwas, das für sich steht. Etwas, das auch abgesehen von Marketing einen Wert hat.
Was ist das überhaupt für ein seltsames Wort … „Content“. Als ob es etwas Besonderes wäre, dass unsere Worte und Sätze einen „Inhalt“ haben, dass sie etwas bedeuten.
Deshalb rede ich bereits seit einiger Zeit nicht mehr von „Content“. Auch im Marketingkontext. Und auch, als ich den Schreibcircle konzipierte, hatte ich keinen „Content“ im Sinn.
Ich will nicht noch mehr „Contentproduziermaschinen“ ausbilden, die wie am Fließband den immergleichen „Content“ erstellen und ihn dann auf ihren Kanälen teilen. Ich will das Gegenteil:
Dass wir verlernen, Content zu erstellen.
Ich will wieder von „Worten“ und „Texten“ sprechen, wenn wir Marketing betreiben.
Ich will, dass wir Freude spüren, wenn wir Marketingtexte schreiben – nicht Druck oder gar Angst.
Ich will, dass wir uns erlauben, wieder so zu schreiben, wie Schreiben eigentlich gedacht ist: von Mensch zu Mensch. (Und nicht von Contentproduziermaschine zu Mensch. Oder von KI zu Mensch.)
Ich glaube nämlich, dass wir gerade ganz dringend mehr davon brauchen:
Menschlichkeit
Kommunikationstipps für Selbstständige von Rhetoriktrainerin Beatrix Schwarzbach
Wie kommunizieren Selbstständige erfolgreich mit ihren Kund*innen, als Speaker*in oder in ihrem Podcast? Ich habe Rhetoriktrainerin Beatrix Schwarzbach interviewt und sie nach Kommunikationstipps und Rhetoriktipps gefragt.
Beatrix Schwarzbach ist Kommunikations- und Rhetoriktrainerin. Sie fasziniert die Frage, wie Menschen sich optimal ausdrücken und einander wirklich verständlich machen können. Außerdem liebt sie es, mit Menschen an ihrer Bühnen-Performance und ihrer Auftrittswirkung zu arbeiten. Mehr zu ihrer Arbeit findest du auf ihrer Website.
Liebe Beatrix, wer Marketing macht, will natürlich, dass Marketing Wirkung zeigt. Doch wie können wir andere Menschen von uns überzeugen, ohne Druck auszuüben oder gar zu manipulieren? Was ist deine Position als Rhetoriktrainerin dazu?
In der Rhetorik ist das Thema „Überreden oder Überzeugen“ ein Dauerbrenner. Meine Position dazu ist diese: Wenn wir eine andere Person zu etwas überreden, dann benutzen wir Druck; wir ziehen an ihr, schubsen, schieben oder versuchen immer noch ein Argument mehr zu liefern.
Das kann natürlich dazu führen, dass das Gegenüber kurzfristig in unserem Sinne handelt (etwas kauft, etwas bucht oder eine andere gewünschte Handlung vollzieht) – doch wenn wir jemand anderen zu etwas überreden, wird immer so eine Art Restwiderstand bleiben. Eine innere Haltung von: „Das ist nicht so, wie ich das wollte. Das ist nicht meins.“ Daraus entstehen später oft Konflikte oder der Eindruck, dass die Zusammenarbeit einfach nicht so richtig gut läuft.
Wenn wir jemand anderen jedoch von etwas überzeugen, dann kommt die andere Person freiwillig, aus eigener Entscheidung, auf unsere Seite. Es ist so, als wäre da eine Brücke, über die das Gegenüber aus freien Stücken zu uns auf die andere Uferseite marschiert. Das führt zu einer inneren Haltung von: „Das ist meine eigene Entscheidung und ich stehe dahinter.“
Auf Marketing übertragen, denke ich, sollte das bedeuten: Tue alles, was du kannst, damit du gut gefunden wirst und sich Interessierte optimal über dein Angebot informieren können. Tue alles, damit sie dich kennenlernen und einschätzen können. Strecke die Hand aus, baue Brücken. Sei aufmerksam, ob du etwas „zu sehr“ willst und vielleicht mehr anschiebst, als sinnvoll und gesund ist. Innerer und äußerer Druck sind Warnsignale.
Sei da, sei erreichbar, hab Geduld.
Die richtigen Leute kommen zu dir.
Und schließlich ist es auch am einfachsten, schönsten und nachhaltigsten, mit Menschen zu arbeiten, die sich wirklich von sich aus dafür entschieden haben.
Viele Selbstständige haben einen Podcast – wie können sie beim Sprechen ihre Kompetenz hörbar machen?
Damit Kompetenz hörbar wird, dürfen beim Sprechen einige Dinge zusammenwirken.
Zum einen überträgt sich Kompetenz durch strukturiertes Sprechen. Das kann bei einem Podcast bedeuten: eine klare Einleitung und Hinführung zum Thema. Aussprechen der Agenda. Strukturiertes Durchleiten durch die Infoblöcke, die eigenen Gedanken oder das Interview. Zusammenfassung und erinnerungswürdigen Abschluss. Das alles klappt natürlich nur durch eine gute Vorbereitung.
Hilfreich kann sein, sich immer wieder diese Frage zu stellen: Als WER spreche ich heute zu WEM aus welchem ANLASS und mit welchem ZIEL?
Zum anderen überträgt sich Kompetenz-Wirkung sprecherisch so: Variables Sprechtempo (nicht nur schnell oder nur langsam, sondern situativ angemessen), deutliche Pausensetzung, eher kurze Sätze. Am Ende eines Satzes sollte dieser Satzabschluss auch hörbar sein: Die Stimmmelodie geht nach unten; die Stimme in die Lösungstiefe.
All diese sprecherischen Parameter suggerieren dann auf der sogenannten paraverbalen Ebene: „Ich weiß wirklich, wovon ich spreche.“ Und das wird als kompetent wahrgenommen.
Die einfachste Art, das sprecherisch umzusetzen, ist: Klare Pausen machen und damit das Gesagte wirken lassen.
Hast du einen Trick, wie wir Füllwörter wie „eigentlich“, „eben“ usw. beim Sprechen loswerden können? Ich frage für eine Freundin.😅
Um Füllwörter loszuwerden, muss uns erstmal bewusst werden, welche wir benutzen – und wann. Das kann durch eine wertschätzende Rückmeldung von Kolleg*innen oder Partner*innen passieren – oder eben im Rhetoriktraining. Manchmal macht es auch Sinn, sich eine eigene, längere Sprachnachricht nochmal anzuhören.
Viele Füllwörter schleichen sich ein, wenn wir die eigenen Aussagen abschwächen (oder manchmal auch verstärken) wollen, um etwa nicht zu „streng“ oder direktiv rüberzukommen. Das folgt dann dem Motto: Bloß niemandem auf die Füße treten. Beispiele sind Wörtchen wie die von dir oben erwähnten: Eigentlich, tatsächlich, sozusagen, wirklich …
Andere Füllsel sind „äähm“ oder auch „genau“. „Ähm“ ertönt oft am Anfang eines Sprechabschnitts oder in Pausen, in denen der Satz weitergedacht wird. Dieser Laut liegt also über einem Denkprozess drüber. „Genau“ wiederum ist wie das rückwärtige Nachdenken am Ende eines Sprechabschnitts; verbunden mit der inneren Frage: „Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte?“
Nach einer ersten Rückmeldung und Analyse können wir lernen, uns selbst beim Sprechen genauer zuzuhören, Pausen auszuhalten – und mit mehr Sicherheit zu formulieren. Meistens bringt auch ein intentionaleres, zielgerichteteres Sprechverhalten (für WEN spreche ich?) viel. Klar verstehe ich den Wunsch nach einem schnellen Trick: Doch die Füllwörter sind auch nicht plötzlich in unsere Sprache reingekommen, sondern wurden hinein-wiederholt, so lange, bis wir sie gar nicht mehr bemerken.
Um sie wieder loszulassen, braucht es Bewusstheit – und etwas Übung in die andere Richtung: durchatmen, denken, sprechen.
Mir persönlich ist Smalltalk ja immer ein Graus. Doch gerade als Selbstständige kommen wir nicht immer drum herum, z.B. auf Netzwerkveranstaltungen. Wie wird Smalltalk für alle Beteiligten entspannter – und wirkungsvoller?
Ich kann dich da total verstehen – auch ich habe früher tendenziell versucht, Smalltalk-Situationen aus dem Weg zu gehen. Ich unterhalte mich einfach gerne „tiefer“ mit Menschen.
Hilfreich kann sein, wenn wir uns klarmachen, dass es beim Smalltalk nicht darum geht, Daten und Fakten auszutauschen oder sich selbst anzupreisen, sondern eine wirkliche Verbindung zu den Menschen herzustellen.
Das klappt am besten, wenn wir mit einer inneren Haltung von Neugier oder Interesse in diese Netzwerk-Situation hineingehen. Wer ist da? Wer sind die anderen? Am Anfang meiner Selbständigkeit habe ich mir für jede Netzwerkveranstaltung auch vorgenommen: Ich werde mindestens mit einer Person wirklich sprechen.
Ein Startpunkt können gemeinsame Beobachtungen in der Situation sein: Die liebevoll hergerichtete Location, die toll dekorierten Brownies, der inspirierende Input der Gastgeberin. Dann hat man einen gemeinsamen, situativen Nenner und muss nicht sofort fragen: „Und, was machst du so?“
Smalltalk ist eine Chance, etwas über andere zu erfahren – und sich auf leichte, positive Art mit ihnen zu verbinden. Ich habe bis heute Kontakt zu zwei Frauen, die ich auf den ersten beiden Netzwerkveranstaltungen getroffen habe, zu denen ich als neue Selbständige gegangen bin. Ein Netzwerk baut sich nicht über Masse auf, sondern über wirklichen Kontakt zu einzelnen Menschen.
Spätestens seit Covid sind Videokonferenzen aus dem Arbeitsalltag von Selbstständigen nicht mehr wegzudenken. Inwiefern sollte ich in Videokonferenzen auf meine Körpersprache achten? Und wie kann ich souverän mit Zwischenfragen umgehen?
Bei Videokonferenzen auf Körpersprache zu achten, ist sehr wichtig! Die Kamera „schluckt“ viel von der Wirkung und Präsenz, und da sollte sehr bewusst gegengesteuert werden. Alles fängt mit der optimalen Ausrichtung der Kamera an: Du solltest vom Scheitelpunkt bis etwa zum oberen Brustbereich gut sichtbar sein. Die Kamera sollte so eingestellt sein, dass du „auf Augenhöhe“ reinsehen kannst, damit direkte Blicke in die Kamera gut möglich sind. Damit bekommen wir zwar noch immer keinen wirklichen Blickkontakt hin, aber die Wirkung ist so ähnlich wie „in echt“.
Dann solltest du mit den Armen nicht am Tisch kleben, sondern etwas Raum vor dir haben, damit auch Gestik möglich ist und du deine Worte wirkungsvoll mit Arm-Hand-Bewegungen unterstreichen kannst. Außerdem sollten leichte ganzkörperliche Bewegungen sowohl nach vorne in Richtung Kamera als auch nach hinten zur Stuhllehne möglich sein. So lässt sich in einem Meeting auch nonverbal kommunizieren: „Ich will dazu etwas sagen.“ vs. „Ich bin fertig und lehne mich zurück.“
Außerdem achte darauf, dass die Lichtverhältnisse so gut sind, dass die Mimik optimal erkennbar ist. Hier lohnt es sich, mit einem Ringlicht zu arbeiten.
Zwischenfragen sehe ich erstmal immer sehr positiv: Meistens entspringen sie auf Publikumsseite einem Wunsch nach mehr Wissen, nach mehr Verständnis. Es ist schlau, sie kurz und klar zu beantworten, damit dann alle weiterhin dabei sind und mitkommen. Dennoch kann eine Zwischenfrage auf Sprecher*innen-Seite erstmal irritierend wirken. Hier hilft klare Metakommunikation, um Orientierung für sich und andere zu schaffen: „Ich habe Ihre Frage gesehen.“, „Ich führe noch diesen Gedanken zu Ende.“ (...) „Vorhin waren wir gerade bei Punkt XY, da steige ich jetzt wieder ein …“
Und was ist, wenn Kommunikation mal nicht so gut läuft? Kann ich Schlagfertigkeit eigentlich üben? Oder bin ich als introvertierter oder schüchterner Mensch für immer dazu „verdammt“, den Kürzeren zu ziehen?
Jaaa, Kommunikation lässt sich üben. Schlagfertigkeit lässt sich üben.
Wenn Kommunikation nicht gut läuft, hilft es, erstmal das Ganze in den Blick zu nehmen: Was waren die jeweiligen Ziele in der Sprechsituation? Wo sind vielleicht verschiedene Bedürfnisse miteinander kollidiert? Mit welcher kommunikativen Strategie hätten wir klarer zusammengefunden?
Erfolgreiche Kommunikation bedeutet ja nicht, dass sich einfach das bessere Argument durchsetzt. Vielmehr ist es immer ein Prozess des Verstehens - und Verstanden-Werdens. Und das kann auf der Strategie-Ebene bedeuten, dass sich Zuhören und Sprechen, Reden, Fragen-Stellen, das Wiederholen in eigenen Worten, abwechseln.
Und wenn es um Schlagfertigkeit geht, dann würde ich sagen: Nicht für alle ist schnelles Kontern die ideale Strategie. Es gibt so viele Techniken mehr! Gerade introvertierte oder schüchterne Menschen sollten verschiedene Ansätze ausprobieren und die, bei denen es „Klick“ macht, verfeinern. Manchmal ist es auch sehr wirkungsvoll, eine schwierige Aussage in eigenen Worten zu wiederholen, um einen „Puffer“ zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion – und dann erst das eigene Statement anzuschließen.
Und was empfiehlst du bei Redeangst oder Lampenfieber?
Wichtig bei Sprechängsten ist erstmal der Wille, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich etwas zu verändern, um aus etwaigem Flucht- oder Vermeidungsverhalten rauszukommen. (Lampenfieber beschreibt eine mildere Form der Aufregung, die die meisten Menschen gut abfedern können und die nicht dazu führt, sich vor einer Sprechsituation zu drücken.)
Akzeptanz der Angst hilft: „Ah, da ist Angst. Es ist mir wichtig, dass ich heute gut ankomme.“
Außerdem ist es sinnvoll, sich mit dem eigenen Körperausdruck in so einer Stress-Situation zu beschäftigen: Lernen, trotz der Anspannung Blickkontakt aufzubauen und Gestik zu benutzen, sowie eine präsente Haltung einzunehmen.
Und dann hilft natürlich Übung: Eine bevorstehende Präsentation mehrmals durchsprechen oder lernen, strukturierter zu sprechen. Außerdem ist es gut, sich Feedback einzuholen und der Frage nachzugehen: Wieviel von der innerlich so bedrängenden Angst dringt denn wirklich nach außen? Oft lässt sich dann nämlich feststellen, dass die äußere Wirkung ganz anders ist – und daraus kann dann eine neue Sprech-Sicherheit entstehen.
Ich merke, dass viele Menschen anfangen, sich mit der Redeangst zu beschäftigen, wenn die Kosten der Vermeidung zu groß werden oder wenn etwas wirklich Wichtiges ins Haus steht: Die Einladung zu einer Podiumsdiskussion oder in einen Podcast, der Vortrag bei einer Netzwerkveranstaltung. Das sind super Gelegenheiten, um die Redeangst anzugehen und an dieser neuen Herausforderung zu wachsen. Also: Alles zusagen, sich genau vorbereiten – und als Chance begreifen! Und dann natürlich: Den Erfolg feiern und sich so eine neue Historie von toll bewältigten Sprechsituationen aufbauen.
Wie können Selbstständige mit „schwierigen“ Kund*innen umgehen und was können sie konkret bei Beleidigungen oder Angriffen tun?
„Schwierige“ Kund*innen können natürlich eine Herausforderung sein. Ich denke, im ersten Schritt kann es hilfreich sein, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Das kann durch Fragen passieren, durch genaues Zusammenfassen des Gehörten, durch besonders verständliches Sprechen (kurz, strukturiert, die Frage beantwortend: „Was hast du davon, wenn du mir zuhörst / mir in meiner Lösung des Problems folgst?“).
Die meisten Menschen fühlen sich unwohl, wenn Konflikte hochkochen oder die Dinge schwierig werden. Doch wenn Sichtweisen kollidieren, dann stecken oft verschiedene Zielvorstellungen oder auch unerfüllte Bedürfnisse dahinter. Ein klärendes Gespräch sollte also immer der erste Schritt sein. Auch, um die „Beziehungsebene“ zu sichern, ist es wichtig, eine Lösung zu finden.
Wenn dann dennoch Beleidigungen, Angriffe, Schuldzuweisungen den Gesprächsverlauf bestimmen, dann gilt es, klare Grenzen zu setzen: „Das ist ein Angriff.“ / „Mir gefällt der Tonfall in diesem Gespräch nicht.“ / „Diese Anschuldigung weise ich zurück.“ Vertritt deine Grenzen am besten mit klarer, fester Stimme und einem präsenten Körperausdruck. Danach solltest du eine Vorstellung haben, wie es weitergehen soll: Willst du die Zusammenarbeit nochmal auf andere Füße stellen? Sollen Aufgabenbereiche modifiziert werden? Was ist dein Ziel in diesem Gespräch?
Was ich meinen Klient*innen rund um das Thema eskalierende Gesprächssituationen auch immer zu vermitteln versuche: Wenn es auf der anderen Seite keine wahrnehmbare Gesprächsbereitschaft gibt, dann ist es auch ein (letztes) Mittel, das Gespräch abzubrechen. Niemand muss sich beleidigen oder angreifen lassen.
Vielen Dank für das Interview, liebe Beatrix!
Was Emotionsarbeit mit unserer Selbstständigkeit zu tun hat
Was ist Emotionsarbeit, was hat das mit Selbstständigkeit, Social Media und Dienstleistungen zu tun und wie können wir mit den Auswirkungen und Herausforderungen von Emotionsarbeit zurechtkommen?
Hast du schon einmal locker, flockig in die Kamera für eine Instastory gesprochen und so getan, als wärst du bester Laune, obwohl dir gerade eigentlich eher nach Heulen zumute war?
Warst du schon einmal freundlich zu einem Kunden, obwohl du ihn aufgrund seiner problematischen Aussagen am liebsten zum Mond geschossen hättest?
Hast du auch schon mal eine Kollegin angelächelt, obwohl dir gerade gar nicht nach lächeln war?
Wenn du diese oder ähnliche Situationen schon einmal erlebt hast, dann hast du bereits Bekanntschaft mit Emotionsarbeit gemacht.
Was Emotionsarbeit ist, was es mit der Selbstständigkeit und Social Media zu tun hat und warum es so wichtig für Selbstständige ist, sich der geleisteten Emotionsarbeit bewusst zu werden, möchte ich in diesem Blogartikel zeigen.
Was ist Emotionsarbeit?
Emotionsarbeit ist ein Konzept, das in der Soziologie und Psychologie eine immer größere Bedeutung erlangt. Im Kern geht es um die Anstrengungen, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, auszudrücken oder zu modifizieren, um sozialen Erwartungen gerecht zu werden.
Emotionsarbeit tritt in verschiedenen Bereichen des Lebens auf: auf der Arbeit, in der Partnerschaft, in der Eltern-Kind-Beziehung oder auf Social Media.
Emotionsarbeit als Selbstständige
Gerade in Dienstleistungs- und Serviceberufen haben Selbstständige häufigen Kontakt zu anderen Menschen. Per E-Mail, in Zoom, auf Social Media oder persönlich. Und natürlich geht diese Arbeit mit verschiedensten emotionalen Zuständen einher:
Manchmal geht es uns gerade nicht gut. (Wir fühlen uns traurig, wütend, gestresst, leer oder irgendwas dazwischen.)
Manchmal geht es unserem Gegenüber nicht gut (Er fühlt sich traurig, wütend, gestresst, leer oder irgendwas dazwischen.).
Doch egal, wie es uns oder unserem Interaktionspartner geht – die meisten Selbstständigen bemühen sich in solchen Situationen, professionell zu bleiben und das heißt: freundlich, empathisch, zurückhaltend.
Und so haben wir selbst in Zeiten größter persönlicher Herausforderungen ein Lächeln für unsere Kund*innen übrig. Oder bleiben ruhig, selbst wenn es – angesichts eines doofen Spruchs – innerlich in uns tobt.
Emotionsarbeit auf Social Media
Auch auf Social Media findet Emotionsarbeit statt.
Jemand findet in einem Kommentar nicht gerade nette Worte für uns – wir schlucken’s runter und versprühen weiterhin „Good Vibes“.
Und auch der Druck, ständig glücklich, erfolgreich und positiv zu erscheinen, führt zu einer verstärkten Emotionsarbeit, denn – surprise, surprise – wir sind nicht jeden Tag glücklich, erfolgreich und positiv.
Es gibt viele weitere Formen emotionaler Arbeit auf Social Media:
Vergleich: Wir vergleichen jeden Aspekt unseres Berufslebens mit anderen und müssen mit Gefühlen wie Unzulänglichkeiten klarkommen.
Inszenierung: Wir stellen uns anders da, als wir wirklich sind. Manchmal ist die Abweichung minimal. Manchmal etwas größer. Was macht das mit unseren Gefühlen?
Bewertungen: Likes oder keine Likes, positive, negative oder gar keine Kommentare. Wir werden auf Social Media ständig bewertet – das ist nicht immer angenehm. Kritik oder Anfeindungen erfordern emotionale Resilienz.
Erwartungen: Was, wie und wie oft wir posten – unsere Follower haben ganz konkrete Erwartungen und lassen es uns öfter auch wissen, wenn wir ihre Erwartungen enttäuscht haben. Wie geht es uns dabei? Reden wir mit jemandem darüber?
Privatsphäre: Selbstständige müssen ständig entscheiden, wie viel von sich selbst sie auf Social Media zeigen wollen. Das erfordert Emotionsarbeit.
Andere Formen der Emotionsarbeit
Auch eine Migrationsgeschichte kann bedeuten, zusätzliche Emotionsarbeit leisten zu müssen. Neben Marketing, Buchhaltung und der Zusammenarbeit mit Menschen geht es bei Selbstständigen mit Migrationsgeschichte oft auch darum, aktuelle Ereignisse wie Krieg und Krisen zu verarbeiten oder mit Traumata umzugehen.
Auch aus feministischer Perspektive ist Emotionsarbeit wichtig. Denn es sind häufig Frauen, die – in der Familie oder im Büro – Streit schlichten, vermitteln oder für Harmonie sorgen.
Die Auswirkungen von Emotionsarbeit
Warum ist es für Selbstständige nun so wichtig, über Emotionsarbeit Bescheid zu wissen?
Zunächst einmal: Weil Emotionsarbeit auch Arbeit ist. Selbst wenn sie nicht bezahlt, nicht wertgeschätzt und oft auch nicht gesehen wird, erfordert Emotionsarbeit unsere Zeit, Energie und manchmal auch Geld.
Das kann dazu führen, dass wir uns müde fühlen, ja regelrecht erschöpft und ausgebrannt. Selbst wenn wir nicht viele Termine haben und eigentlich nur im Homeoffice arbeiten.
Eng mit der Emotionsarbeit verknüpft ist auch das Konzept der emotionalen Dissonanz.
Emotionale Dissonanz tritt auf, wenn es eine Spannung gibt zwischen den tatsächlichen Emotionen und den Emotionen, die gezeigt oder ausgedrückt werden.
Klassisches Beispiel: Aufgrund einer Trennung oder eines Todesfalls ist jemand zutiefst traurig, zwingt sich aber dazu, auf Instagram „Good Vibes“ zu versprühen. Das erzeugt einen inneren Konflikt, der dann noch mehr Emotionsarbeit benötigt.
Manchmal kann der Erwartungsdruck auf Social Media, ständig gut gelaunt zu sein, sich bis ins Toxische steigern, was wiederum zu verstärkter Emotionsarbeit führen kann. Denn die Erwartung, immer glücklich oder positiv zu sein, heißt oft, die tatsächlich erlebten Gefühle zu unterdrücken oder zu verstecken.
Was ist im Hinblick auf Selbstständigkeit und Emotionsarbeit wichtig?
Es geht nicht darum, Emotionsarbeit abzuschaffen. Im Gegenteil: Emotionsarbeit ist notwendig für eine Gesellschaft.
Wem als Selbstständige*r psychische Gesundheit wichtig ist, sollte aber erst einmal ganz grundlegend anerkennen und auf dem Schirm haben, dass es Emotionsarbeit gibt und dass sie geleistet wird. Oft jeden Tag.
Vor allem bei Selbstständigen in Dienstleistungsberufen, auf Social Media, mit Migrationsgeschichte oder bei Selbstständigen mit Kindern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Emotionsarbeit einen großen Teil der Zeit und Energie beansprucht. (Und Introvertierte können Emotionsarbeit vielleicht sogar noch zusätzlich als anstrengender empfinden.)
Was mir persönlich geholfen hat, war bekanntermaßen, Social Media zu verlassen und in meinem Marketing auf Social-Media-freie Plattformen zu setzen.
Ansonsten ist authentischer Selbstausdruck oft die beste Prävention. Und in einem akuten Fall von Erschöpfung heißt es: gut zu sich sein, ausruhen und Auszeiten einlegen. Auch wenn das bedeutet, nicht so schnell voranzukommen, wie die schnelllebige Welt das von uns will.
Selbstständig mit Migrationsgeschichte: Was unsere Herkunft mit unserer Selbstständigkeit zu tun hat
Knapp jede vierte unternehmerisch tätige Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Was bedeutet die Einwanderungsgeschichte für Selbstständige? Wie zeigt sich die Herkunft im Arbeitsalltag?
Als ich nach Deutschland kam, war ich fast acht Jahre alt und kannte genau zwei deutsche Wörter: „Banane“ und „Nudelsuppe“.
„Banane“, weil das für meine Familie das Symbol des Westens war. („Stell dir vor: In Deutschland kann man Bananen im Geschäft kaufen! Bananen!!!“)
„Nudelsuppe“, weil es die bei uns wie bei fast allen Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion jeden Sonntag zum Mittagessen gab. Mit selbstgemachten Bandnudeln, für die meine Oma meist den ganzen Vormittag in der Küche stand.
Ich bin 1983 in Nowosibirsk geboren.
Meine deutschen Vorfahren kamen unter Katharina der Großen nach Russland, lebten dort als Landwirte oder Schreiner, überlebten Umsiedlungen, Deportationen, Arbeitslager. Mal lebten sie in der heutigen Ukraine, mal im eiskalten Sibirien.
1991 zog meine Familie wieder zurück nach Deutschland, 2016 machte ich mich selbstständig.
Die längste Zeit meiner Selbstständigkeit dachte ich, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Doch heute denke ich, dass meine Herkunft einen großen Anteil an meinen Irrungen und Wirrungen als Selbstständige hat.
Sozialismus im Kopf
Geschätzt machen sich weniger als 2% der Russischstämmigen selbstständig.
Das ist deutlich weniger als die knapp 10% von allen Erwerbstätigen in Deutschland. Oder von den 7,4% türkischstämmigen Berufstätigen.
Ich finde es nicht überraschend.
Wenn ich an meine Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion denke, sehe ich mich immer irgendwo mit meinen Eltern in einer Schlange stehen.
Wir stehen an, weil mein Vater gehört hat, dass es in diesem Geschäft Sahne gibt. Oder weil die Cousine der Nachbarin erfahren hat, dass ein bestimmtes Geschäft Fleisch verkauft.
Wir stehen und warten und drehen Däumchen, um am Ende gesagt zu bekommen, dass wir zu spät sind und alles ausverkauft ist. Oder wir gehen durch die nahezu leeren Regale im Geschäft auf der Suche nach Brot und freuen uns nen Keks, wenn wir noch einen Laib erwischen.
Mein Default-Setting ist der Mangel.
Es ist zu wenig da.
Es reicht nicht für alle.
Es fehlt an allen Ecken und Kanten.
Als ich Ende 2015 meine Zehen in das kalte Selbstständigsein-Wasser tunkte, waren das meine Wahrheiten, die ich erst einmal nicht hinterfragte.
Gedanklich in einem Mangel zu leben, war als Selbstständige anstrengend:
Ich traute mich nicht, über Geld zu sprechen.
Ich nahm jeden noch so schlecht bezahlten Auftrag an und …
jede Kollegin als „Bedrohung“ wahr – schließlich ist ja nicht genug für alle da
Ich verbrachte Jahre, um mir dieser sabotierender Gedanken bewusst zu werden und sie gegen andere – stärkende – zu tauschen.
Bloß nicht auffallen
Aufwachsen im Sozialismus heißt auch: Wir bekommen ein Päckchen aus dem Westen – die mit Gummibärchen, losem Kaffee und Vollmilchnussschokolade aus dem Aldi – und ich soll niemandem davon erzählen.
Niemand soll wissen, dass wir Deutsche sind und Verwandtschaft im Westen haben. Dass wir keine „richtigen“ Russen sind.
Ich nehme heimlich Süßigkeiten mit nach draußen und verteile sie an die Nachbarskinder. Einige Tage später gucken mich einige Kinder komisch an und jemand sagt, dass ich ein „Nazi“ bin.
In Deutschland angekommen, bin ich die „Russin“. Auf der Tafel malt ein Mitschüler Russland auf, „zerbombt“ es mit Papierkugeln und sieht mir dabei herausfordernd in die Augen.
Und so ist es auch mit der Onlinesichtbarkeit, als ich mich fast dreißig Jahre später selbstständig mache: Sie klingt potentiell gefährlich.
Noch immer höre ich irgendwo eine Stimme in mir, die sagt:
Lieber nicht auffallen.
Bloß nichts riskieren.
Niemanden kritisieren.
Noch immer habe ich ein leicht mulmiges Gefühl, wenn ich auf meinem Blog auf den „Veröffentlichen“-Button drücke. Oder bei dem brandneuen Podcast. Ich muss mich bewusst daran erinnern, dass ich hier sicher bin. Dass ich auffallen und meine Meinung sagen darf.
Als ich dann vor Social Media verlasse, eine eher „rebellische“ Haltung zu Marketing einnehme und mir erlaube, auch mal anzuecken, fühlt sich das abwechselnd befreiend und beängstigend an. Eine wilde Mischung.
Der böse Staat
Die Steigerung „Sei vorsichtig, traue niemandem, du weißt nie, wer mithört“ – das hatte ich auch schon als kleines Kind in der Sowjetunion verstanden.
Die Behörden und der Staat sind die Bösen. Wir müssen auf der Hut sein.
Und so löst noch heute jeder Brief vom Finanzamt Herzklopfen aus. Jedes drohende Telefonat, jeder Gang zum Gewerbeamt klingt irgendwie gefährlich. Hat das Imposter-Syndrom vielleicht auch etwas damit zu tun?
Der fremdklingende Nachname
In den ersten Jahren in Deutschland habe ich mich für meinen Nachnamen geschämt.
In der Schulzeit wird es etwas besser, doch ich muss meinen Nachnamen immer wieder buchstabieren, werde gefragt, wie man ihn „richtig ausspricht“. Meist dient mein Nachname als Anlass zur Frage, wo ich herkomme.
Die Kleinstadt in Hessen, in der ich, seit wir in Deutschland sind, lebe, ist damit nicht gemeint. Das stelle ich immer wieder fest. „Nein, wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren?”, haken Menschen dann gerne nach.
Wenn ich „Russland“ sage, ernte ich meist ein „Ah“. Über Russland gibt es nichts Gutes zu sagen, deshalb ist das Gespräch an dieser Stelle meist wieder beendet. War auch schon in den 90ern so. „Hätte dem Klang nach auch Italien sein können“, sagen manche noch. Ja, hätte es. Ist es aber nicht.
Meine gesamte Kindheit und Jugend wünsche ich mir einen anderen Nachnamen. Am besten den deutschesten aller deutschen, damit ich endlich nicht mehr auffalle.
Als ich dann einen „Müller“ heirate – ich schwöre, ich hab ihn mir nicht wegen seines Nachnamens ausgesucht –, entscheide ich mich auf dem Weg zum Rathaus spontan für einen Doppelnamen. Irgendwie kann ich es mir plötzlich nicht mehr vorstellen, den Namen, mit dem ich ein Vierteljahrhundert gelebt habe, wieder abzulegen.
Und als ich mich selbstständig mache, entscheide ich mich dafür, das völlig unter meinem Mädchennamen zu tun.
Und dann kam der Krieg
Als dann das Unvorstellbare passiert und wieder Krieg in Europa ist, bin ich wie gelähmt. Für die nächsten Monate ist Ausnahmezustand in meinem Kopf. Ich bin nicht leistungsfähig. Lebe wie unter einem Schleier. Lese zu viele Nachrichten.
Durch meine Familiengeschichte fühle ich mich seltsam betroffen, selbst wenn ich Tausende von Kilometern weit weg bin und gerade keine Verwandtschaft mehr in der Ukraine lebt. (Dafür aber immer noch in Russland.)
Zusätzlich frage ich mich, was das nun für mich als Selbstständige bedeutet:
Wird sich jemand durch meinen russischen Nachnamen abgeschreckt fühlen und nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen?
Muss ich mich aktiv vom Krieg distanzieren oder ist Menschen, die mich kennen, klar, dass ich kein großer Fan von Größenwahnsinnigen mit imperialen Machtansprüchen bin?
Was ist, wenn ich – so wie meine Vorfahren – den Wohlstand verliere und wieder neu anfangen muss?
Diese Gedanken sage ich niemandem, schreibe sie nicht auf. Zu groß ist die Angst, dass das negative Konsequenzen für mich hätte.
Und auch jetzt denke ich: Ist das wirklich eine so gute Idee, diesen Text zu schreiben und zu veröffentlichen? Was werden andere Menschen sagen? Was werden sie – im stillen Kämmerlein – über mich denken?
Doch gleichzeitig finde ich es wichtig.
Wir sehen Menschen ihre Einwanderungsgeschichte nicht an.
Wir sehen transgenerationale Traumata oder Diskriminierungserfahrungen nicht an.
Aber sie sind da. Unsichtbar.
Und vor allem bedeuten sie für uns nicht selten Emotionsarbeit – zusätzlich zu den Herausforderungen, die eine Selbstständigkeit eh schon so mit sich bringt.
Deshalb kann es gut sein, dass wir dann und wann das Tempo drosseln, wenn andere Vollgas geben. Dass wir mit Verarbeiten und Heilen beschäftigt sind und nicht mit Wachsen. Dass Nachrichten und Kriege uns mehr aus der Bahn werfen als andere Selbstständige.
Es ist okay. Seien wir gut zu uns.
Es werde Podcast!🎧🎤🎉 Warum ich mich entschieden habe, nun doch einen Podcast zu starten
Ich starte einen Podcast und verrate dir in diesem Artikel, wieso ich Podcasts für eine so gute Alternative für Social Media halte. Außerdem erzähle ich dir, welche guten Gründe es möglicherweise auch für dich gibt, einen Podcast zu starten.
Zugegeben – ich bin ein bisschen spät zur Party. Aber nun ist es auch bei mir soweit:
Ich werde einen Podcast starten!
Er wird – vermutlich wenig überraschend – SOCIAL MEDIA FREI heißen und sich um Marketingstrategien ohne Likes, Reels & Selfies drehen.
Am 4. Oktober 2023 geht’s offiziell los und ab sofort kannst du ihn bei Spotify, Apple oder der Podcast-App deines Vertrauens abonnieren. (⬅️ Das wollte ich schon immer einmal schreiben.😁)
Warum ich mich dazu entschieden habe, nun doch in das Podcastgame einzusteigen, und welche Vorteile ein Podcast grundsätzlich fürs Social-Media-freie Marketing bietet, erzähle ich in diesem Blogartikel.
Aus dem Nähkästchen: Meine 5 persönlichen Gründe, einen Podcast zu starten
#1 Podcast hat viel mehr mit Schreiben zu tun, als ich immer dachte
Ja, ja, ich weiß. Ich sage immer, ich will schreibend online sichtbar werden. Und daran hat sich noch immer nichts geändert. Allerdings ist mir in letzter Zeit bewusst geworden, dass Podcasting viel mehr mit Schreiben zu tun hat, als ich immer dachte.
Meine liebe Kollegin Rini hat mir gegenüber schon oft betont, dass Podcasting bei ihr auch zu den „schreibenden Strategien“ gehört. Ich konnte das erst nicht so richtig nachvollziehen, aber ja:
Podcast-Episoden brauchen ein (mehr oder weniger) ausführliches Skript. Und bevor ich mich vors Mikro stelle, mache ich mir erst einmal – auf dem Papier – Gedanken darüber, was ich erzählen will.
#2 Podcast soll meinen SEO-Traffic zu Pinterest ersetzen
Zusätzlich hatte ich 2022 eine weitreichende Entscheidung getroffen: Ich habe den Traffic, den ich mir über Jahre zu Pinterest-Themen aufgebaut hatte, „gekillt“ und alle meine Pinterest- und Social-Media-bejahenden Blogartikel gelöscht.
Das hat wehgetan, doch ich wollte nicht mehr oben auftauchen, wenn jemand nach Tipps für „Pinterest“ suchte, sondern für mein neues Thema.
Podcasting soll nun eine weitere Möglichkeit für mich werden, neue Menschen online auf mich aufmerksam zu machen – ganz ohne Social Media.
#3 Von meiner Zielgruppe gewünscht
Es ist nun auch ein bisschen so wie 2021 mit meiner Neuausrichtung zum Social-Media-freien Marketing:
Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, diese Nische zu besetzen, sondern hatte erst einmal nur darüber gesprochen (z.B. in diesem Blogartikel hier Anfang 2021), dass ich nicht mehr Social Media für mein eigenes Marketing nutze.
Daraufhin bekam ich immer wieder so viele Rückmeldungen von Menschen, die mir ihr Leid wegen Social Media klagten, dass ich merkte: Das ist ja ein riesiger Bedarf – und es gibt kaum jemanden, der ihn bedient.
So ist es nun bei dem Podcast auch. Immer wieder bekomme ich Mails von Menschen, die schreiben: „Schade, dass du keinen Podcast hast.“
Also wurde mir irgendwann klar: Das will ich ändern.😁
#4 Ich hatte Bock drauf
Doch natürlich ist es nicht so, dass ich es mache, weil andere Menschen es wollen, sondern weil ich gerade richtig Bock darauf habe!
Drei Jahre nach dem Rückzug aus Social Media und dem „Gemütlichmachen“ in meiner warmen Website-, Blog- und Newsletterhöhle bin ich bereit für etwas Neues.
Außerdem werden meine Schreibbedürfnisse gerade sehr von dem Buch gestillt, das ich gerade schreibe, sodass die Vorstellung, mal wieder etwas anderes zu machen, sehr attraktiv ist.
#5 Ich hab bereits viel geschrieben
Und last but not least: In den letzten drei Jahren habe ich so viele Blogartikel geschrieben, dass sich die Frage gestellt hat, warum ich die Blogartikel nicht einfach zu Podcastepisoden „verwurschtel“. Und deshalb mache ich das, was ich meinen Kundinnen auch immer in den Beratungen und Schreibcircles rate:
Ich starte mit dem, was ich schon habe.
13 gute Gründe, einen Podcast zu starten
Neben diesen fünf persönlichen Gründen gibt es unzählige weitere Vorteile, einen Podcast zu starten, die vielleicht auch für dich spannend sein könnten, wenn du auf der Suche nach Alternativen zu Social Media bist.
Hier sind dreizehn davon:
#1 43% der Deutschen hören gelegentlich einen Podcast
Podcasts werden immer beliebter. 2022 hat fast die Hälfte der Deutschen zumindest gelegentlich einen Podcast gehört. Sowohl mein elfjähriger Sohn als auch meine Mama hören inzwischen fast täglich Podcasts (Hallo, Mama!👋). Und die Chance, dass das auch für unsere Zielgruppe gilt, ist groß.
Hier ein Überblick über die Entwicklung der Podcastfans:
Nur zum Vergleich: Instagram nutzten im August 2023 41,5% der Deutschen (Quelle) – das sind sogar 1,5% Prozentpunkte weniger im Vergleich zu Podcasts.
#2 Der Podcast gehört uns
Doch im Gegensatz zu Instagram gehören uns die Inhalte, die wir für den Podcast produzieren, selbst – nicht Mark Zuckerberg.
Wir laden jede Episode bei einem Hoster hoch, der sie dann zu Spotify, Apple & Co. „weiterschickt“. Dabei können wir die Inhalte jederzeit exportieren und zu einem anderen Hoster wechseln.
Das ist ein großer Vorteil gegenüber Social Media, wo wir nur zu Gast sind und die Inhalte unwiderruflich verloren sind, falls wir keine Lust mehr auf diesen Kanal haben.
#3 Podcast = Marketingstrategie für alle, die nicht gerne schreiben
Einige Menschen, die mich über Google oder eine Empfehlung finden und sich für Social-Media-freie Strategien interessieren, beklagen, dass Schreiben einfach nicht ihr Ding ist.
Was sollen sie tun, wenn ein Blog, SEO oder Newsletter einfach nichts für sie ist?
Und hier kommt der Podcast ins Spiel: Wer nicht gerne schreibt, aber gerne redet, kann sich einfach ein paar Stichpunkte notieren und in einem Podcast drauflos quatschen.
Plus: Spotify, Apple-Podcasts & andere Streamingplattformen können natürlich auch Suchmaschinen verstanden werden: Wenn jemand nach unserem Thema sucht, ist unser Podcast da und bereit, gehört zu werden.
#4 Podcastepisoden sind immergrüne Inhalte
Dabei sind die Podcastfolgen immergrüne Inhalte. Das heißt: Einmal aufgenommen, sind die Podcastepisoden – so wie Blogartikel – da. 4EVA.✨
Sie verschwinden nicht im Nirwana so wie Social-Media-Inhalte, die meist nach wenigen Minuten oder Stunden kaum mehr jemanden interessieren, sondern arbeiten auch noch die nächsten Monate oder Jahre für uns.
#5 Podcasts sind ein neuer Touchpoint in der Customer Journey
Es gibt Menschen, die gerne lesen, und es gibt Menschen, die gerne hören. Wer das in seinem Marketingmix berücksichtigt, kann verschiedene „Reiserouten“ zu sich abdecken.
In den Shownotes zu jeder Podcastfolge können Website, Newsletter & Co. verlinkt und so nachhaltig Menschen auf unsere weitere Onlinepräsenz aufmerksam gemacht werden.
#6 Ein Podcast ist eine Möglichkeit, die Expertise zu etablieren
In den Folgen selbst können wir unsere Fachkenntnisse unter Beweis stellen und zeigen, was wir auf dem Kasten haben.
Damit sind Podcasts – so wie Blogs – eine Möglichkeit, unsere Expertise zu etablieren und sich als Meinungsmacher*in in der Nische zu positionieren.
#7 Podcast = Audio-Marketing ohne Social Media
Die Stimme ist etwas Persönliches und fast schon Intimes. Sie kann uns einen Menschen auf Anhieb sympathisch machen und den Wunsch, mit ihm zusammenzuarbeiten, verstärken.
Soziale Medien sind dabei nicht der einzige Weg, die Kraft der Stimme zu nutzen. Auch Podcasts sind eine weitere Möglichkeit für Audio-Marketing – ganz ohne Instastorys und Reels.
#8 Podcasts schaffen Vertrauen – auch ohne Social Media
So wie ein Newsletter ist auch ein Podcast ein Kanal, um eine Beziehung zu Menschen aufzubauen. Dafür sorgt zum einen das regelmäßige Hören und zum anderen die Stimme.
Gerade wer ohne Social Media auskommen will, sollte sich unbedingt Gedanken über vertrauensbildende Marketingkanäle machen. Und wer nicht so gerne schreibt, kann hier auf Audio-Marketing setzen.
#9 Podcast als Vertriebskanal
Auch bietet ein Podcast die Möglichkeit, über die eigenen Produkte und Angebote zu reden. Locker in einer Folge und/oder im Outro.
Simone Weissenbach erzählte mir sogar einmal in einem Interview, dass der Podcast eine so wichtige Rolle für sie als Vertriebskanal spielt, dass sie sogar vergleichsweise selten Newsletter schreibt.
#10 Podcasts haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Was braucht man eigentlich für Podcasts? Nicht viel. Ein gutes Mikro, einen Hoster, eins der vielen (kostenlosen) Schnittprogramme und dann kann es auch schon losgehen.
Klar kann die Podcastproduktion auch technisch ambitionierter angegangen oder (später) auch an Agenturen oder an eine virtuelle Assistenz ausgelagert werden. Doch jede*r kann erst einmal mit niedrigen Produktionskosten einsteigen.
#11 Menschen hören freiwillig Podcasts
Einer meiner Lieblingsgründe für Podcasts ist, dass Menschen freiwillig Podcasts hören. Im Gegensatz zu Social-Media-Beiträgen bekommen sie die Folgen nicht einfach so in einen Feed gespült – sie müssen sich schon aktiv für eine Folge entscheiden und auf „Play“ drücken.
Damit konsumieren Menschen unsere Inhalte unter ganz anderen Bedingungen, als wenn sie ihre Social-Media-App öffnen.
Plus: Wenn Menschen zu Fans unseres Podcasts werden, entscheiden sie sich bei jeder Folge aufs Neue für uns. Ist das nicht wunderbar?
#12 Fast alle nutzen Smartphones
88% der Deutschen nutzen Smartphones (Quelle).
Smartphones sind aus unserem Leben also nicht mehr wegzudenken. Vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum App-basierte Anwendungen wie Instagram oder TikTok so erfolgreich sind.
Bei Podcasts ist es ähnlich: Sie können auf dem Smartphone über Kopfhörer gehört werden und sind damit für 88% der Deutschen aufrufbar. Jederzeit. An jedem einzelnen Tag.
#13 Podcasts können nebenbei gehört werden
Und damit spricht noch ein weiterer Punkt für Podcasts: Sie können dank Smartphone nebenbei gehört werden.
Während es fürs Lesen von Blogartikeln oder Newslettern Konzentration braucht, können Podcasts beim Pendeln, Putzen oder Pilates konsumiert werden.
Fazit: Es gibt viele gute Gründe, einen Podcast zu starten
Und deshalb gehe ich jetzt auch unter die Podcastmenschen.😁
Dabei reizt es mich vor allem, eine weiteren Kanal zu erschließen, der völlig ohne Social Media auskommt. Schließlich freue ich mich immer über Gelegenheiten, Mark ein Schnippchen zu schlagen.
Willst du in meinen Podcast mal reinhören? Dann einmal hier entlang, bitte.
Wer hat Angst vor Prokrastination?
„Prokrastination“ ist ein ganz normaler Teil eines kreativen Prozesses, ganz egal, ob es sich um Produktentwicklung, den Podcast oder einen Newsletter handelt. Wie wir mit vermeintlicher Prokrastination umgehen können, statt dagegen anzukämpfen, verrate ich im Blogartikel.
Neulich hatte ich in einem Beratungsgespräch eine Kundin, die sich beklagte:
„Ich habe immer so viele Ideen im Kopf, aber ich schaff’ es einfach nie, sie umzusetzen. Ich bin die Meistern des Aufschiebens!“😭
Kennst du dieses Problem auch? Dann ist dieser Blogartikel für dich.😊
Doch Achtung: Ich gebe dir im Folgenden keine Tipps, wie du die „blöde“ Prokrastination „besiegst“, sondern möchte dir stattdessen zeigen,
dass das, was viele „Prokrastination“ nennen, ein ganz normaler Teil eines kreativen Prozesses ist, ganz egal, ob es sich um Produktentwicklung, einen Podcast oder einen Newsletter handelt
warum es wichtig ist, wohlwollend sich selbst gegenüber zu sein – auch und vor allem als Selbstständige*r
was wir tun können, um gute Arbeit zu leisten – ohne über unsere Grenzen zu gehen
Lass uns mit unserer „Prokrastination“ verbünden, statt ständig gegen sie anzukämpfen.
Kämpfen ist anstrengend, und, wenn wir ehrlich sind, ist noch nie jemand dadurch produktiver geworden, dass er oder sie zu sich gesagt hat:
„Jetzt reiß dich doch mal zusammen und hör auf zu prokrastinieren!“
Angst vor Prokrastination?
Geht es nur mir so oder haben die Marketing- und Businessmenschen alle eine Riesenangst davor zu „prokrastinieren“?
Ich glaube, dass – nicht nur, aber zu einem großen Teil – durch Social Media die toxische Hustle Culture zur neuen Normalität geworden ist. Ich erzähle dir ja nichts Neues, wenn ich dir sage, dass es normal geworden ist, 24/7/365 zu arbeiten.
Pausen, Nichtstun, Langeweile oder eben Prokrastination wirken da fast schon bedrohlich.
Inkubation statt Prokrastination
Dabei vergessen wir eine wichtige Sache: Für unsere Selbstständigkeit im Allgemeinen und Marketing im Besonderen brauchen wir Kreativität.
Wir brauchen coole Ideen und witzige Umsetzungen. Wir brauchen Überraschungen und Humor. Wir brauchen neue Wege und geniale Texte.
Doch Kreativität gibt es nicht ohne Inkubation – die Phase, in der Ideen ruhen, schlafen, wachsen, reifen dürfen. Wir können in einem kreativen Prozess die Inkubationsphase nicht überspringen, streichen oder abkürzen. Sie gehört dazu.
Und deshalb ist es völlig normal,
wild zu brainstormen – ohne etwas davon umzusetzen
Ideen zu haben – und sie erst einmal nicht weiterzuverfolgen
Texte für den Blog oder Newsletter anzufangen – und sie erst einmal liegen zu lassen, ohne sie gleich fertigzustellen
In der Kreativität gibt es keine Garantie. Und wir sind keine Maschinen, die taktgenau Ergebnisse ausspucken. Wir sind Menschen.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir freundlich zu uns sind, wenn wir nicht so können, wie es die Marketingcoaches auf Instagram von uns wollen.
Jeden Tag posten.
Jede Woche bloggen.
Alle drei Monate launchen.
Dieses Tempo ist für die meisten Menschen unrealistisch. Und vor allem ist es meistens nicht mit dem kreativen Prozess vereinbar.
Die innere Kritikerin ist … wichtig
Einen ebenso schlechten Ruf wie die Inkubationsphase hat auch die innere Kritikerin.
„Mein Problem ist auch, dass ich immer denke: Es geht noch besser. Deshalb veröffentliche ich nichts“, sagte die Kundin im Beratungsgespräch. „Was kann ich gegen die innere Kritikerin tun?“
Auch das ist etwas, was in den letzten Jahren zum Trend geworden ist: die Skepsis gegenüber kritischen Stimmen.
Ich glaube, wir sollten das dringend differenzieren:
Kritische Stimmen sind wichtig. Sie sind es, die aus einem doofen Produkt ein gutes Produkt machen. Oder einen okayen Text zu einem sensationellen. Bevor ein Buch veröffentlicht wird, geht es erst einmal ins Lektorat, und auch ein Designprozess hat mehrere Korrekturschleifen.
Texte, Bilder, Videos, Websites oder Produkte kritisch zu betrachten, ist keine Prokrastination. Feilen, schleifen, auseinandernehmen und neu zusammensetzen gehören genauso zur Kreativität wie brainstormen, loslegen und umsetzen. Die innere Kritikerin ist ein wichtiger Teil des Prozesses.
Gleichzeitig können uns kritische Stimmen lähmen. Dann nämlich, wenn sie nicht einfach nur Teil eines kreativen Prozesses sind, sondern den gesamten kreativen Prozess dominieren. Wenn vor lauter Kritisieren kein Platz mehr bleibt für das Wilde, das Chaos und das Spielerische. Diese kritischen Stimmen sind nicht konstruktiv, sondern destruktiv.
Wie wir das eine von dem anderen unterscheiden können:
Konstruktive kritische Stimmen sind konkret, z.B. „Dieses Kapitel ist zu kurz. Ich glaube, es müsste noch zwei Seiten länger sein.“
Konstruktive kritische Stimmen sind optimistisch und offen für Möglichkeiten, z.B. „Irgendwas stimmt hier nicht an dem Text. Ich könnte mal x, y oder z probieren. Vielleicht hört es sich dann besser an.“
Destruktive kritische Stimmen sind allgemein und haben oft keinen klaren Bezug, z.B. „Der Text ist total kacke.“
Destruktive kritische Stimmen wollen oft die Zukunft vorhersagen – pessimistisch: „Das wird doch nie was!“, „Das wird doof!“
Wie wir gute Arbeit leisten – ohne über unsere Grenzen zu gehen
Und wie können wir nun trotz Inkubation und kritischer Stimmen gute Arbeit leisten und produktiv sein, ohne in die toxische Hustle Culture abzudriften?
Ich habe drei Vorschläge:
Indem wir uns realistische Ziele setzen. Das Motto „Dream big“ ist – dank Gender Care Gap – für viele selbstständigen Frauen oft eine selbstausbeuterische Angelegenheit. Wer für den Großteil der Care-Arbeit verantwortlich ist, wird nicht gleichzeitig ein Imperium aufbauen können. Das ist auch kein „falsches Mindset“, sondern die Lebensrealität vieler Frauen, die in ihrem Leben nicht die Strukturen vorfinden, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Ziele zu verfolgen.
Indem wir uns mit unserem Körper verbünden, statt gegen ihn zu arbeiten, und auf unseren Chronotyp, die Jahreszeiten oder unseren Menstruationszyklus achten.
Gerade das zyklische Arbeiten ist etwas, was meine kreative Arbeit nachhaltig verändert und bereichert hat. Diese Onlinekurse sind zum Beispiel alle durch zyklisches Arbeiten entstanden.
Und schließlich: Indem wir uns in Vertrauen üben und jede Phase des kreativen Prozesses annehmen – so, wie sie ist. Das wilde Brainstormen, das chaotische Konzeptionieren, das geordnete Strukturieren, das produktive Arbeiten, das kritische Überprüfen, das Schleifen, Aussortieren und Eliminieren. Alles hat seinen Sinn. Alles gehört dazu. Alles ist wichtig.
Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke?
Drei Jahre kein Instagram 🎂
Kein Instagram seit drei Jahren als Selbstständige: Das habe ich über Inspiration, Produktivität, Beziehungen und mentale Gesundheit gelernt.
Am 27. August 2020 – also vor genau drei Jahren – habe ich das letzte Mal etwas auf Instagram gepostet.
Wenn mir heute andere Selbstständige erzählen, dass sie überlegen, „was sie auf Insta posten sollen“ oder „wie ihre Ads besser laufen“, fällt es mir wieder ein. „Stimmt“, denke ich mir dann, „diese Themen haben dich früher auch immer die ganze Zeit beschäftigt.“
Es kommt mir wie eine Ewigkeit, ja, wie ein anderes Leben vor, als ich noch auf Social Media war und mir über Reels, Werbeanzeigen oder Karussellposts Gedanken gemacht habe. Und inzwischen hat sich so viel in meinen Ansichten über das Selbstständigsein geändert, dass ich unbedingt davon erzählen will.
Drei Jahre kein Instagram – das habe ich gelernt
… über Inspiration
Wir denken, dass wir so viel verpassen, wenn wir nicht auf Social Media sind. Dabei brauchen wir so viel weniger Inspiration, als wir glauben.
Ein guter Gedanke, eine gute Idee oder ein gutes Konzept reicht völlig, um uns ins Tun zu bringen.
Wir brauchen nicht die Flut an Tipps, Tricks, Hacks und Zitaten, die wir auf Instagram bekommen. Diese Flut inspiriert uns nicht, sie lähmt uns. Sie sorgt eher dafür, dass wir abstumpfen und zu einem Zombie mutieren, der einfach nur von Post zu Post scrollt, ohne sich ernsthaft auf einen Gedanken einzulassen.
Auch ohne Instagram gibt es genug Quellen für Inspiration: Bücher, Blogartikel, Gespräche, Empfehlungen, Museen, Ausstellungen, Podcasts, Reisen, Musik und … uns selbst.
… über Produktivität
Die Produktivität, die auf Social Media zelebriert wird, ist die toxische Hustle Culture.
Schaut her, wie ich um 5 Uhr morgens aufstehe. Schaut her, wie ich meine Morgenroutine pflege. Schaut her, wie ich an meinem neuen Produkt arbeite. Schaut her, wie entspannt ich meine Mittagspause gestalte. Schaut her … Schaut her … Schaut her …
Dabei gibt es ein großes Missverständnis:
Produktives Arbeiten braucht nicht die Abwesenheit von Pausen. Produktives Arbeiten braucht die Abwesenheit von Störungen.
Wir können nur dann produktiv sein, wenn wir über einen längere Zeit ungestört arbeiten können:
ohne Pushbenachrichtigungen
ohne das ständige Checken, was es Neues auf Social Media gibt
ohne Posten darüber, wie wir gerade arbeiten
Produktivität findet nur selten öffentlich auf Social Media statt, sondern meist hinter verschlossenen Türen. Sobald ich über meine Arbeit auf Social Media erzähle, unterbreche ich meine Arbeit und bin vermutlich nicht mehr produktiv.
… über Beziehungen
Es ist nicht normal, jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun zu haben, wie es auf Social Media möglich ist. Unser Hirn ist nicht dafür gemacht, so viele Kontakte zu haben. Wir stoßen an eine kognitive Grenze.
Wenn wir Einblick in das Leben von hunderten oder gar tausenden von Menschen bekommen, ist das oft nicht bereichernd, sondern belastend.
Die Menschen, die wir persönlich – ob offline oder online – kennen, sind genug.
Wir brauchen nicht hunderte oder tausende Accounts, denen wir folgen. Und erst recht brauchen wir nicht zehn- oder hunderttausend Follower zu unserem Lebensglück.
… über mentale Gesundheit
Algorithmen sind nicht empathisch und soziale Medien sind nicht so konstruiert, dass sie unser Wohlbefinden steigern, sondern den Profit der Plattformbetreiber.
Wir können es mit Achtsamkeit versuchen oder mit Digital Detox, aber die Wahrheit ist: Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es eine separate Berufsgruppe (die sogenannten Attention Engineers), deren alleinige Aufgabe es ist, Erkenntnisse der Psychologie zu nutzen, um Social-Media-Plattformen so zu gestalten, dass sie maximal süchtig machen.
Wie sollte ein Individuum jemals dagegen ankommen? Es liegt nicht an uns, wenn es uns nicht gelingt, gesund zu bleiben, während wir Social Media nutzen.
… über Authentizität
Wie authentisch können wir im Marketing sein, wenn wir das machen, was alle anderen auch tun? Wie können wir „wir selbst“ sein, wenn wir uns zu bestimmten Plattformen zwingen?
Wenn wir Social Media nicht mögen, können wir dennoch posten, Reels drehen und livegehen, doch wie können wir die richtigen Menschen damit anziehen, wenn wir selbst nur eine Rolle spielen?
… über Prioritäten
Wir können Social Media vom Ende aus betrachten und uns fragen:
Wie würde ich am Ende meines Lebens über die sozialen Medien denken?
Würde ich es bereuen, dass ich zu wenige Likes oder Follower hatte? Würde ich denken „Hätte ich doch mehr Selfies gepostet!“ oder „Hätte ich doch öfter Beiträge von Fremden im Internet kommentiert!“ oder „Wäre meine Interaktionsrate auf Insta bloß höher gewesen!“?
Oder würde ich es bereuen, zu wenig Zeit mit dem verbracht zu haben, was mir wirklich wichtig ist? Würde ich es bereuen, dass ich mich über Jahre zu etwas gezwungen habe, was ich gar nicht wollte?
… über Leichtigkeit
Leben und Arbeiten ohne Social Media heißt nicht unbedingt, dass alles „leicht“ ist. Arbeiten ohne Social Media ist immer noch Arbeit. Manchmal sogar sehr viel Arbeit. Und manche Tage fühlen sich auch ohne Social Media schwer und anstrengend an.
Doch das ist nicht weiter tragisch, denn entscheidend ist eine Balance. Eine Balance aus Anspannung und Entspannung, aus Herausforderung und Komfortzone, aus außen und innen, aus mit anderen und für sich.
Nicht Leichtigkeit, sondern diese Balance sorgt dafür, dass wir auch langfristig gesund bleiben und zufrieden in unserer Selbstständigkeit sind. Sich ständig außerhalb der Komfortzone aufzuhalten, ist das Anstrengende – nicht wenn es hin und wieder anstrengende Tage gibt.
… übers Genug-Sein
Über diese Fragen lohnt es sich nachzudenken:
Wann habe ich genug gearbeitet?
Wann habe ich genug Marketing gemacht?
Warum bin ich genug?
Soziale Medien lassen uns glauben, dass das, was wir tun, nie genug ist, dass wir nie genug sind. Doch das stimmt nicht. Wir können unser persönliches „Genug“ definieren. Wir können unser Gefühl fürs Genug-Sein zurückerobern, indem wir Social Media verlassen und vielleicht sogar unsere Social-Media-Kanäle löschen.
Vielleicht interessiert dich auch:
Instagram löschen – ja oder nein? Ich helfe dir, dich zu entscheiden
Instagram löschen: Meine Erfahrung mit einem Instagram-Ausstieg als Selbstständige
Instagram vs. Realität: Wie sieht eine Selbstständigkeit ohne rosaroten Instagram-Filter aus?
Instagram-Konto löschen oder deaktivieren: Link + einfache Anleitung
10 Argumente gegen personalisierte Werbung auf Social Media
Kritische Perspektive auf personalisierte Werbeanzeigen in sozialen Medien: Im Blogartikel nenne ich zehn wichtige Argumente, die gegen die Nutzung von Social-Media-Ads sprechen.
Seit ungefähr 2,5 Jahren nutze ich keine Werbeanzeigen mehr in meinem Marketing.
Angefangen hat das Ganze eher unfreiwillig: Nachdem ich jahrelang auf Facebook und Instagram Werbung geschaltet hatte, wurden meine Ads von einem Tag auf den anderen nicht mehr ausgespielt.
Einfach so.
Ich hatte die Werbeanzeigen genauso erstellt, wie ich sie seit vier Jahren immer erstellte. Und ich nutzte genau die Kampagnenziele, die ich immer nutzte. Der Werbeanzeigenmanager zeigte an, dass alles korrekt war – doch die Anzeigen gingen nicht raus und es wurde kein Geld verbraucht.
Auch zwei Marketingberater*innen, die sich auf FB-Ads spezialisiert hatten und die ich in meiner Verzweiflung buchte und drüber gucken ließ, konnten nicht herausfinden, woran es lag. „Alles sieht korrekt aus“, so das einhellige Urteil. „Eigentlich müsste es funktionieren …“
Tat es aber nicht. Auch der Facebook-Support konnte mir nicht weiterhelfen. Oder besser gesagt: Wollte es nicht. Nach zwei Mal hin und her mailen bekam ich die leicht gereizte Antwort, dass ich doch bitte davon Abstand nehmen sollte, sie weiterhin zu kontaktieren.
Da stand ich nun kurz vor einem Launch, bei dem ich felsenfest mit Werbeanzeigen gerechnet hatte. Und der Facebook-Werbeanzeigenmanager zeigte mir den Stinkefinger.
Zuerst war ich entsetzt. Schließlich waren Werbeanzeigen ein essentieller Bestandteil in meinem Marketing. Doch schon bald nahmen meine Bemühungen, mein Werbeanzeigenkonto wieder zum Laufen zu bringen, eine andere Richtung – die entgegengesetzte.
Und heute, 2,5 Jahre später, schalte ich freiwillig und ganz bewusst keine Werbeanzeigen mehr in meinem Marketing.
Warum, erzähle ich dir in diesem Blogartikel.
Argumente für personalisierte Werbung auf Social Media
Doch lass uns zunächst einmal über die Argumente für Werbeanzeigen sprechen. Vermutlich sind sie dir auch wohlbekannt. Denn in der Marketingwelt ist diese Ansicht dominant:
Wir können mit Werbeanzeigen gezielt eine bestimmte Gruppe von Menschen ansprechen. Frauen zwischen 30 und 40 aus München, die gerne golfen? Kein Problem mit dem mächtigen Werbeanzeigenmanager!
Wir können bestimmte Posts, die organisch zu wenige Menschen aus unserer Community erreichen, gezielt pushen und einer größeren Gruppe von Menschen ausspielen.
Wir können unsere Freebies, Webinare & Co bewerben und so erfolgreich unsere E-Mail-Liste aufbauen oder launchen.
Reichweite aufbauen, Sichtbarkeit erhöhen und Skalieren gehen mit Werbeanzeigen viel schneller als ohne.
Wir können mit sogenannten Retargeting-Kampagnen die Menschen kontaktieren, die sich ein Produkt von uns angeguckt oder in den Warenkorb gelegt haben. Damit können wir Verkäufe ankurbeln und Umsätze steigern.
An sich will ich diesen Argumenten auch gar nicht widersprechen. Doch was viel seltener thematisiert wird, sind die vielen Argumente, die gegen Werbeanzeigen, insbesondere personalisierte Werbung, sprechen.
Hier kommen zehn davon.
Argumente gegen personalisierte Werbung auf Social Media
#1 Das Abhängigkeits-Argument
Aus meiner Geschichte, die ich zu Beginn des Textes geteilt habe, wird deutlich: Wenn wir unser gesamtes Marketing auf Werbeanzeigen aufbauen, machen wir uns verdammt abhängig.
Solange alles reibungslos funktioniert, finden wir Abhängigkeit meist gar nicht schlimm. Doch sobald etwas nicht so läuft, wie es soll, merken wir, dass Abhängigkeit zum Problem werden kann.
Es gibt eine Menge Dinge, die passieren können, obwohl wir uns überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen und keine Communityrichtlinien verletzen.
Meine Geschichte, dass ich von einem Tag auf den anderen einfach keine Anzeigen mehr schalten konnte, ist vergleichsweise harmlos.
Es gibt Onlineunternehmer*innen, deren Konten werden trotz gutem Passwort und Zweifaktor-Authentifizierung gehackt und gesperrt. Mit gravierenden Folgen für alle Beteiligten.
Und manchmal passiert das sogar im großen Stil, zum Beispiel wenn Facebook-Mitarbeitende gegen Bezahlung externen Unternehmen Zugriff auf Tools zur Kontowiederherstellung geben.
Wenn darüber hinaus der Facebook-Support die Nutzer*innen mit ihren gehackten, gesperrten oder nicht funktionierenden Konten alleine lässt, ist das keine gute Kombination.
Abhängigkeit von einer Social-Media-Plattform klingt total normal? Ist es nicht. Mit anderen Marketingstrategien ist es nämlich so:
Falls mich mein Newsletter-Tool irgendwann nervt, kann ich meine E-Mail-Kontakte exportieren und zu einem anderen Anbieter wechseln. Falls ich irgendwann Squarespace nicht mehr gut finden sollte, kann ich wieder zu WordPress wechseln. Falls ich Probleme mit meinem Podcast-Hoster hätte, würde ich einfach einen anderen nehmen.
Doch bei Werbeanzeigen?
Falls Meta und Co. irgendetwas an der Funktionsweise ändern oder unser Konto nicht mehr funktioniert, können wir nicht einfach unsere sieben Sachen packen und zu einer Konkurrenzplattform wechseln. Solange wir Werbeanzeigen schalten wollen, sind wir an diese Plattformen gebunden.
#2 Das Privatsphäre-Argument
Die Werbung, die wir auf Social Media schalten können, ist nicht einfach nur Werbung. Sie ist personalisierte Werbung.
Im Gegensatz zu Massenwerbung bekommen Menschen bei personalisierter Werbung die Themen angezeigt, für die sie sich interessieren. Passgenau. Individuell. Zielgerichtet.
Was für alle Beteiligten praktisch klingt, ist bei näherem Hinsehen problematisch. Denn wie genau funktioniert personalisierte Werbung auf Social Media überhaupt?
Zunächst einmal, indem ein Unternehmen wie Meta Daten zu einem Wirtschaftsgut erklärt.
Alles, was wir auf Facebook oder Instagram tun, wird deshalb registriert, gemessen und gespeichert. Ebenso das, was wir außerhalb von Facebook und Instagram online tun.
Websites, die den Meta-Pixel eingebunden haben, geben alle Informationen an Meta weiter: was wir im Netz lesen, wie lange wir uns Videos angucken, was wir in den Warenkorb gelegt haben (aber nicht kaufen) uvm. Diese Informationen über uns werden an Werbetreibende verkauft. Damit möglichst viele dieser Daten erhoben und verkauft werden können, ist Metas oberstes Ziel, dass Menschen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Algorithmen, die emotionalisierende Inhalte pushen, helfen dabei. ⬅️ Das ist Metas Geschäftsmodell in a nutshell.
Die Harvard-Professorin und Autorin Shoshana Zuboff spricht in ihrem gleichnamigen Buch von einem „Überwachungskapitalismus“. Konzerne wie Meta (aber auch Google oder Microsoft) sammeln, analysieren und speichern eine große Menge an Daten über Menschen und ermöglichen damit, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen (um nicht zu sagen: zu manipulieren).
Für Zuboff stellt das Geschäftsmodell mit den Daten demokratische Normen in Frage, was sich in der Vergangenheit vielfach bestätigt hat:
Mikrotargeting mag also nach einer tollen Chance für Selbstständige und Unternehmen klingen, ja. Doch es stellt eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie dar, die so langsam nicht mehr wegdiskutiert werden kann.
Besonders ärgerlich ist es, wenn der Einsatz des Meta-Pixels „aus Versehen“ oder unreflektiert passiert, wie jüngst bei der Polizei in Großbritannien. Sie hatte den Pixel auf einer Seite verwendet, auf der Menschen häusliche oder sexualisierte Gewalt melden konnten. Die Folge: Durch den Pixel gab die Polizei diese sensiblen Informationen an Meta weiter, sodass Meta jetzt genau weiß, wer potentiell von häuslicher / sexualisierter Gewalt betroffen ist.
Wer nun sagt, dass er doch gar nichts zu verbergen habe, sei daran erinnert, dass Privatsphäre ein Grundrecht ist, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Charta der Grundrechte verankert ist.
Es geht nicht darum, ob wir etwas zu verbergen haben, sondern darum, dass es Grundrechte zu schützen gilt. Schließlich setzen wir ja auch nicht gleich die Meinungsfreiheit außer Kraft, nur weil wir mal nichts zu sagen haben.(1)
#3 Das Rechtsargument
Das Problem ist aber nicht nur, dass Unternehmen wie Meta all diese Daten erheben, analysieren, verarbeiten, speichern und verkaufen. Das Problem ist auch, dass sie es meist ohne das explizite Einverständnis der Menschen tun.
Denn auch wenn die meisten Selbstständigen, Onlineunternehmer*innen und Unternehmen auf personalisierte Werbung setzen, heißt es nicht, dass sie es rechtskonform tun.
Die Rechtslage (2) sieht zur Zeit so aus, dass Websitenbetreiber*innen dafür verantwortlich sind, den Meta-Pixel datenschutzkonform einzubinden. Ein Hinweis zum Meta-Pixel in den Datenschutzhinweisen reicht dazu nicht aus.
Datenschutzkonform ist die Nutzung des Meta-Pixels meinem Verständnis (2) dann, wenn
Menschen aktiv in die Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke einwilligen (Opt-in)
Menschen der Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen können (Opt-out)
der Meta-Pixel erst dann lädt und Daten erhebt, nachdem das Einverständnis erteilt wurde
Gerade der letzte Punkt ist technisch wohl nicht immer so leicht umzusetzen und verlangt – je nach CMS und Cookie-Banner – Coding-Kenntnisse.
#4 Das Ethik-Argument
Doch selbst wenn der Einsatz des Meta-Pixels rechtskonform ist und sich Selbstständige und Unternehmen offiziell nichts „zu Schulden“ kommen lassen – die wenigsten Menschen blicken wohl wirklich durch, was passiert, wenn sie beim Cookie-Banner auf „Annehmen“ klicken.
Hinzu kommt noch, dass es inzwischen eine ganze Marketingdisziplin gibt, die sich damit befasst, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, möglichst viele ihrer persönlichen Daten preiszugeben, damit möglichst zielgerichtete Werbeanzeigen geschaltet werden können
Consent Optimization nennt sich das, und es geht im Großen und Ganzen darum, durch ein spezielles Wording oder Design Menschen dazu zu „motivieren“, Cookies zu akzeptieren.
Diese Consent-Optimierung öffnet Tür und Tor für sogenannte „Dark Patterns“ – Strategie-, Design- oder Sprachmuster, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten verleiten und ethisch fragwürdig sind.
Auch die Social-Media-Plattformen selbst bedienen sich natürlich solcher Dark Patterns, um Menschen dazu zu bringen, der Nutzung ihrer Daten zuzustimmen. Zum Beispiel, indem der Annehmen-Button in einer auffälligeren Farbe gestaltet wird als der Ablehn-Button.
#5 Das Zukunftsargument
Auch ob personalisierte Werbung in der aktuellen Form so zukunftsfähig ist, darf bezweifelt werden.
Surprise, surprise: Selbstständige und Unternehmen (und Politiker*innen) finden es vielleicht gut, personalisierte Werbung zu schalten. Doch die meisten Menschen finden es eben nicht gerade toll, getrackt zu werden.
Und Unternehmen wie Apple tragen dem Rechnung, indem sie seit iOS 14.5 es ermöglichen, Tracking für bestimmte Apps – und dazu gehören auch Facebook und Instagram – abzulehnen.
Natürlich macht das Apple nicht (nur) aus Menschenliebe oder aus Spaß an der Freude – auch wenn es die Apple-Bosse sicherlich freut, dass das ihren Konkurrenten Meta rund 10 Milliarden Dollar im Jahr kostet –, sondern aus wirtschaftlichem Interesse.
Doch das grundsätzliche Problem bleibt: Metas Geschäftsmodell setzt voraus, dass sich Menschen freiwillig und ohne zu mucken tracken lassen. Und ob das für jetzt bis in alle Zeit so gelten wird?
Gleichzeitig gibt es in letzter Zeit auch aus der Politik entsprechende Zeichen:
In Norwegen wurde jüngst personalisierte Werbung für drei Monate verboten.
Und auch im Europaparlament gibt es Bestrebungen, personalisierte Werbung zu verbieten.
Mit anderen Worten: Dass die Politik ewig dabei zusehen wird, wie Meta und Co. Daten im großen Stil und ohne das explizite Einverständnis der Menschen sammeln und die Konsequenzen stillschweigend in Kauf nehmen, darf bezweifelt werden.
#6 Das „Mehr ist nicht immer besser“-Argument
Menschen, die für den Einsatz von Werbeanzeigen mit dem Argument „Wir können mit Werbeanzeigen schneller wachsen und skalieren als ohne Werbeanzeigen.“ plädieren, scheinen stillschweigend davon auszugehen, dass „mehr“ immer „besser“ ist.
Doch das ist aus meiner Sicht nicht zwingend der Fall. Ich selbst habe zum Beispiel folgende Erfahrungen gemacht:
Menschen, die mich durch Ads fanden, waren anders als die Menschen, die wegen eines Interviews, einer Empfehlung oder eines Blogartikels auf mich aufmerksam wurden. Seit ich keine Werbeanzeigen mehr schalte, habe ich es auch deutlich seltener mit ausfallenden, unfreundlichen und unangenehmen Menschen zu tun.
Werbeanzeigen führten bei mir zu einer höheren Abmelderate beim Newsletter, weil sie vermutlich auch viele Freebiejäger erreichten, die sich einfach nur das Freebie schnappen wollten, aber gar kein Interesse daran hatten, den Newsletter zu abonnieren. Seit ich keine Werbeanzeigen mehr nutze (und auch keine Freebies mehr habe), ist die Abmelderate deutlich gesunken, während die Öffnungs- und Klickrate gestiegen sind.
Stellen wir doch einfach mal zwei Situationen gegenüber.
Lara scrollt durch ihren Instagram-Feed und sieht eine Werbeanzeige für ein kostenloses Downloadprodukt. Innerhalb von wenigen Sekunden beschließt sie, sich das Downloadprodukt zu holen, indem sie ihre E-Mail-Adresse rausrückt. Lara weiß noch gar nicht so viel über die Person, deren Newsletter sie abonniert hat. Und sie hat sich auch streng genommen gar nicht zum Newsletter anmelden wollen – sie wollte nur das PDF.
Ein anderes Szenario:
Ben ist Fan eines bestimmten Podcasts. In der letzten Folge wurde eine Person zu einem spannenden Thema interviewt. Nach fast einer Stunde Interview hat Ben eine Menge über den Werdegang, das Thema und die Ansichten dieser Person erfahren. Und als er dann zu ihr auf die Website geht, steuert er gezielt die Newsletteranmeldung an. Er weiß ganz genau, dass er auch in Zukunft mehr von dieser Person hören will.
Nun ist damit natürlich nicht gesagt, dass sich Lara sofort vom Newsletter abmelden und Ben bis in alle Ewigkeiten im Newsletter bleiben wird – auch Bens melden sich vom Newsletter ab, wenn sich ihre Interessen oder persönlichen Umstände ändern. Doch die Voraussetzungen bei Lara und Ben sind einfach völlig unterschiedliche.
Mehr ist nicht immer besser. Die richtigen Menschen sind besser.
Und was sind die richtigen Menschen? Aus meiner Sicht sind das Menschen, die genügend Zeit hatten, um eine informierte Entscheidung für oder gegen einen Newsletter, ein Webinar oder ein Produkt zu treffen. Und das ist bei Werbeanzeigen, wo wir Entscheidungen innerhalb von wenigen Sekunden treffen, nur selten der Fall.
#7 Das „Wir können nicht mehr unbegrenzt wachsen“-Argument
„Klingt ja schön und gut“, kriege ich manchmal von erfahrenen Onlineunternehmer*innen gesagt, „aber ohne Werbeanzeigen ginge mir das viel zu langsam.“
Da gebe ich ihnen Recht: Ohne Werbeanzeigen geht Wachstum viel langsamer.
Doch könnte das nicht auch … eine gute Sache sein?
Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr und mehr verstehen, dass wir nicht mehr so wirtschaften können wie bisher. Wir merken, dass unbegrenztes Wachstum unsere Welt zerstört und unsere Gesundheit. Wir sehen, dass Unternehmen, die ohne Kopplung an Werte wachsen, das meist auf Kosten von Sicherheit, Privatsphäre und Moral tun.
Wollen wir da wirklich mitmachen? Muss es denn wirklich immer um maximalen Gewinn gehen?
Oder wollen wir unser Wachstum verantwortungsbewusst gestalten? Zum Beispiel, indem wir klare rote Linien ziehen und auf Dark Patterns oder personalisierte Werbung verzichten?
#8 „Es geht gar nicht schneller“-Argument
Doch es gibt noch ein zweites Argument gegen die „Mit Werbeanzeigen geht Wachstum viel schneller“-These: Sie trifft nur auf diejenigen zu, die sich mit Werbeanzeigen auskennen.
Mir war das zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch nicht so klar. Ich dachte, ich setze eine Werbekampagne auf und – schwupps – bringt sie mir zuverlässig neue Menschen in meinen Newsletter.
So einfach ist es dann nicht. Wer als Neuling das erste Mal in einen Werbeanzeigenmanager reinguckt, ist erst einmal komplett überfordert. Er benötigt Tage, wenn nicht gar Wochen, um sich einzuarbeiten und alle wichtigen Funktionen zu verstehen. Denn das Ding ist komplex.
Dann dauert es weitere Wochen, bis der Pixel genügend Daten liefert und sogenannte Custom Audiences so aufgebaut sind, dass man sie sinnvoll nutzen kann.
Die ersten Werbekampagnen funktionieren meist eher so semigut, sodass viele Tests notwendig sind, bis man die Kombination aus Zielgruppe, Anzeige und Text hat, die gute Ergebnisse bringt.
Werbeanzeigen sind nicht notwendigerweise eine Abkürzung – sie sind ein großes, neues, komplexes Feld, das man verstehen und durchdringen muss, bevor man wirklich sagen kann, dass es gut läuft.
Ads sind damit eine viel längerfristige Strategie, als viele Selbstständige glauben. Gefühlt kommen auf jeden Onlineunternehmer, der behauptet, dass er mit Ads so tolle Ergebnisse einfährt, einhundert, die daran verzweifeln.
#9 Das „Die Menschen sind genervt“-Argument
Auf die Frage, warum Meta nicht einfach aufhört, personalisierte Werbung zu zeigen, antwortet das Unternehmen 2020:
„The answer is that we believe that personalized advertising provides the best experience for people and the best value for businesses – particularly small businesses, which make up the vast majority of Facebook’s nine million active advertisers across our services.“ (Quelle)
Unternehmen wie Meta tun gerne so, als wäre personalisierte Werbung für alle Beteiligten eine „tolle Erfahrung“, doch was ist die Aussage wert angesichts der Tatsache, dass personalisierte Werbung nun mal den Kern eines Unternehmens wie Meta trifft?
Wer personalisierte Werbung kritisiert, kritisiert damit auch Metas Geschäftsmodell. Natürlich würde sich Meta niemals die Geschäftsgrundlage entziehen, indem das Unternehmen sagt, dass die Kritik an personalisierter Werbung berechtigt ist.
Und so toll scheint die Erfahrung für die Menschen, die die Werbeanzeigen letzten Endes sehen, dann doch nicht zu sein. Einige Zahlen:
Nur 11% der befragten Menschen wollen laut einer Studie von YouGov überhaupt personalisierte Anzeigen sehen. 57% wollen überhaupt keine personalisierte Anzeigen sehen. 26% keine politischen personalisierten Anzeigen. (Quelle)
Laut einer Studie von European netID Foundation ist die Hälfte der befragten Deutschen von der ungefragten Datenweitergabe genervt. (Quelle)
75% der Deutschen empfinden laut einer Studie von Ogury personalisierte Werbung auf Mobilgeräten als nervig. (Quelle)
Die Genervtheit der Menschen ist verständlich. Wer will denn zum Beispiel als 60-Jähriger Werbung für Inkontinenzeinlagen sehen, nur weil er … eben ein bestimmtes Alter erreicht hat? Oder Werbung für High Heels, nur weil jemand … eben eine Frau ist?
Außerdem stellt sich bei vielen Menschen auch das „Big Brother is watching you“-Gefühl ein. Da haben sie sich nur in einem Onlineshop ein paar Schreibtischstühle angeguckt und kaum machen sie Instagram auf, werden ihnen genau dieselben Produkte angezeigt. Die wenigsten verstehen wohl genau, wie das technisch funktioniert. Und selbst, wer über die Existenz des Pixels Bescheid weiß – das Gefühl, beobachtet zu werden, bleibt. (Und ist alles andere als angenehm.)
Meta is watching you. Egal, was wir im Netz machen, Mark Zuckerberg schaut zu.
#10 Das Investitionsargument
Sind Werbeanzeigen also wirklich eine so gute Investition? Bei der Antwort würde ich nicht lediglich den finanziellen Aspekt berücksichtigen, sondern auch den Faktor Zeit, Energie, Headspace oder Nerven.
Personalisierte Werbung bindet Ressourcen auf allen Ebenen, und sogar wenn FB-Ads ganz okaye Ergebnisse bringen, kann es sein, dass sie uns den letzten Nerv rauben und uns das Leben insgesamt schwerer machen.
Will ich mich mit dem Thema beschäftigen? Will ich mich da weiterbilden? Will ich ständig Dinge testen und optimieren? Will ich täglich meine Kampagne checken? Oder will ich jemanden beauftragen, die Werbekampagnen für mich zu managen? Wie viel Zeit kostet mich das Thema Werbeanzeigen? Und wie viel Energie? Wie viel Geld? Was könnte ich stattdessen tun? Ist es den ganzen Aufwand wert? Wie würde mein Leben ohne Werbeanzeigen aussehen?
All das sind legitime Fragen, die bei der Entscheidung für oder gegen Werbeanzeigen eine Rolle spielen können.
Was ist denn die Alternative zu personalisierter Werbung?
Eine Alternative für unbegrenztes Wachstum habe ich nicht. Aber ich habe eine Alternative für verantwortungsbewusstes Wachstum: kontextualisierte Werbung.
Kontextualisierte Werbung bedeutet, dass Werbung passend zu bestimmten Kontexten erscheint.
Personalisierte Werbung mag mehr Aufmerksamkeit erhalten. Doch kontextualisierte Werbung hat eine höhere Akzeptanz. Außerdem ist kontextualisierte Werbung ein wachsender Markt, der von 106 Milliarden Dollar 2017 auf über 400 Milliarden 2025 wachsen soll. (Quelle)
Wer zum Beispiel in einem Podcast interviewt wird und am Ende des Podcasts auf die Website, den Newsletter oder Onlinekurse verweist, macht auch „Werbung“ für sein Zeugs. Doch:
Dafür müssen keine Daten von Menschen gesammelt werden. Jeder Mensch, der den Podcast hört, hört genau dieselbe Botschaft.
Nachdem sich jemand ein 30- oder 60-minütiges Interview zu einem bestimmten Thema angehört hat, kommt ein Hinweis zu einer Website oder einem Produkt nicht überraschend, sondern ergibt sich aus dem Kontext.
Fazit: Es gibt viele Argumente, die gegen Social-Media-Ads sprechen
Personalisierte Werbung ist für die meisten Selbstständigen und Unternehmen nicht mehr aus dem Marketing wegzudenken. Doch neben den zweifelsohne vorhandenen Pro-Argumenten für personalisierte Ads, gibt es auch viele Argumente dagegen:
#1 Abhängigkeit: Wir machen uns abhängig. Vor allem, wenn unser gesamtes Marketing auf Ads beruht.
#2 Privatsphäre: Für personalisierte Werbung muss das Onlineverhalten von Menschen im großen Stil getrackt werden. Das ist in den meisten Fällen ein Angriff auf die Privatsphäre der Menschen.
#3 Datenschutzrecht: Websitebetreiber*innen sind für die rechtskonforme Einbindung des Meta-Pixels verantwortlich, doch das ist technisch nicht immer so leicht umzusetzen (vor allem, dass der Pixel erst nach dem Einverständnis lädt).
#4 Ethik: Statt Menschen über die Nutzung ihrer Daten aufzuklären, geht es im Marketing immer mehr um „Consent Optimization“, also darum, durch Tricks im Wording und Design möglichst viele Menschen dazu zu bringen, auf „Cookies annehmen“ zu klicken.
#5 Zukunftsfähigkeit: Wie zukunftsfähig Metas Geschäftsmodell mit personalisierter Werbung ist, ist die Frage. Apple bietet inzwischen die Möglichkeit, Tracking abzulehnen, und auch die Politik macht Druck.
#6 Mehr ist nicht immer besser: Wer Menschen ausreichend Zeit gibt, sich für einen Newsletter, ein Webinar oder ein Produkt zu entscheiden, erhöht die Chance, die richtigen Menschen zu erreichen und letzten Endes Abmeldungen zu reduzieren.
#7 Wachstum: Es sollte nicht um maximalen Gewinn gehen, sondern um verantwortungsbewusstes Wachstum. Selbstständige und Unternehmen brauchen Werte, an denen sie sich orientieren.
#8 Langfristigkeit: Dass personalisierte Werbung gute Ergebnisse bringt, setzt voraus, dass man genau weiß, was man tut. Dazu ist entweder ausgebildetes Fachpersonal nötig oder viel Zeit und Übung.
#9 Genervt: Menschen sind von personalisierter Werbung und der Weitergabe ihrer Daten immer mehr genervt.
#10 Investition: Ob Werbeanzeigen eine gute Investition sind, ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch von Zeit, Energie, Hirnschmalz und Nerven.
(1) Beispiel von Edward Snowden
(2) Ich bin natürlich keine Anwältin und dieser Text stellt keine Rechtsberatung dar. Ich gebe nur die Rechtslage nach bestem Wissen und Gewissen weiter.
Website-Texte ohne toxisches Marketing – Gastartikel von Allegra Bob
Dies ist ein Gastartikel von Allegra Bob. Allegra ist Texterin für menschliches Marketing. In ihrem Artikel zeigt sie, wie du Websitetexte schreiben kannst, mit denen du auch ohne toxisches Marketing neue Kund*innen anziehst.
Das ist ein Gastartikel von Allegra Bob. Allegra ist Texterin für menschliches Marketing. Als solche unterstützt sie andere Selbständige dabei, auf ihre Art sichtbar zu werden und ihre Traumkundschaft zu begeistern: mit ihren Werten, ihrer Persönlichkeit und Expertise. Mit Inhalten, die inspirieren. Mit Empathie statt Manipulation. In ihrem Newsletter „Writing Rebels“ teilt sie auch regelmäßig Text-Tipps und Impulse für neue Töne im Marketing. Mehr über Allegra und darüber, wie du mit ihr zusammenarbeiten kannst, erfährst du auf ihrer Website.
Eine Website, die dir regelmäßig wertschätzende Kundschaft beschert. Die 24/7 für dich arbeitet – ohne dass du ständig vor der Kamera rumtanzen musst. Die dir gehört und nicht von den Launen eines Algorithmus oder eines Mark Zuckerberg abhängt. Das klingt wohl für viele Selbstständige verheißungsvoll.
Sehr viel weniger verheißungsvoll klingt dagegen: Website-Texte schreiben, die verkaufen. Denn darum geht’s ja letztendlich, oder? Ums Verkaufen.
Oh je. Beim Thema Verkaufen drehen die negativen Assoziationen gerne direkt frei:
„Ich muss anderen was andrehen.“
„Ich muss mich selbst gut verkaufen.“
„Ich muss dafür sämtliche Copywriting-Tipps umsetzen, die ich im Internet finden kann.“
Ich möchte dich beruhigen und dir erst mal sagen: Du musst gar nichts.
Und: Es geht auch anders.
Zum Beispiel so, dass du und dein Publikum euch gleichermaßen wohlfühlen.
Dafür schreibe ich heute diesen Artikel: Damit du Website-Texte schreiben kannst, mit denen du auch ohne toxisches Marketing neue Kund*innen anziehst und sie auch wirklich und ehrlich begeisterst.
Hier kommen ein paar Impulse für solche Texte.
Es muss nicht weh tun
„Aua.“ Das denke ich ab und zu, wenn ich Verkaufstexte lese.
Und das scheint auch das Ziel zu sein: ordentlich auf den sogenannten „Pain Points“ rumreiten – und anschließend die erleuchtende Lösung präsentieren.
Ich will das nicht verurteilen. Ich denke, viele haben es einfach genauso gelernt. Sie haben gelernt, dass das so funktioniert. Und das tut es ja offenbar. Wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass das so geht.
Ich habe nur irgendwann angefangen, da mal drüber nachzudenken und kam zu dem Schluss: Ich finde das ganz schön problematisch.
Ich will niemandem sagen: „Du kannst einfach nicht schreiben. Du sitzt schon wieder vor dem weißen Blatt, das dich unbarmherzig anstarrt. Du fühlst dich wie in der Deutscharbeit in der 9. Klasse und weißt jetzt schon: Das wird wieder eine 5. Doch das muss nicht sein! Mit einer Texterin …“ Und so weiter.
Fühlt sich dadurch irgendwer motiviert, inspiriert, empowered? Wohl eher nicht. Ich finde es allerdings wichtig, dass (meine) Texte motivieren, inspirieren, empowern.
Ich will niemandem weh tun, indem ich noch Salz in die Wunde streue. Ich würde auch mit niemandem so reden. Also warum sollte ich es schreiben?
Klar: Wenn du ansprichst, wo bei deiner Zielgruppe der Schuh drückt, zeigst du ihr: Du verstehst sie. Du weißt, wo sie stehen – und kannst sie dort abholen.
Du musst das ja auch nicht völlig ignorieren. Ich möchte dich nur anregen, dich bewusst zu fragen: Willst du das ansprechen – und wenn ja, wie?
Wenn du es sensibler tun willst, habe ich hier drei Anregungen, wie das gehen kann:
#1 Fragen stellen statt Annahmen formulieren
Statt Unbekannten zu erklären:
„Du hast folgendes Problem …“
„Du fragst dich oft …“
„Du weißt einfach nicht …“
Lieber Fragen stellen:
„Geht’s dir auch manchmal so (wie mir)? …“
„Hast du auch (keine) Lust auf …?“
„Kommt dir das bekannt vor? …“
#2 Die „Pain Points“ als häufiges, aber nicht allgemeingültiges Phänomen darstellen
„Vielen meiner Kund*innen geht es so: …“
„Vielleicht kennst du das: …“
#3 Nicht mit den „Pain Points“ starten, sondern direkt mit dem Wunschzustand – sozusagen den „Gain Points“
„Wie wäre es, wenn …?“
„Stell dir vor …“
Womöglich hilft es uns auch, den Begriff „Pain Points“ selbst kritischer zu sehen – oder ihn gleich ganz zu ersetzen. (Du siehst anhand der Gänsefüßchen schon, dass ich ihn nicht einfach so nutzen kann und will.) Warum muss es schon wieder so ein Anglizismus sein? Damit wir Marketing-Leute schlau klingen?
Warum sprechen wir nicht einfach von Herausforderungen? Anliegen? Beweggründen? Antrieb? Motivation? Anreizen? Impulsen?
Ich muss doch nicht immer Schmerzen haben, um etwas kaufen zu wollen.
Und ich bin sicher: Du findest noch viele schönere Alternativen. Im Internet gibt es reichlich Synonyme für jedes Wort.
Positive Gefühle erzeugen statt FOMO
Freude.
Überraschung.
Angst.
Wut.
Ekel.
Trauer.
Verachtung.
Das sind die sieben Basis-Emotionen nach dem US-amerikanischen Anthropologen und Psychologen Paul Ekman.
Welche davon willst du mit deinem Marketing hervorrufen?
Ich habe den Eindruck, viele entscheiden sich für die Angst. Oder sie entscheiden sich gar nicht – sondern machen es einfach, weil „man“ es halt so macht. (Hinter diesem „man“ kann man sich leicht verstecken. Niemand weiß so genau, wer und wo es ist.)
„Man“ arbeitet jedenfalls gerne mal mit FOMO. Also „Fear of missing out“.
Mach den Leuten Angst, dass sie was verpassen, wenn sie dein Angebot nicht kaufen. Erkläre ihnen, dass das super dumm von ihnen wäre. Dass sie sich dann mega schlecht fühlen würden. Das ist leicht und effektiv. Es funktioniert.
Leider.
Und wieder denke ich: Ich will das aber nicht.
Ich will nicht, dass eine Person auf meine Frage, was sie zu mir führt, antwortet: „Angst.“ Ich will positive Gefühle und Zustände erzeugen. Wie Freude. Leichtigkeit. Sicherheit. Dieses Szenario entwerfe ich zum Beispiel auf meiner Website:
Du brauchst keine wildfremden Leute mehr anzuschreiben oder auf TikTok zu tanzen – du erhältst automatisch regelmäßig Anfragen über deine Website.
Diese Anfragen kommen von Menschen, die dich als Expertin sehen und schon wissen, dass sie dein Angebot wollen.
Diese Menschen zahlen gerne deine Preise und fragen dich nicht, ob das nicht etwas günstiger und schneller geht.
Falls doch jemand so etwas tut, schickst du ihn freundlich lächelnd woanders hin – denn du kannst deinen Kalender mit den Projekten füllen, die dir Spaß machen.
Du freust dich über die vielen Besucher*innen, denen du deine Website mit Stolz präsentieren kannst.
Ich denke, damit mache ich ein positives Angebot – das du auch ablehnen kannst, ohne dich schlecht zu fühlen.
Und ja – auch das funktioniert. Und erzeugt auch Freude bei mir selbst. Probier es ruhig mal aus.
Es gibt nicht den einen Weg, der alle zum Erfolg führt
Eine Taktik, die für mich mit FOMO zusammenhängt: so tun, als wäre Angebot A die einzige Lösung. Der einzige Weg, mit dem du wieder glücklich wirst.
Heißt umgekehrt: Wenn du es nicht buchst, gibt es für dich keine solche Möglichkeit mehr. Das erzeugt dann wahrscheinlich bei vielen FOMO.
Ich würde gerne mal eine Umfrage unter Selbständigen starten: „Glaubst du, dein Angebot oder deine Methode ist das/die einzig wahre? Und wer das nicht genauso macht, kommt nicht ans Ziel?“
Ich hoffe, das würden alle als rhetorische Frage erkennen. Denn natürlich führen viele Wege nach Rom. Natürlich kannst du auch ohne mich gelungene Website-Texte schreiben.
Jetzt kommt aber noch ein Aber: Ich glaube nicht, dass jeder alles schaffen kann.
Ich habe einfach genug von Aussagen wie: „Mit meinem Money-Mindset-Coaching erreichst du sechsstellige Monatsumsätze!“
Ach ja? Auch wenn ich chronisch krank bin? Oder alleinerziehend?
Gibst du mir darauf eine Garantie – und wenn es nicht klappt, den sechsstelligen Umsatz? Wahrscheinlich nicht.
Ich finde es unethisch, solche Versprechen zu machen – aus zwei Gründen:
1. Du kannst es nicht seriös garantieren.
2. Du hast keine Ahnung von der Lebenswirklichkeit der Person, die das liest. Deshalb sage ich: Ich würd’s lassen. Aber ich will das nicht verallgemeinern.
Aussagen differenzieren – durch Modalverben
Okay, und wie kannst du solchen Verallgemeinerungen und Versprechen sprachlich etwas entgegensetzen?
Dafür gebe ich dir einen Tipp, mit dem DIE Copywriting-Gurus mich wahrscheinlich mit ihren Standardwerken erschlagen würden:
Streue Modalverben ein.
Ja, hat sie grade wirklich gesagt. Als Texterin.
Lass es mich erklären: Grundsätzlich stehe ich auch für klare Ansagen. Für „Ich texte deine Website“ statt „Ich kann deine Website texten“ (wenn ich es wollte).
Aber ich sage niemandem: „Ich schreibe für dich Blogartikel, die bei Google auf Platz 1 ranken.“ Das kann ich nämlich nicht versprechen.
Genauso will ich eben vermitteln, dass mein Angebot nicht die einzige Lösung ist – z.B. so: „Eine Texterin kann dir helfen, die richtigen Worte für dein Angebot zu finden.“
Auf diese Weise tust du auch eins:
Deinem Publikum das letzte Wort überlassen
Die Kaufentscheidung liegt bei der Person, die kauft.
Mich irritieren daher Sätze wie „Hier bist du genau richtig!“ Das weiß ich als Leserin doch besser, ob ich mich hier genau richtig fühle.
Wie kannst du also deinen Website-Besucher*innen das letzte Wort überlassen?
Eine Möglichkeit, die ich mag: mit dem Call-To-Action. Denn der ist gewissermaßen oft das letzte Wort.
Auf meiner Seite steht daher nicht auf jedem Button: „Buche hier dein kostenloses Erstgespräch!“ Sondern: „Erzähl mir mehr!“, „Ja, ich will!“, „Ich möchte mehr erfahren!“ und Ähnliches.
Wichtig: Ich verkaufe nichts auf meiner Seite. Diese Buttons leiten zu Unterseiten (wenn jemand mehr über mich oder meine Leistungen erfahren will) und insbesondere meiner Kontaktseite weiter (um ein Kennenlernen zu vereinbaren).
Bei einem Kauf-Button gilt: Er muss „unmissverständlich beschriftet sein und eindeutig erkennen lassen, dass durch Betätigung ein rechtsgültiger Kaufvertrag geschlossen wird, der mit einer Zahlungsforderung verbunden ist.“ (Sagt Digistore.)
Hier wird es also schnell unethisch, wenn eine Person unwissentlich einen Kaufvertrag schließt, weil sie „Ja, ich will!“ so schön findet.
Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt:
Transparenz und dadurch Vertrauen schaffen
Warum ich Transparenz so wichtig finde?
Weil du den Menschen auf deiner Seite damit die nötige Sicherheit gibst. Ein gutes Gefühl.
Transparenz schafft Vertrauen, dass sie bei dir wirklich richtig sind (und du das nicht nur schreibst). Dass du hältst, was du versprichst. Dass du kurz gesagt ein anständiger Mensch bist.
Wie kannst du Transparenz herstellen?
Ich finde: Das ist für jede der klassischen Unterseiten wichtig.
Auf deiner Über-Seite kannst du z.B.
Zeigen, wer du bist – mit vollem Namen und Bild. (Klingt banal, aber vergessen manche gerne.)
Deine Mission teilen: Warum tust du, was du tust? Hast du eine Geschichte zu erzählen, mit der andere sich identifizieren können?
Deinen Werdegang und deine Erfahrungen beschreiben: Warum kannst du das tun? Und: Hast du Beweise dafür (Auszeichnungen, Testimonials)? Denn wenn neben dir auch andere wohlwollend über dich sprechen, schafft das gleich mehr Vertrauen.
Auf deiner Angebots- oder Verkaufsseite kannst du dein Angebot detailliert beschreiben:
Wie läuft die Zusammenarbeit mit dir ab?
Welche Leistungen sind enthalten?
Was kostet das?
Welche häufigen Fragen und Einwände kannst du direkt klären? (FAQ)
So wissen die Leute genau, was sie bei dir wirklich bekommen. Natürlich kannst du auch hier noch mal eine Kundenstimme einbauen.
Und sogar auf deiner Kontaktseite finde ich Transparenz wichtig:
Wo sitzt dein Unternehmen?
Wann und wie bist du erreichbar?
Wie lange dauert es etwa, bis du auf Anfragen reagierst?
Mit Humor eine menschliche Verbindung herstellen
Es gibt ein weiteres, oft unterschätztes Mittel, um Vertrauen und Sympathie aufzubauen: Humor.
Nein, Humor auf Websites ist nicht unseriös. Manche bierernsten, hochtrabenden Formulierungen dagegen oft unfreiwillig komisch.
Ich meine: Lieber gewollt als ungewollt.
Du kennst ja schließlich auch sicher den alten Marketingsatz: „Menschen kaufen von Menschen.“ (Ka-Tching, 1 € fürs Phrasenschwein.) Und mit Humor zeigst du dich als menschliches Wesen – und ziehst andere auf menschliche Weise an.
Texte so schreiben, dass sie alle ansprechen
Ich kenne es von vielen anderen Selbständigen – und mir selbst: den Wunsch, mit dem eigenen Angebot möglichst viele/alle anzusprechen.
Was deine Positionierung und Zielgruppe betrifft, ist das sicher kein guter Rat. Aber: Ich finde schon, du kannst deine Texte so schreiben, dass sich alle angesprochen fühlen. Genauer gesagt: nicht nur Männer.
Für mich ist das ein ganz wichtiger Grund fürs Gendern: Ich möchte, dass sich zumindest hinsichtlich ihrer geschlechtlichen Identität alle in meinen Texten wiederfinden.
Und die Möglichkeiten dafür sind so bunt wie unsere Gesellschaft selbst:
Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich
adjektivische Umschreibungen („der ärztliche Rat lautet …“)
neutrale Formulierungen („Ansprechperson“)
direkte Ansprache („Du bekommst bei mir …“ statt „Meine Kunden bekommen bei mir …“) – das hilft auch dabei, Nähe aufzubauen
passive Formen (lieber sparsam!)
…
Was ich beim Gendern wichtig finde:
1. Dass du dir die Zeit nimmst, deinen Umgang damit bewusst zu entwickeln.
2. Dass du entspannt und flexibel rangehst. (Wie ans Marketing allgemein.)
Ich bin sicher, du findest deinen Weg, deine Wunschkundschaft menschlich anzusprechen – so, dass sie sich genauso gut damit fühlt wie du.
Texte fertig?
Du hast deine Website-Texte geschrieben – und weißt nicht so recht, ob das so gut ist? Dann kann ich dir zwei Dinge empfehlen:
1. Frage andere: „Wie wirkt der Text auf dich?“
2. Frage dich: „Würde ich so auch mit jemandem reden?“ Wie fühlt sich das an? Ich denke, du kannst bei ganz vielem auf deinen Bauch hören. Mehr als auf Marketing-Gurus.
Ich hoffe trotzdem, dass du zusätzlich zu deinem Bauchgefühl auch von meinen Tipps etwas mitnehmen kannst und sie dir das (Website-)Texten erleichtern.
Denk immer dran: Du machst dein Marketing nicht auf eine bestimmte Art, weil die nun mal funktioniert. Sondern weil DU das so möchtest.
Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks – ein Leitfaden
Marketing ohne Manipulation – wie geht das genau? Darauf möchte ich in diesem Blogartikel eingehen und zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Druck und Psychotricks mit dir teilen.
Hier sind zwölf Grundsätze für ein wertschätzendes Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks:
#1 Wir lassen Menschen die Wahl
Downloads an Newsletter koppeln …
Webinare an Newsletter koppeln …
Wartelisten an Newsletter koppeln …
Käufe an Newsletter koppeln …
Es ist inzwischen völlig normal geworden, dass wir – egal, wofür wir uns anmelden – automatisch einen Newsletter bekommen, sodass wir gar nicht mehr in Frage stellen, ob das überhaupt okay ist oder ob das nicht auch anders ginge.
Ich bin dafür, nicht mehr einfach so anzunehmen, dass jemand unseren Newsletter bekommen will, nur weil er oder sie sich mal zu einem unserer Webinare angemeldet hat.
Lassen wir Menschen doch stattdessen die Wahl: Sie können ein Webinar von uns besuchen und sich dabei für unseren Newsletter anmelden – müssen es aber nicht.
Aus meiner Sicht ist nämlich nicht das Koppeln an sich problematisch, sondern weil es zum einen ungefragt passiert und zum anderen keine andere Handlungsoption zur Verfügung steht.
Es spricht aus meiner Sicht nämlich überhaupt nichts dagegen …
beim Bestellformular auf Digistore oder Elopage eine Checkbox zu aktivieren und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich beim Kauf gleichzeitig auch zum Newsletter anzumelden
Menschen, die sich für ein Webinar oder ein anderes Online-Event angemeldet haben, nach dem Event eine Mail zu schicken und sie zu fragen, ob sie in Zukunft auch den Newsletter bekommen wollen
Das ist kein Zwang, sondern ein Angebot, das angenommen werden kann oder auch nicht.
Natürlich bedeutet das für uns Unternehmer*innen einen Mehraufwand. Und natürlich geht Listenwachstum so langsamer als mit ungefragtem Koppeln.
Doch es ist so: Wenn wir unsere E-Mail-Liste füllen, indem wir Menschen keine Wahl lassen und sie ungefragt hinzufügen, haben wir eine Menge Leute drin, die gar nicht explizit „Ja“ zu unserem Newsletter gesagt haben und sich vermutlich sowieso bald wieder abmelden werden. Und wem ist damit geholfen?
#2 Wir lassen Zeit für bewusste Kaufentscheidungen
Natürlich können wir als Unternehmer*innen nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern müssen Geld verdienen und unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen.
Doch das sollte kein Freifahrtschein sein, Menschen als Objekte zu behandeln und sie in unsere Programme „hineinzufunneln“.
Wenn wir ein Webinar halten, am Ende unser Onlineprogramm pitchen und Menschen genau drei Tage Zeit lassen, sich für oder gegen ein hochpreisiges Coaching zu entscheiden, ist das eine Menge Druck.
Und es wird nicht leichter, wenn wir dabei einen Bonus versprechen, der genau 24 Stunden gültig ist. Oder an einem Tag drölfzig E-Mails mit der immer gleichen Botschaft schicken: Die „Türen“ schließen gleich! Meld dich jetzt an! Sonst verpasst du was!
Lasst uns stattdessen Türen öffnen und unsere Pitches als Angebote verstehen.
Lasst uns Webinare oder andere Online-Events nach dem Motto „Hier ist das, was ich weiß. Und hier ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten.“ gestalten.
Ohne Zeitdruck. Ohne Psychospielchen. Und ohne repetitive Mails.
Werden sich dadurch weniger Menschen für unsere Onlineprogramme anmelden? Vermutlich.
Aber es werden Menschen sein, die sich aus freien Stücken für uns entschieden haben und perfekt zu uns und unseren Werten passen.
Und ist das nicht eine großartige Vorstellung und die beste Basis für eine gelungene Zusammenarbeit?
#3 Wir machen Preise ohne Gedöns
Hören wir doch endlich auf, bei unseren Preisen zu tricksen.
Hören wir doch endlich damit, „charmante“ Preise zu verwenden, die völlig willkürlich auf „9“ oder „7“ enden, um das Produkt günstiger erscheinen zu lassen.
Hören wird doch endlich auf damit, Menschen mit Rabatten in unsere Programme zu locken.
Arbeiten die meisten Onlineunternehmer*innen mit solchen Preistricks? Oh ja.
Doch das sollte uns nicht davon abhalten, einen anderen Weg einzuschlagen und den „richtigen“ Preis zu kommunizieren – egal, wie früh, spät, schnell oder langsam sich Menschen für einen Kauf entscheiden.
Außerdem ist es auch für mich als Onlineunternehmerin herrlich entspannend, meine Preise ohne Gedöns zu gestalten und mir keinen Kopf mehr über spezielle „Frühbucherpreise“, „Webinarpreise“, „Early-Bird-Preise“ oder „Black-Friday-Aktionen“ mehr machen zu müssen.
#4 Wir ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe
Apropos Preise: Selbst wenn unser Produkt nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurde und jeden einzelnen Cent wert ist, können sich nicht immer alle Menschen unsere Angebote leisten.
Und das hat auch nicht zwingend etwas mit einem „falschen Mindset“ oder „zu wenig Commitment“ zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass unterschiedliche Menschen über unterschiedliche Privilegien und damit finanzielle Ressourcen verfügen. (Und mit Fakten wie Inflation und sinkender Kaufkraft.)
Die Gründe sind vielfältig – und natürlich sind wir für die Finanzen unserer Kund*innen nicht verantwortlich.
Aber es heißt nicht, dass wir diese Situation noch mehr ausnutzen und mit Aufpreisen bei Ratenzahlungen arbeiten sollten.
Sehen wir den buchhalterischen Mehraufwand und das Risiko eines Zahlungsausfalls doch als das, was es ist: Ein Beitrag, dass sich auch Unternehmer*innen mit weniger finanziellen Mitteln ihre beruflichen Ziele erreichen.
#5 Wir triggern keine Ängste
Jede Kaufentscheidung ist ein emotionaler Vorgang, heißt es. Deshalb sollten wir im Marketing auch Emotionen wecken.
Ob alleine das schon problematisch ist, würde an dieser Stelle vermutlich zu weit führen. Mit Sicherheit problematisch ist es, wenn Marketing dazu genutzt wird, Urängste der Menschen zu triggern.
Die Angst, nicht dazuzugehören, zum Beispiel.
Oder die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.
So ist FOMO im Marketing nicht etwa eine super-duper „Strategie, die die Verkäufe ankurbelt“, sondern eine Strategie, die eine zutiefst menschliche Veranlagung für Profit ausnutzt.
Manchmal ist es hilfreich, sich zu fragen, wie man das, was man da gerade schreibt, selbst auffassen würde:
Würde das einen selbst stressen und unter Druck setzen? Würde es einen unruhig werden lassen?
Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es anderen Menschen ähnlich gehen könnte.
Hören wir doch auf, mit den Ängsten der Menschen zu spielen, als wären sie Pingpongbälle, die wir beliebig durch die Gegend werfen könnten.
#6 Wir säen Samen und legen Spuren
Erzeugt das Wort Reichweite bei dir genau so viel Druck wie bei mir?
Ich habe für mich festgestellt, dass mich alleine schon der Gedanke, meine „Reichweite vergrößern“ zu müssen, stresst und dass es mich mehr mit Zahlen und Funnels beschäftigen lässt als mit Menschen, Werten und Themen.
Inzwischen habe ich den Begriff der Reichweite ersetzt durch Samen säen.
Wenn ich in einem Podcast interviewt werde, habe ich einen Samen gesät. Ich weiß nicht, wie lange der Samen brauchen wird, damit eine Pflanze daraus wächst – einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr – aber ich weiß, dass die Zeit für mich arbeitet.
Möglicherweise wird sich schon heute jemand die Podcastfolge anhören und neugierig auf meiner Website landen. Möglicherweise wird sich aber auch erst nächste Woche jemand einen meiner Onlinekurse holen und mir daraufhin eine E-Mail schreiben. Oder vielleicht wird sich auch erst in einem Monat oder in einem Jahr jemand melden und sagen:
„Eine Freundin hat die Podcastfolge mit dir gehört und mich dir empfohlen – und hier bin ich nun und will in deinem Schreibcircle dabei sein.“
Wir können die Ergebnisse unserer Bemühungen, „Reichweite“ zu erzeugen, nie mit Gewissheit vorhersagen. Und meinem Verständnis nach müssen wir es auch nicht.
Es reicht, wenn wir uns auf unsere Themen besinnen und Samen säen – dann kommen die Früchte mit der Zeit von alleine.
#7 Wir arbeiten ohne versteckte Kosten
Was ich völlig unproblematisch finde und auch selbst mache, ist die glasklare Kommunikation eines Angebots nach einer Zusammenarbeit:
„Hey, dir hat der Schreibcircle gefallen und du möchtest ein zweites Mal dabei sein? Hier kannst du deinen Platz buchen.“
Völlig anders sieht es allerdings für mich aus, wenn während eines Onlineprogramms plötzlich klar wird, dass die Teilnehmer*innen für alles, womit für das Programm geworben wurde, zusätzlich zahlen müssen. Das ist nicht in Ordnung.
Denn nicht selten befinden sich die Teilnehmer*innen sogar in einer vulnerablen Lage. Sie haben sich „nackig“ gemacht und nun sagt die Coachin: „Ja, schlimmes Problem. Um das zu lösen, solltest du am besten eine zusätzliche Einzelsitzung bei mir buchen.“ Und schwupps, ist die Coachin wieder um mehrere tausend Euro reicher.
Lasst uns also Onlineprogramme erstellen, die für sich stehen und Menschen bereits wertvolle Lösungen bieten. Und wer weiß? Vielleicht arbeiten die Teilnehmer*innen ja sogar gerne ein zweites Mal mit uns zusammen – freiwillig.
#8 Wir sind ehrlich und transparent
Neulich hat mir jemand erzählt, dass sie in den ersten Wochen nach dem Kauf eines Onlineprogramms feststellen musste, dass die gemeinsamen Calls gar nicht von der Onlineunternehmerin, bei der sie gekauft hat, betreut wurden, sondern von einer Mitarbeiterin.
Nun spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, ein Team zu haben und Mitarbeiter*innen in die Betreuung der Teilnehmer*innen einzubinden. Allerdings ist es eine fragwürdige Strategie, das nicht vor dem Kauf so zu kommunizieren.
Wenn eine virtuelle Assistenz nicht bloß ergänzend in der FB-Gruppe nach dem Rechten sieht, sondern ausschließlich, will ich das vor dem Kauf wissen.
Wenn Menschen dir zwar Geld für dein Onlineprogramm zahlen, dich aber in den gemeinsamen Calls nur in der ersten Woche zu Gesicht kriegen, auch.
Und wer das nicht macht, wer seine Onlineprogramme auf Kosten von Ehrlichkeit und Transparenz skaliert, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er die potentiellen Käufer*innen nicht bewusst damit täuscht.
Lasst uns Menschen stattdessen Wertschätzung entgegenbringen und transparent sein, wie viel oder wenig sie von uns in unseren Programmen sehen werden, sodass sie selbst entscheiden können, ob ihnen das Programm den Preis wert ist.
Was sich übrigens hervorragend mit Transparenz kombinieren lässt, ist das Prinzip von Working out loud, sprich: Wir arbeiten nicht für uns in unserem stillen Kämmerlein, sondern lassen unsere Community an Gedanken, Prozessen und Hintergründen teilhaben.
Indem wir beispielsweise mal in einem Blogartikel erzählen, warum jetzt Mitarbeiterin X die Kursteilnehmer*innen betreut oder Mitarbeiterin Y jetzt die Calls zu Thema Z durchführt (möglicherweise ist sie in einem bestimmten Thema nämlich viel tiefer drin als du).
#9 Wir verzichten auf künstliche Verknappung
Marketing ohne Manipulation und künstliche Verknappungen sind keine gute Kombination.
Wenn ich also schon im Juli weiß, dass ich ab September eine neue Runde Schreibcircle anbieten will, aber erst kurz vorher mit einem Knall die Türen öffne – ist das eine Form der Verknappung, die streng genommen nicht nötig wäre und die natürlich viel eher dazu führt, dass ich in dieser kurzen Zeit mit Druck und Psychotricks arbeite, um das Programm zu füllen.
Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns willkürlich Boni überlegen, die es für eine willkürliche Anzahl an Stunden kostenlos dazugibt. Oder Rabatte, die nur gültig sind, solange das Webinar noch läuft.
Künstliche Verknappung erzeugt (unnötigerweise) Druck und führt nicht selten dazu, dass auch wir Onlineunternehmer*innen Launches als unglaublich anstrengend empfinden und gleich nach dem Launch schon urlaubsreif sind.
Wenn ich in meinem Programm allerdings nur 12 Plätze anbiete, weil ich weiß, dass das die Grenze ist, bei der ich individuelle Unterstützung garantieren kann, ist es keine künstliche Verknappung, sondern Verknappung mit einem guten, nachvollziehbaren Grund.
Ebenso wenig finde ich es problematisch, einen einheitlichen Starttermin zu haben und zu kommunizieren, dass man Anmeldungen nur bis zu diesem Datum annimmt, um eben gemeinsam als Gruppe starten zu können.
Natürlich brauche ich für solche natürlichen Verknappungen Klarheit darüber, wo meine persönlichen Grenzen sind.
Wie viele Stunden kann ich am Tag arbeiten, ohne auszubrennen?
Wie viele Menschen kann ich realistischerweise gleichzeitig unterstützen?
Wie viele Plätze kann dieses Programm haben, sodass eine gute Betreuung gewährleistet ist?
Und wenn ich das weiß, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es auch offen so – „working out loud“-mäßig – zu kommunizieren. So wie Hotels unaufgeregt kommunizieren, wie viel freie Betten sie haben.
#10 Wir stehen für Werte ein
Die meisten Selbstständigen wollen wachsen und es spricht ja zunächst einmal auch gar nichts dagegen:
Mehr Menschen auf der Website und auf der E-Mail-Liste bedeuten in vielen Fällen auch mehr zahlende Kund*innen und damit mehr Geld – für ein höheres Gehalt, für größere Rücklagen, für mehr Investitionen oder einfach nur für ein schöneres Leben.
Es spricht überhaupt nichts dagegen, mehr zu wollen. – Doch welche Werte haben wir neben Wachstum noch?
Wenn wir wachsen und skalieren, ohne No-Gos für uns zu definieren, überschreiten wir nicht selten auch ethisch-moralische Grenzen.
Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei massiv der Umwelt schaden?
Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei andere Menschen belügen oder die Fakten zumindest so drehen, dass sie noch besser zu unserer Message passen?
Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir die Not der Menschen ausnutzen? Oder sie dazu ermuntern, Kredite aufzunehmen, um sich unsere Programme leisten zu können? Oder gar künstlich einen Bedarf kreieren, den es so gar nicht gibt?
Lasst uns also eine Grenze fürs Wachstum definieren – und auch entsprechend so handeln. Hier findest du eine Liste von Werten, an denen du dich in deinem Marketing orientieren kannst.
#11 Wir prüfen unsere Definition von Erfolg
Ich höre jetzt quasi schon die Stimmen, die da zweifelnd flüstern. „Hmmmm, und mit diesem Marketing kann man Erfolg haben?“
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es deshalb nicht, weil ich nicht weiß, was „Erfolg“ für dich bedeutet.
Verstehst du „Erfolg“ auf einer rein finanziellen Ebene, werden dir mit einem Marketing ohne Druck sicherlich einige Käufer*innen „durch die Lappen gehen“. Diejenigen nämlich, die gelockt und überredet werden wollen. Und die nur dann kaufen, weil sie FOMO bekommen, wenn sie nur daran denken, dass „die Türen“ bereits in drei Tagen wieder schließen.
Ist „Erfolg“ für dich mehr als nur Umsatz und ist es für dich nicht nur wichtig, Menschen zu erreichen, sondern die richtigen, sieht es schon wieder anders aus. Denn ein Leben, in dem deine Kund*innen nett, motiviert und wertschätzend sind und sich zu 100% aus freien Stücken für dich entschieden haben, hört sich für mich nach einem verdammt guten an.
#12 Wir denken langfristig
Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt: der Langfristigkeit.
Die Sache ist nämlich die: Manipulation funktioniert – aber nur kurzfristig.
Vielleicht gelingt es uns, unsere Umsatz- und Marketingziele zu erreichen und abends eine Flasche Champagner zu köpfen.
Doch was ist, wenn …
sich die Menschen, die bei uns gekauft haben, in Wahrheit zu der Entscheidung gedrängt gefühlt haben?
die Menschen in unseren Programmen gar nicht wirklich motiviert sind und deshalb keine guten Ergebnisse vorweisen?
wir den Druck, den wir auf andere Menschen ausgeübt haben, selbst in unserem Körper spüren, speichern und so immer mehr erschöpfen?
Was bedeuten diese manipulativen Taktiken für uns, unser Unternehmen und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf lange Sicht? Diese Frage darf jede*r für sich beantworten.
Hast du noch weitere Fragen zum Thema Marketing ohne Manipulation? Vielleicht wirst du hier fündig
Ist Marketing nicht „von Natur aus“ Manipulation?
Natürlich könnte man sagen: Kommunikation (und damit Marketing) ist immer ein Stück weit „manipulierend“. Und ja: Wenn ich mit anderen Menschen rede oder einen Text schreibe, mit dem ich etwas bewirken will, nehme ich bewusst oder unbewusst immer auch Einfluss auf die Gedanken, Gefühle und damit Entscheidungen der Menschen. Wir könnten „Manipulation“ so verstehen. Doch das wäre aus meiner Sicht ein sehr weiter Manipulationsbegriff.
Manipulatives Marketing meint für mich mehr. Es beinhaltet nicht nur Kommunikation und Selbstausdruck, sondern auch das Ausnutzen der menschlichen Psyche im Namen des Wachstums. Es beinhaltet nicht nur das Über-ein-Angebot-Sprechen, sondern ein Verkaufen um jeden Preis ohne Rückkopplung an Werte.
Bemühe ich mich, Menschen bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen, indem ich in meinem Marketing zum Beispiel deutlich mache, wofür ich stehe und welche Werte ich vertrete, für wen das Produkt richtig ist (und für wen nicht) oder welche Ergebnisse ich erwarten kann (und welche nicht), ist das aus meiner Sicht Transparenz – und keine Manipulation.
Ist ein Sales Funnel immer manipulierend?
Aus meiner Sicht ist es völlig unproblematisch, sich die Customer Journey zu durchdenken und sich zu fragen: Welche Stationen nehmen Menschen, bevor sie schließlich bei mir kaufen?
Wie will ich gefunden werden? (z.B. durch meinen Blog)
Wie will ich mit ihnen in Kontakt kommen? (z.B. in meinem Newsletter)
Wie will ich über meine Angebote sprechen? (z.B. in Blog und Newsletter)
Die Antworten auf diese Fragen helfen mir dabei, Klarheit in meinem Marketing zu bekommen und zu entscheiden, wo ich meine Zeit, Energie und mein Geld investieren möchte.
Im Grunde kann ein „Sales Funnel“ durchaus etwas Ähnliches meinen, doch für mich ist das Menschenbild hinter dem Begriff ein anderes:
Da ist der Verkaufsprozess nicht etwa eine Reise und die anderen Menschen die Akteure, die selbstbestimmt und in ihrem Tempo den Weg zu mir finden dürfen. Bei einem Sales Funnel werden andere Menschen dem Begriff nach in einen Trichter gesteckt, sie fallen quasi durch, sind mehr passive Objekte als selbstbestimmte Akteure. Und am Ende des Trichters müssen sie durch die enge Öffnung gequetscht werden …
Das ist für mich nicht unbedingt eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen. Deshalb nutze ich den Begriff „Sales Funnel“ nicht mehr und spreche lieber von „Customer Journey“.
Ist Werbung immer Manipulation?
Auch hier kommt es aus meiner Sicht darauf an, wie eng oder weit wir den Begriff der Manipulation fassen.
Natürlich geben wir durch unsere Ads etwas Bestimmtem – einem Blogartikel, einem Webinar, einem Produkt – mehr Aufmerksamkeit, als es ohne die Ad bekommen würde. Ist diese Sichtbarkeit alleine schon Manipulation? Aus meiner Sicht nicht unbedingt.
Die Onlineunternehmerin, die ihr E-Book bewirbt, manipuliert meinem Verständnis nach also nicht zwingend, nur weil sie auf Instagram eine Ad schaltet.
Entscheidender sind für mich folgende Fragen:
Was bewerben wir? Bedienen wir mit unserem Angebot Wünsche von Menschen oder kreieren wir Sehnsüchte, die ursprünglich gar nicht da waren?
Wie bewerben wir es? Machen wir in unserer Ad „nur“ ein Angebot oder nutzen wir in unseren Werbebotschaften FOMO, um Angst vorm Verpassen zu erzeugen?
Was passiert nach der Ad? Können die Menschen einfach nur die beworbene Handlung ausführen oder kommen sie in ein ausgeklügeltes System von Tripwires, Upsells, Downsells und aggressiven E-Mail-Marketing, aus dem es kaum ein Entkommen mehr gibt?
Darüber hinaus sind mit Werbung natürlich auch viele ethische Fragen verbunden:
Welches System unterstützen wir, wenn wir eine Ad auf einer bestimmten Plattform schalten?
Bedienen wir ausgediente Klischees, die keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft haben sollten?
Werten wir vielleicht sogar einzelne Gruppen von Menschen ab, wenn wir die Anzeige auf eine bestimmte Art und Weise gestalten?
Hier sind noch einmal die zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Manipulation

Themenwünsche?
Wenn dir ein wichtiges Thema im Blog fehlt, sag mir gerne Bescheid. Ich freue ich mich auf deine Nachricht.