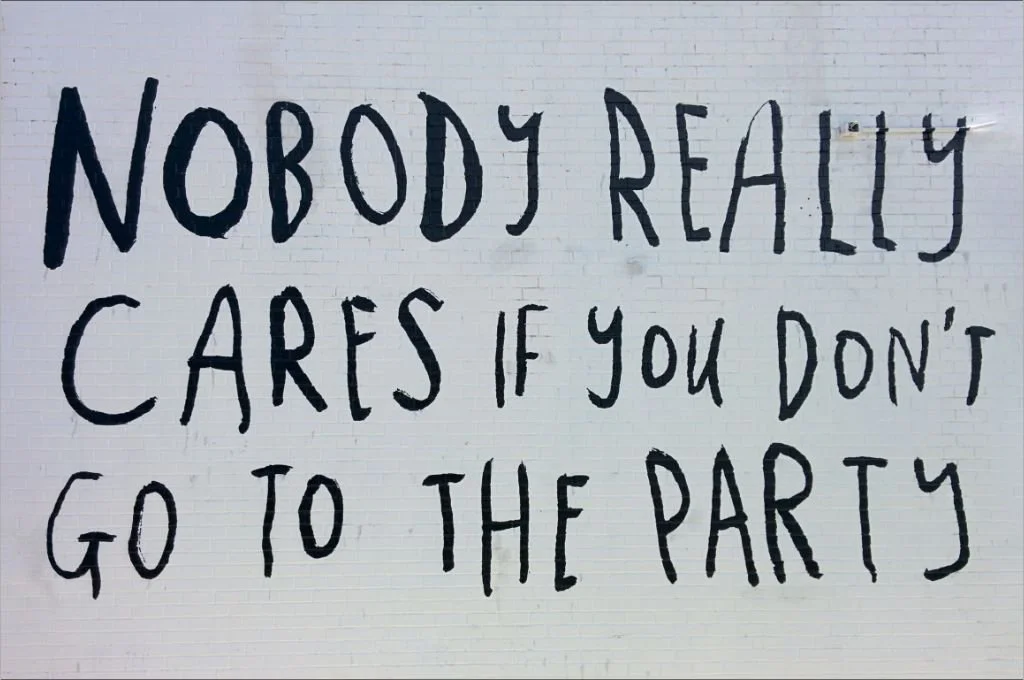Blog
Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.
Entscheidungsarchitektur im Marketing: Eine kurze Einführung für Selbstständige
Was ist Entscheidungsarchitektur und was hat das mit Marketing zu tun? In diesem Blogartikel finden Selbstständige Einblicke zur ethischen Gestaltung und Anordnung von Wörtern, Farben und Bildern im Marketing, um anderen Menschen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen zu ermöglichen.
Ich bin eine Entscheidungsarchitektin.
Ich ordne Wörter und Designelemente und baue sie zu einem Newsletter zusammen. Oder zu einer Seite auf meiner Website. Oder zu einem Blogartikel wie diesem hier.
Ich fördere damit immer auch ein bestimmtes Verhalten – ob bewusst oder unbewusst.
Wenn du Marketing machst, bist auch du eine Entscheidungsarchitektin oder ein Entscheidungsarchitekt. Auch wenn du dir deiner Rolle vielleicht noch gar nicht bewusst bist.
Mit jeder Webseite, jedem Newsletter, Bild, Video oder Blogartikel triffst du Entscheidungen über Wortwahl, Reihenfolge, Farben und Design.
Diese Elemente beeinflussen, wie deine Kund*innen wahrnehmen, denken und letztendlich handeln.
Übrigens: Der Begriff „Entscheidungsarchitekt“ wurde durch das Buch „Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ von Nobelpreisträger Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein geprägt.
Was bedeutet das für dein Marketing?
Die Entscheidungsarchitektur an sich ist nicht problematisch – schließlich müssen Wörter und Designelemente in irgendeiner Form angeordnet werden.
Es geht vielmehr darum, zu reflektieren, welches Verhalten wir mit unserer Entscheidungsarchitektur fördern möchten – und warum.
Entscheidungsarchitektur beim Verkaufen: Drei Beispiele
1. Entscheidungsarchitektur im Supermarkt
Die meisten Supermärkte fördern mit ihrer Entscheidungsarchitektur ungesundes Essverhalten, indem sie:
Süßigkeiten und Alkohol direkt im Wartebereich der Kassen platzieren
Impulskäufe durch strategische Produktplatzierung fördern
Kinderprodukte mit viel Zucker auf Augenhöhe der kleinen Konsument*innen platzieren
Statt überlegte, rationale Wahlmöglichkeiten zu unterstützen, fördert die Entscheidungsarchitektur der Supermärkte spontane, emotionsgesteuerte Kaufentscheidungen.
2. Entscheidungsarchitektur in Onlineshops
Viele Onlineshops nutzen künstliche Verknappung, um Dringlichkeit zu erzeugen:
„Nur noch 3 Stück verfügbar!“
Countdown-Timer für zeitlich begrenzte Angebote
„15 andere Personen schauen sich dieses Produkt gerade an“
Early-Bird-Rabatte und Flash Sales
Diese Techniken spielen mit der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), und drängen Menschen zu schnellen, oft unüberlegten Entscheidungen.
3. Entscheidungsarchitektur auf Websites
Die Entscheidungsarchitektur in Cookie-Leisten drängt mit bestimmten Designmustern, irreführender Sprache oder dem Verstecken datenschutzfreundlicher Optionen Menschen dazu, möglichst niedrige Datenschutzeinstellungen zu akzeptieren:
Der Akzeptieren-Button ist auffälliger gestaltet als der Ablehnen-Button
Der Ablehnen-Button fehlt komplett oder versteckt sich in Untermenüs
Komplizierte Einstellungen erschweren datenschutzbewusste Entscheidungen
Eine bessere Entscheidungsarchitektur für dein Marketing
Als wertegetriebene Selbstständige können wir uns darum bemühen, mit unserem Marketing gute Bedingungen für Entscheidungen zu schaffen.
Entscheidungen, die potenziellen Kund*innen wirklich gut tun, sind:
1. Informiert
Wenn wir alle relevanten Informationen transparent und verständlich zur Verfügung stellen, können Menschen Entscheidungen treffen, die wirklich zu ihnen passen.
2. Überlegt
Wenn wir Menschen Zeit und Raum für überlegte Entscheidungen geben, anstatt künstlichen Druck durch Verknappung oder Zeitlimits aufzubauen, können nachhaltige Beziehungen entstehen.
3. Selbstbestimmt
Die Autonomie anderer Menschen zu respektieren und auf manipulative Taktiken zu verzichten, schafft eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und Vertrauens.
Einladungen für positive Veränderungen in deinem Business
Die ersten Schritte in Richtung positive Entscheidungsarchitektur im Marketing können so aussehen:
✅ Faire Cookie-Einstellungen: Wie wäre es, wenn Akzeptieren- und Ablehnen-Button die gleiche Farbe hätten? So können Menschen bewusste Entscheidungen treffen, die zu ihnen passen.
✅ Einfache Abmeldeprozesse: Ein einfacher Abmeldeprozess vom Newsletter, der genauso unkompliziert ist wie das Anmelden, zeigt Wertschätzung.
✅ Transparente Preisgestaltung: Eine klare, offene Preisgestaltung ohne versteckte Kosten oder irreführende Rabattaktionen schafft eine Basis für langfristige Beziehungen.
✅ Bedürfnisse wertschätzen: Wäre es nicht schön, nur solche Käufe zu fördern, die für andere Menschen wirklich sinnvoll und bereichernd sind?
Fazit
Eine positive Entscheidungsarchitektur im Marketing bedeutet letztlich, das langfristige Vertrauen deiner Kund*innen über kurzfristigen Profit zu stellen.
Wenn andere Menschen spüren, dass du ihnen informierte, überlegte und selbstbestimmte Entscheidungen ermöglichst, werden sie dir langfristig vertrauen – und genau dieses Vertrauen ist die beste Grundlage für deine Selbstständigkeit.
Social Media Detox? Bringt nichts!
Wenn soziale Medien einen negativen Einfluss auf unsere (mentale) Gesundheit haben – uns überfordern, überreizen oder stressen –, suchen viele Menschen eine schnelle Lösung und legen einen Social Media Detox ein. In diesem Blogartikel möchte ich mich kritisch mit dem Thema „Social Media Detox“ auseinandersetzen und dir verraten, warum ich persönlich kein großer Fan dieser Methode bin.
Wenn soziale Medien einen negativen Einfluss auf unsere (mentale) Gesundheit haben – uns überfordern, überreizen oder stressen –, suchen viele Menschen eine schnelle Lösung und legen einen Social Media Detox ein.
Einerseits ist das verständlich. Oft ist der Leidensdruck so groß, dass man am liebsten vorgestern schon eine Lösung dafür hätte. Andererseits ist ein Detox meist nicht die Lösung für die Probleme, die Social Media mit sich bringen.
In diesem Blogartikel möchte ich mich kritisch mit dem Thema „Social Media Detox“ auseinandersetzen und dir verraten, warum ich persönlich kein großer Fan dieser Methode bin.
Aber jetzt noch mal Schritt für Schritt und der Reihe nach:
Was ist ein Social Media Detox überhaupt?
Während bei einem Digital Detox Menschen auf sämtliche digitalen Geräte und Anwendungen verzichten, geht es bei einem Social Media Detox darum, für einen bestimmten Zeitraum keine sozialen Medien mehr zu nutzen.
Facebook.
Instagram.
TikTok.
X (ehemals Twitter).
Pinterest.
LinkedIn.
All diese Plattformen (und noch viele mehr) können Gegenstand eines Social Media Detox werden.
Wie funktioniert ein Social Media Detox? Die Methoden
Manche sagen: „Ich nutze eine Woche lang keine sozialen Medien mehr.“ Andere nehmen sich vor, für einen Monat (oder noch länger) auf Social Media zu verzichten. Wiederum andere fokussieren sich auf eine einzige Social-Media-Plattform und legen beispielsweise „nur“ einen Instagram Detox ein.
In dieser Zeit sind die Menschen nicht auf Social Media aktiv: Sie posten nichts und konsumieren nichts. Sie loggen sich nicht mehr in ihre Accounts ein und streichen soziale Medien für diese Zeit völlig aus ihrem Leben.
Oft deinstallieren sie ihre Social-Media-Apps vom Smartphone, um nicht „in Versuchung“ zu kommen, doch noch mal nachzuschauen, was es Neues gibt.
Gerade wer soziale Medien beruflich nutzt, sagt vorab gerne seinen Follower*innen Bescheid, dass für einen bestimmten Zeitraum kein neuer Content kommt und man nicht auf Anfragen und Nachrichten reagieren wird. So kommt man nicht in die Situation, dass Menschen auf eine Antwort oder Reaktion unnötig warten und dann möglicherweise enttäuscht sind.
Inzwischen gibt es auch Social Media Detox Apps, die bei der Entgiftung helfen können, oder sogar kostenpflichtige Social Media Detox Retreats, bei denen man sich mit anderen Menschen zusammenschließt, um sich gemeinsam von sozialen Medien zu „entgiften“.
Welche Social-Media-Detox-Methode geeignet ist, darf jede*r für sich selbst entscheiden. Auch Fragen nach der „richtigen“ Dauer (7 Tage, 14 Tage, 30 Tage oder noch länger) oder dem „richtigen“ Zeitpunkt brauchen individuelle Antworten.
Welche Vorteile hat ein Social Media Detox?
Viele Menschen haben inzwischen einen Social Media Detox gemacht. Und wenn man die zahlreichen Erfahrungsberichte im Netz liest, scheint ein Social Media Detox – auf den ersten Blick – viele Vorteile zu haben:
Menschen berichten, dass der Drang, Instagram zu öffnen, nach ein paar Tagen nachlässt, und sie sich weniger fremdbestimmt fühlen.
Da man nun nicht mehr alle paar Minuten seine Likes und Kommentare checkt, wird die Aufmerksamkeit nicht mehr fragmentiert. Die Folge: Konzentration und Produktivität steigen.
Beziehungen verbessern sich, weil man nun weniger am Smartphone ist und mehr mit Menschen redet, die einem gegenüber sitzen.
Das Vergleichen mit Fremden im Internet wird reduziert. Wir fühlen uns (wieder) wohler mit uns und unserem Körper.
Wie sinnvoll ist ein Social Media Detox wirklich? (Meine Argumente dagegen)
Klingt toll, was gäbe es da an einem Social Media Detox überhaupt auszusetzen? Ich habe die fünf wichtigsten Argumente gegen einen Social Media Detox zusammengetragen:
#1 Das Gewohnheitsargument
Auch ich habe früher, als ich noch auf Social Media war, oft einen Social Media Detox gemacht. Oder sollte ich lieber sagen: Mich von Social Media Detox zu Social Media Detox gehangelt?
Denn genau das ist der erste Nachteil eines Social Media Detox: Der Effekt ist kurzfristig.
Das liegt daran, wie Gewohnheiten funktionieren. Sie haben einen Auslöser (zum Beispiel: Ich habe eine Aufgabe beendet.) und ein mit dem Auslöser verbundenes Verhalten (zum Beispiel: Ich öffne eine Social-Media-App.). Wenn wir das Verhalten an den Tag legen, wird unser Belohnungszentrum aktiviert und Dopamin ausgeschüttet. Wir fühlen uns gut (Ein Like!) und legen das Verhalten auch das nächste Mal an den Tag.
Bis sich Gewohnheiten ändern, kann es aber bis zu drei Monate dauern. Deshalb wird ein Social Media Detox von 7, 14 oder 30 Tagen meist nichts bringen. Unsere ungesunden Social-Media-Gewohnheiten sind immer noch in uns, wir haben sie nicht grundlegend verändert.
Und wenn wir dann nach 7, 14 oder 30 Tagen zu Social Media zurückgehen, sind die alten Gewohnheiten meist auch wieder da. Wir können uns vielleicht noch ein paar Tage disziplinieren, doch spätestens nach ein paar Wochen geht es uns wieder nicht gut und wir denken schon über den nächsten Social Media Detox nach.
Ein Teufelskreis. Und vor allem: Wie lange soll das so weitergehen?
#2 Das Giftargument
In diesem Zusammenhang stellt sich noch eine weitere Frage:
Wenn soziale Medien so schädlich sind, dass wir sie sogar als „Gift“ bezeichnen – schließlich heißt „Detox“ so viel wie „entgiften –, warum setzen wir uns dann die übrige Zeit überhaupt diesem Gift aus?
Das wäre so, als würden wir an 351 Tagen im Jahr jeden Tag 200g Zucker (oder 2 Flaschen Wein) zu uns nehmen und es aber okay finden, weil wir ja zweimal im Jahr für 7 Tage fasten.
Es stimmt zwar schon, dass die insgesamt 14 Tage Fastenzeit im Jahr dem Körper dann gut tun und positive Effekte haben. Doch relevanter ist, dass wir die meisten Tage im Jahr unseren Körper Giften aussetzen, die ihn schädigen. Da fällt die Fastenzeit dann kaum mehr ins Gewicht.
Auch finde ich es spannend, wie wir Social Media in Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen diskutieren:
Da ist uns allen klar, dass sie negative Auswirkungen auf die Gehirne junger Menschen haben können und wir junge Menschen vor dem oft schädlichen Einfluss sozialer Medien schützen wollen. So weit, so gut. Doch warum schützen wir unsere Kinder, aber uns nicht?
#3 Das Wissenschaftsargument
Und was sagt die Wissenschaft zum Thema „Entgiften“ bzw. Social Media Detox?
Der Begriff „Detox“ kommt ursprünglich aus der Ernährung und bezeichnet eine „Entgiftung“.
Die Annahme: Durch ungesunde Gewohnheiten sammeln sich in unserem Körper schädliche Stoffe (sogenannte „Schlacken“) an, von denen wir uns regelmäßig „reinigen“ müssen.
Tatsächlich ist eine positive Wirkung von Entgiftungskuren wissenschaftlich nicht nachzuweisen, sodass aktuell nicht unbedingt ein „Detox“ als vielmehr eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, viel Bewegung und Schlaf empfohlen wird.
So ist es mit einem „Social Media Detox“ auch: Klar können wir uns täglich in digitalen Räumen aufhalten, die uns nicht guttun, und uns, wenn es gar nicht mehr geht, „entgiften“. Doch wissenschaftlich belegen lässt sich die Wirksamkeit einer solchen Entgiftungskur nicht.
Eine systematische Evaluation von 21 Studien zu Digital Detox kam 2021 sogar zu dem Ergebnis, dass Digital Detox oft keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung von Symptomen bringt. Manche Studien kamen auch zu gemischten Ergebnissen. (Quelle)
Vor allem FOMO (Fear of Missing Out) ist eine häufige „Nebenwirkung“ eines Social Media Detox.
Und: Die Rückfallquote ist bei einem Digital Detox meist hoch. In der bitkom-Studie aus dem Jahr 2022 kam heraus, dass die Hälfte derjenigen, die einen Digital Detox einlegen, bereits nach wenigen Stunden wieder aufgaben. (Quelle)
Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie, sieht die Forschung zum Digital Detox insgesamt eher kritisch. Zum einen, weil die Definition oft unklar ist. („Was ist ein Digital Detox oder Social Media Detox überhaupt? Was beinhaltet er genau und was nicht?“) Und zum anderen, weil sich bei nicht selbst auferlegten Einschränkungen von vornherein ein negatives Gefühl einstellt und sich Studien somit nicht gut durchführen lassen. (Quelle)
#4 Das Verantwortungsargument
Und schließlich das Verantwortungsargument. Die Diskurse rund um einen Social Media Detox kreisen immer um das Individuum und die Frage, wie ein Individuum mit den Herausforderungen sozialer Medien umgehen kann.
Natürlich ist diese Frage nicht unwichtig, doch damit tritt eine viel wichtigere Frage in den Hintergrund, nämlich:
Wer ist überhaupt dafür verantwortlich, dass es Social-Media-Usern gut geht?
Wer über Social Media Detox schreibt oder Digital Detox Retreats anbietet, stellt stillschweigend voraus, dass das Individuum verantwortlich ist. Mit den richtigen Strategien, so die Annahme, können wir gesunde Gewohnheiten bei unserer Social-Media-Nutzung etablieren, zum Beispiel indem wir uns in Achtsamkeit üben oder uns von Zeit zu Zeit entgiften.
Ich teile diese Annahme nicht, denn ich denke, dass die Betreiber sozialer Medien dafür verantwortlich sind, sichere Räume für die Menschen zu schaffen, die ihre Social-Media-Plattform nutzen.
Oder anders gesagt:
👉 Warum dürfen Betreiber ihre Social-Media-Plattformen so gestalten, dass sie Menschen schaden? Und warum werden diese Menschen dann alleine gelassen und sind auf einmal selbst dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht? 👈
Für mich ist das nur schwer nachzuvollziehen.
#5 Das Anlagenargument
Das heißt aber auch: Wir können uns noch so viel um Achtsamkeit bemühen, wir können noch so viel atmen, meditieren oder uns „entgiften“: Der Fakt, dass soziale Medien in ihrer Anlage problematisch sind, bleibt:
Algorithmen spielen emotionalisierende Inhalte bevorzugt aus und werden uns somit immer (!) Inhalte zeigen, von denen sie „denken“, dass sie uns zu einer Reaktion bewegen können.
Durch Mikrotargeting werden wir Werbeanzeigen sehen, die perfekt auf uns zugeschnitten sind und uns somit immer zum unnötigen Konsumieren verleiten.
Soziale Medien setzen immer unbezahlte Arbeit von unserer Seite voraus: unbezahlte Contentarbeit, unbezahlte Emotionsarbeit, unbezahlte ästhetische Arbeit, unbezahlte Arbeit an sich selbst (Selbstoptimierung), unbezahlten Mental Load.
Soziale Medien werden von Attention Engineers so designt, damit sie möglichst viel Dopamin ausschütten und uns dazu verleiten, uns länger dort aufzuhalten, als uns lieb ist.
Wir können natürlich Tag für Tag gegen diese Mechanismen ankämpfen, aber es wird vermutlich nicht allen Menschen gleich gut gelingen. (Mir zum Beispiel ist es nicht gelungen.)
Und was ist eine Alternative zu einem Social Media Detox?
Ein Social Media Detox mag kurzfristig etwas Abhilfe schaffen, doch langfristig werden die Probleme mit Social Media ja nicht gelöst, die problematischen Strukturen bleiben.
Wer merkt, dass soziale Medien nicht gut tun und die Mechanismen (Algorithmen, Mikrotargeting, unbezahlte Arbeit, Dopamin) die mentale Gesundheit belasten, ist aus meiner Sicht besser damit beraten, das Thema gleich langfristig zu lösen. Wie? Das kann für jede*n etwas anderes sein.
Manche lagern ihr Social-Media-Marketing aus und können, wenn sie das Glück haben, eine passende virtuelle Assistenz zu finden, das Thema Social Media zu einem großen Teil aus ihrem Kopf bekommen.
Andere sehen keinen anderen Weg, als sich von Social Media vollständig zu verabschieden und andere Marketingwege zu gehen. Man muss ja auch nicht gleich alle Social-Media-Kanäle löschen, sondern kann vielleicht mit dem starten, der am meisten belastet.
Sich Onlineräume zu suchen, die einem prinzipiell gut tun (oder zumindest: nicht schlecht), ist langfristig die beste Option.
Dann braucht es auch keinen Social Media Detox mehr und man hat mehr Zeit und Energie für die schönen Dinge im Leben.
Vielleicht interessiert dich auch:
Hochpreis-Coachings im Female Empowerment: the bad and the ugly
Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen: Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? Meine Kritik an Hochpreis-Coachings
Heute ist Welfrauentag und deshalb können wir ja mal vorsichtig in die Runde fragen:
👉 Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass manche Business-Coaches sagen, dass sie mit ihrem Angebot Frauen empowern wollen, dann aber Onlineprogramme anbieten, die sich kaum eine Frau leisten kann? 👈
Ein paar Zahlen:
Das Durchschnittsbruttoeinkommen von Frauen in Deutschland liegt bei 3.699 Euro. (Quelle)
Bundesweit haben nur 10% aller Frauen zwischen 30 und 50 Jahren ein Nettoeinkommen von mehr als 2.000 Euro. (Quelle)
19% der Frauen haben kein eigenes Einkommen und 63% unter 1000 Euro.(Quelle)
Die Durchschnittsrente für Frauen liegt aktuell bei unter 900 Euro im Monat. (Quelle)
Das Armutsrisiko für Frauen liegt aktuell bei 16%. (Quelle)
Bekommt eine Frau ein Kind, verdient sie bis zu ihrem 45. Geburtstag bis zu 251.000 Euro weniger als eine Frau ohne Kinder. (Quelle, S. 112)
Wie kommt man angesichts dieser Zahlen eigentlich auf die Idee, dass Frauen irgendwo einen höheren vier-, fünf- oder sechsstelligen Betrag rumliegen hätten, der nur darauf wartet, in ein „empowerndes“ Coaching „investiert“ zu werden?
Nun soll dieser Text weder ein Plädoyer gegen hochpreisige* Coachings werden noch gegen Female Empowerment als vielmehr eine Erinnerung:
Wer hochpreisige* Onlineprogramme verkauft, macht Produkte nicht für „Frauen“, sondern für einen kleinen Teil wohlhabender Frauen. Das kann man natürlich gerne tun, nur dann hat es eben wenig mit „Female Empowerment“ zu tun.
Wer ausschließlich hochpreisige* Produkte anbietet, kann das Wort „Female Empowerment“ oder „Feminismus“ nicht in den Mund nehmen, ohne „Femwashing“ zu betreiben (= das Pflegen eines feministischen Images bei Handlungen, die diesem Image widersprechen).
Wie hochpreisige Produkte gerechtfertigt werden
Wer selbst mal ein Business-Coaching macht, erfährt früher oder später am eigenen Leib:
Es ist in den letzten Jahren geradezu verpönt geworden, bezahlbare** Kurse und Programme anzubieten. Business-Coaches haben eine Menge Argumente parat, warum wir als Selbstständige und Onlineunternehmer*innen unbedingt hochpreisige Produkte anbieten sollten.
Hier die drei beliebtesten:
#1 „Wenn deine Angebote nicht hochpreisig sind, zeugt das vom ,falschen’ Money Mindset.“
Die Vorstellung, dass wir unser „richtiges“ Money Mindset unter Beweis stellen, wenn unsere Produkte hochpreisig sind, hält sich hartnäckig. Doch: WTF?!
Zunächst: Wer soll überhaupt entscheiden, was ein „richtiges“ und was ein „falsches“ Money-Mindset ist? Der Business-Coach? Und wenn ja – wie kommt er oder sie zu diesem Recht?
Unser Job als Selbstständige und Online-Unternehmer*innen ist es, Preise realistisch zu kalkulieren. So, dass unsere Ausgaben gedeckt sind und wir Gewinn machen können, den wir in Rücklagen, Vorsorge und Co. stecken können.
Preise zu würfeln oder beliebige Zahlen aneinanderzureihen, nur damit der Preis ein bestimmtes Money Mindset an den Tag legt, „schön“ aussieht oder besonders „energetisch“ wirkt („7777 Euro“), ist nicht sehr verantwortungsbewusst gegenüber Menschen, die sich unter Umständen jeden Cent absparen, um sich ein hochpreisiges Produkt zu kaufen. Oder gar anfangen, sich zu verschulden, Kredite aufzunehmen oder Flaschen zu sammeln. (Ja, alles schon gehört.)
#2 „Verlange die Preise, die du wert bist.“
Die Verknüpfung von Geld und Wert ist ein besonders mächtiges Argument. Denn natürlich wollen wir alle wertvoll sein – und dass andere Menschen unseren Wert auf den ersten Blick anhand des Preises unserer Produkte sehen.
Doch die Verknüpfung von Geld und Selbstwert ist problematisch.
Unser Wert als Mensch sollte überhaupt nichts mit Geld zu tun haben und unsere Finanzen sollten für unseren Selbstwert idealerweise überhaupt keine Rolle spielen. (Auch wenn das in der Praxis natürlich leichter gesagt als umgesetzt ist.)
Denn wenn Geld wirklich Ausdruck unseres Selbstwertes wäre, hieße das, dass …
… sich mein Wert als Mensch nach – je nach finanzieller Lage – ändert. Zum Beispiel, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit weniger wertvoll war als jetzt.
… der reichste Mann Deutschlands (Dieter Schwarz) 44,7 Milliarden Mal wertvoller ist als jemand, der überhaupt kein Vermögen hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss.
… und so weiter
Ist es nicht so viel sinnvoller anzunehmen, dass unser Wert rein gar nichts mit Geld zu tun hat und dass wir, egal, ob unser Produkt 5, 50, 500, 5.000 oder 50.000 Euro kostet, einen unveränderlichen Wert als Mensch haben?
Ich würde noch weitergehen und behaupten:
Ein Selbstwert, der von äußeren Faktoren wie Geld (wie dem Preis unserer Produkte) abhängig ist, ist ein Selbstwert, der einstürzt, sobald sich äußere Bedingungen ändern. Seinen Selbstwert an Geld zu koppeln, führt deshalb zu einem kontingenten Selbstwert – keinem echten.
Stattdessen sollten wir unseren Selbstwert von äußeren Faktoren entkoppeln:
vom Umsatz
von der Anzahl der Kundinnen oder Followern
von Produktivität und von den abgehackten Punkten auf der To-do-Liste
und vielem anderen mehr, das die Hustle Culture uns erfolgreich eingeredet hat.
All diese Dinge sollten idealerweise überhaupt keine Rolle für unseren Selbstwert spielen.
#3 „Ob sich Menschen deine Programme leisten können, ist nicht deine Verantwortung.“
Ich finde: Auch als Selbstständige tragen wir gesellschaftliche Verantwortung. Das gilt umso mehr, wenn wir Reichweite haben und mit unseren Ansichten viele Menschen erreichen.
Wir können – angesichts der vielen individuellen finanziellen Situationen, in denen Frauen sich befinden – vielleicht nicht die individuellen Situationen an sich lösen, ja.
Doch wir tragen mit unseren unternehmerischen Entscheidungen dazu bei, dass sich bestimmte Strukturen und Systeme verfestigen – oder eben nicht.
Wenn wir zum Beispiel in unserem Marketing Frauen als defizitäres Wesen inszenieren und ihnen vermitteln, dass sie nicht gut genug sind, ihnen danach ein passendes hochpreisiges Coaching andrehen, das ihr vermeintliches Problem löst, und sie zusätzlich noch in einen Kredit treiben, weil wir Druck beim Verkaufsgespräch ausüben und keine Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, können wir nicht einfach sagen: „Ist nicht mein Problem, wenn du dir das nicht leisten kannst.“
Dann sind wir das Problem.
Wie das Marketing für hochpreisige Produkte oft aussieht (und was es mit Female Empowerment zu tun hat)
Apropos Marketing: Gerade im Hochpreis-Coaching-Bereich werden eine Menge Marketingtaktiken, -tricks und -strategien an den Tag gelegt, die problematisch sind. Schauen wir sie uns im Einzelnen an.
Eigenen Lifestyle zur Schau stellen
Wenn jede*r plötzlich eine Personal Brand ist, heißt das auch, dass die Grenzen zwischen „privat“ und „beruflich“ verschwimmen. Für viele Coaches bedeutet das, Menschen auf Social Media hinter die Kulissen ihres Alltags mitzunehmen und ihnen die Errungenschaften ihres Erfolgs nach dem Motto „Mein Haus, mein Auto, mein Team“ zu präsentieren.
Wir sehen, wie sie vor ihrem Sportauto posen sich fotografieren lassen.
Oder mit ihrer Mastermind-Gruppe Privatjet fliegen. (Und es abfeiern.)
Oder in Luxushotels einchecken, die sich die meisten ihrer Follower niemals leisten können werden.
Oder ganz nach Dubai ziehen, weil sie dort kaum Steuern zahlen müssen dort jeden Tag die Sonne scheint.
Das soll in erster Linie zeigen: „Schau her, wie weit ich es gebracht hab! Schau her, wie erfolgreich ich bin! Schau her, was ich mir leisten kann!“
Doch es ist noch mehr:
Mythos Meritokratie
Diese Zurschaustellung des fancy Lifestyles wird in zweiter Linie genutzt, um in rosa-pastelligen Posts oder extrem „männlichen“ Inspirationszitaten, auf den Löwen abgebildet sind, mantraartig die immergleiche Botschaft zu teilen:
„Wenn ich das geschafft hab, schaffst du es auch!“
„Wenn Kundin X die Erfolge erzielt hat, kannst auch du erfolgreich werden!“
Das ist das typische neoliberale Narrativ, das Grundversprechen des Kapitalismus, der klassische American Dream:
„Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du dich dafür anstrengst.“
Doch die Meritokratie ist – das gilt 2024 mehr denn je – ein Mythos. Es mag sein, dass ein gewisses Maß an Leistung sich positiv auf unser Leben auswirkt und dass wir sogar erfolgreich werden in dem, was wir tun. Doch entscheidender für die meisten Menschen ist laut Statistik immer noch, in welche Familie sie hineingeboren wurden.
So wird Vermögen meist über Generationen vererbt – nicht verdient.
Und auch soziale Mobilität kommt in der Praxis viel seltener vor, als wir es uns wünschen würden. (Die Aufwärtsmobilität lag für Frauen in Deutschland 2021 bei 34% im Westen bzw. 33% im Osten.)
Auch wenn Ausnahmen sicherlich die Regel bestätigen: Am wahrscheinlichsten ist das Szenario, dass nicht die „richtige“ Business- oder Marketingstrategie, das „richtige“ Mindset und erst recht nicht das „richtige“ Onlineprogramm Einfluss darauf hat, ob wir erfolgreich werden oder nicht, sondern unsere Herkunft.
Das ist traurig und ein Skandal, keine Frage. Doch es ist ein Fakt, den wir, wenn wir Marketing machen, auf jeden Fall kennen und beachten sollten und vor allem: nicht einfach das Gegenteil behaupten, weil es gerade so schön ins Marketing passt.
Wenig Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen
Mit dem Meritokratie-Mythos ist oft auch ein mangelndes Verständnis für die Lebensrealitäten anderer Menschen verbunden. Denn auch wenn Business-Coach Tobi, 23, es vielleicht nicht glauben mag, aber:
Für die meisten Menschen dieser Erde gibt es aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, körperlichen Verfassung, ihrem Aussehen oder sozioökonomischem Hintergrund gewisse Grenzen, Herausforderungen, Diskriminierungen oder Behinderungen. Da können sie noch so viel „wollen“ und „Affirmationen aufsagen“ und „an ihrem Mindset arbeiten“.
Ich erspare mir an dieser Stelle eine ausufernde Liste, doch nur so viel: Phrasen wie
„Ausrede“
„Falsches Mindset“
„Es ist leicht, das zu tun.“
sind nichts weiter als ein Zeichen der Privilegien derjenigen, die sie unreflektiert äußern, und sollten im Marketing 2024 nun wirklich nicht mehr verwendet werden. Erst recht nicht, um hochpreisige Coachings an die Frau zu bringen.
Druck und Psychospielchen
Du siehst vielleicht: Mit „Female Empowerment“ hat diese Art von Marketing nur wenig zu tun, denn es geht hier ja nicht darum, alle (oder möglichst viele) Frauen erfolgreich zu machen, sondern nur diejenigen, die bereit sind, diese hohen Preise zu zahlen.
Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt: Wie bringen diese Business-Coaches Frauen eigentlich dazu, ihre Preise zu zahlen?
Zunächst einmal, indem sie Menschen in einen ausgeklügelten Sales Funnel packen, aus dem es dank künstlicher Verknappung, Druck und FOMO kaum einen Weg mehr nach draußen gibt.
Nicht selten werden zunächst neue Probleme, neue Bedarfe kreiert, die vorher so noch nicht da waren.
Wir alle kennen diese Werbungen:
„Du wolltest schon immer schneller die Schuhe binden als deine Nachbarin? Mit MEINER METHODE kannst du sie in nur sieben Wochen um drei Sekunden übertrumpfen! Ich stehe jeden Morgen auf und bin überglücklich, weil ich weiß, wie ich mir mit der richtigen Methode die Schuhe binde – ich bin endlich ganz, geheilt, erleuchtet – und mit meinem nagelneuen Onlineprogramm ‚Erfolgreich Schuhebinden in 7 Wochen‘ kannst du es für nur 7777,- Euro nun auch! Aber weil ich WIRKLICH will, dass sich was bei dir ändert, habe ich dir meine wichtigsten Tipps in eine Masterclass gepackt, für die du dich JETZT kostenlos anmelden kannst. Aber SCHNELL, es melden sich so viele Menschen an, dass ich die Türen für mein automatisiertes Webinar BALD SCHLIESSEN muss! Also melde dich am besten jetzt sofort an, um ja NICHTS ZU VERPASSEN, und VERÄNDERE DEIN LEBEN für immer!“
Und wenn Menschen dann anbeißen – denn wer will nicht ganz, geheilt, erleuchtet sein? – und sich für die Masterclass anmelden, kommen sie in einen aggressiven Strudel aus Retargeting-Ads und Verkaufsmails. Und wenn sie dann einem 1:1-Verkaufsgespräch zustimmen, bekommen sie meist folgende Botschaften zu hören:
„Du musst Vertrauen haben!“
In den Coach. In die Methode. Ins Universum. Wenn du den Preis für das Coaching anzweifelst, hast du kein Vertrauen, und wie willst du mit dieser Einstellung überhaupt erfolgreich werden?
„Du musst in dich investieren!“
Wenn du zehntausend Euro für mein Coaching ausgibst in dich investierst, mit dem Wissen dann aber hunderttausend Euro verdienst, hast du das Geld schneller wieder drin, als du „Manipulation“ sagen kannst. Was, du brauchst eine Garantie? Guck doch mich und meinen Lifestyle an, Baby! Ich bin der beste Beweis dafür, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur willst. Und überhaupt: Hast du denn überhaupt kein Vertrauen ins Universum?!
„Es geht nur mit meinem Programm!“
Du willst ohne mein Programm ein Business aufbauen / Marketing machen / erfolgreich werden / ein Trauma heilen? LOL. Viel Glück! Weißt du denn nicht, dass ICH bereits dort bin, wo du gerne sein möchtest? Dass ICH bereits alle Schritte gegangen bin, die noch vor dir liegen? Wenn du jetzt Geld für andere Kurse, Methoden oder Mentor*innen ausgeben würdest, wärst du schön blöd!
„Kein Geld ist eine Ausrede!“
Was, du hast kein Geld? Weißt du: Es ist nicht wirklich Geld, es ist nur das, was wir darüber denken. Für mich ist Geld einfach nur Energie. Energie fließt zu mir und wieder von mir weg. Ein natürlicher Lauf der Dinge. Jeder hat Energie – auch du!
Wenn du es wirklich wollen würdest, wenn du es wirklich ernst meinen würdest, dann würdest du deine Energie in mein Programm stecken. Ich habe Kunden, die nehmen sogar einen Kredit auf, weil sie ALL IN gehen.
„Der Preis steigt!“
Entscheide dich schnell, denn der Preis steigt – täglich! Heute kostet das Schuhebinden-Coaching 7777,- Euro, morgen 8888,- Euro, übermorgen 9999,- Euro und in drei Tagen 123.456,- Euro. Warum? Weil ich es kann!
Neben diesen Psychospielchen zeichnet sich das Marketing der Hochpreis-Branche oft durch mangelnde Transparenz aus.
Was nun genau im Coaching enthalten ist, welche Inhalte vermittelt werden oder wie eine Zusammenarbeit genau aussieht, wird oft unter Verschluss gehalten, denn: Du musst Vertrauen haben! Nachfragen oder gar Kritik äußern? Nicht erwünscht.
Früher, als ich noch auf Social Media und insbesondere in Facebook-Gruppen unterwegs war, war ich oft live dabei, als kritische Kommentare gelöscht („Das hier soll ein positiver Ort sein!!!“) und Menschen, die nachfragten, zum Schweigen gebracht wurden.
Nicht selten entwickelte sich in diesen Gruppen eine merkwürdige Dynamik: Die Coachin, die für ihre Coachings einen sechsstelligen Betrag verlangte, als Marketing lediglich Fotos von sich im teuren Porsche postete und sonst nur wenig über die Inhalte des Coachings preisgab, wurde von den Facebook-Gruppen-Mitgliedern leidenschaftlich in Schutz genommen. Die Menschen hingegen, die nachfragten oder Kritik äußerten, wurden bloßgestellt („Das sagt ja viel über dein eigenes Mindset aus!!!“), beleidigt und – man könnte vielleicht sagen – letzten Endes rausgemobbt.
Merke: In der Coaching-Bubble dürfen Frauen anscheinend alles (Porsche fahren, sich teure Villen mieten, Privatjet fliegen, sechsstellige Preise für ihre Coachings verlangen) – außer kritisch nachzufragen.
Das ist nicht Female Empowerment. Das sind sektenartige Strukturen inkl. Brainwashing.
Der Elefant im Raum: Wie können wir mit unseren Angeboten nun Frauen stärken?
Und doch gibt es einen Elefanten im Raum (er heißt Hugo), über den ich ebenfalls sprechen möchte.
Denn natürlich ist es absolut fein,
als Selbstständige oder Onlineunternehmer*in Geld für Beratung, Produkte, Coachings etc. zu bekommen (schließlich können wir alle nicht von Luft und Liebe leben)
ggf. auch viel Geld für Beratung, Coachings etc zu bekommen, weil viel von unserer Zeit, unserem Wissen, Können etc. in den Produkten steckt
und dabei gleichzeitig Frauen stärken zu wollen (schließlich ist das ein notwendiges Anliegen – wenn wir in dem Tempo so weitermachen, sind wir erst in 131 Jahren gleichberechtigt)
Die Frage ist: Wie können wir das tun, ohne dass es zu einem Widerspruch („Femwashing“) kommt?
Vielleicht so:
Wertschätzendes Marketing
Wir könnten damit starten, Frauen in unserem Marketing wertschätzend zu behandeln, indem wir folgende Dinge – für mich inzwischen absolute Red Flags – vermeiden:
Mangelnde Informationen über Ablauf, Inhalte und Preis des Coachings
Unhaltbare und pauschale Versprechen („Nach meinem Coaching hast du sechsstellige Launches“)
Heilversprechen, die laut HWG verboten sind
Schwammige Versprechen wie „Transformation“
eine „Geheimstrategie“, die angeblich für alle funktioniert, unabhängig von ihrer individuellen Situation
Hohe Preise, die – selbst bei jahrelanger Erfahrung – jeglicher wirtschaftlicher Grundlage entbehren
Angel Numbers wie 7777,- Euro
Aggressives Marketing mit ausgeklügelten Funnels und Verkaufsmails
Schwammige Begriffe wie „Energie“ (im esoterischen Sinn, nicht im Sinne von „Kraft“), „Universum“ etc.
Gezieltes Auslösen von FOMO
Aggressiven Einsatz von Testimonials
keine Zeit, um eine Nacht drüber zu schlafen
Obsession mit Zahlen („Sechsstelliger Launch“, „Siebenstelliges Business“, „Zehntausend Follower“)
Lovebombing und keine Wahrung von Grenzen („Hallo du Liebe“, „Hallo mein Herz“)
In Strukturen denken, nicht in individueller Selbstverwirklichung
Auch wenn es schön ist, dass es einzelne Frauen „schaffen“ und erfolgreich werden mit dem, was sie tun, geht es im Feminismus darum, dass es alle (oder zumindest möglichst viele) Menschen „schaffen“. Unabhängig von ihrem Geschlecht, sexueller Identität, Herkunft, Behinderung etc.
Nur wenn es für alle Menschen die gleichen Chancen gibt, haben wir es „geschafft“ – nicht wenn einzelne Frauen wie Sheryl Sandberg oder Angela Merkel mal für wenige Jahre an der Spitze eins Unternehmens oder Staates stehen, wir mal für ein paar Jahr einen Schwarzen Präsidenten im mächtigsten Land der Welt haben oder wenn hundert Onlineunternehmerinnen siebenstellig im Jahr verdienen.
Denn auch der Trickle-down-Effekt, die Hoffnung, dass sich Geld, Macht oder was auch immer von „oben“ nach „unten“ verteilt, ist ein Mythos.
Deshalb muss die Frage nicht lauten: „Wie kann ich mit dem, was ich tue, einzelne (weiße, wohlhabende, hetero) Frauen dabei unterstützen, erfolgreich zu werden?“
Sondern: „Was kann ich für möglichst viele Frauen tun?“
Wie das aussehen mag, mag von Coach zu Coachin und Angebot zu Produkt variieren. Deshalb müssen wir anfangen, mehr darüber nachzudenken und zu reden und Dinge auszuprobieren.
(Und wie ich es persönlich handhabe, werde ich in einem separaten Blogartikel nächste Woche erzählen.)
Walk the walk
Es geht nicht darum, theoretisch für Female Empowerment zu sein, sondern das Gesagte auch in der Praxis umzusetzen, zum Beispiel indem wir
die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, angemessen und pünktlich bezahlen und wertschätzen
für Diversität sorgen, sollten wir ein Team haben
in unserem Marketing Frauen nicht als defizitäres Wesen inszenieren
etc.
Nur wenn das, was wir nach außen kommunizieren, zu dem passt, was wir in unserem Unternehmen leben, können wir guten Gewissens behaupten:
Mir ist die Stärkung von Frauen ein Herzensanliegen.
Anmerkungen
*Mir ist natürlich bewusst, dass „hochpreisig“ ein höchst subjektiver Begriff ist, der für jede*n etwas anderes bedeutet. Ich verstehe in diesem Text unter „hochpreisig“ einen Preis, den sich eine Frau mit einem Durchschnittsgehalt in Deutschland statistisch nur schwer leisten könnte.
**Dasselbe gilt für „bezahlbar“.
Drei Jahre kein Instagram 🎂
Kein Instagram seit drei Jahren als Selbstständige: Das habe ich über Inspiration, Produktivität, Beziehungen und mentale Gesundheit gelernt.
Am 27. August 2020 – also vor genau drei Jahren – habe ich das letzte Mal etwas auf Instagram gepostet.
Wenn mir heute andere Selbstständige erzählen, dass sie überlegen, „was sie auf Insta posten sollen“ oder „wie ihre Ads besser laufen“, fällt es mir wieder ein. „Stimmt“, denke ich mir dann, „diese Themen haben dich früher auch immer die ganze Zeit beschäftigt.“
Es kommt mir wie eine Ewigkeit, ja, wie ein anderes Leben vor, als ich noch auf Social Media war und mir über Reels, Werbeanzeigen oder Karussellposts Gedanken gemacht habe. Und inzwischen hat sich so viel in meinen Ansichten über das Selbstständigsein geändert, dass ich unbedingt davon erzählen will.
Drei Jahre kein Instagram – das habe ich gelernt
… über Inspiration
Wir denken, dass wir so viel verpassen, wenn wir nicht auf Social Media sind. Dabei brauchen wir so viel weniger Inspiration, als wir glauben.
Ein guter Gedanke, eine gute Idee oder ein gutes Konzept reicht völlig, um uns ins Tun zu bringen.
Wir brauchen nicht die Flut an Tipps, Tricks, Hacks und Zitaten, die wir auf Instagram bekommen. Diese Flut inspiriert uns nicht, sie lähmt uns. Sie sorgt eher dafür, dass wir abstumpfen und zu einem Zombie mutieren, der einfach nur von Post zu Post scrollt, ohne sich ernsthaft auf einen Gedanken einzulassen.
Auch ohne Instagram gibt es genug Quellen für Inspiration: Bücher, Blogartikel, Gespräche, Empfehlungen, Museen, Ausstellungen, Podcasts, Reisen, Musik und … uns selbst.
… über Produktivität
Die Produktivität, die auf Social Media zelebriert wird, ist die toxische Hustle Culture.
Schaut her, wie ich um 5 Uhr morgens aufstehe. Schaut her, wie ich meine Morgenroutine pflege. Schaut her, wie ich an meinem neuen Produkt arbeite. Schaut her, wie entspannt ich meine Mittagspause gestalte. Schaut her … Schaut her … Schaut her …
Dabei gibt es ein großes Missverständnis:
Produktives Arbeiten braucht nicht die Abwesenheit von Pausen. Produktives Arbeiten braucht die Abwesenheit von Störungen.
Wir können nur dann produktiv sein, wenn wir über einen längere Zeit ungestört arbeiten können:
ohne Pushbenachrichtigungen
ohne das ständige Checken, was es Neues auf Social Media gibt
ohne Posten darüber, wie wir gerade arbeiten
Produktivität findet nur selten öffentlich auf Social Media statt, sondern meist hinter verschlossenen Türen. Sobald ich über meine Arbeit auf Social Media erzähle, unterbreche ich meine Arbeit und bin vermutlich nicht mehr produktiv.
… über Beziehungen
Es ist nicht normal, jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun zu haben, wie es auf Social Media möglich ist. Unser Hirn ist nicht dafür gemacht, so viele Kontakte zu haben. Wir stoßen an eine kognitive Grenze.
Wenn wir Einblick in das Leben von hunderten oder gar tausenden von Menschen bekommen, ist das oft nicht bereichernd, sondern belastend.
Die Menschen, die wir persönlich – ob offline oder online – kennen, sind genug.
Wir brauchen nicht hunderte oder tausende Accounts, denen wir folgen. Und erst recht brauchen wir nicht zehn- oder hunderttausend Follower zu unserem Lebensglück.
… über mentale Gesundheit
Algorithmen sind nicht empathisch und soziale Medien sind nicht so konstruiert, dass sie unser Wohlbefinden steigern, sondern den Profit der Plattformbetreiber.
Wir können es mit Achtsamkeit versuchen oder mit Digital Detox, aber die Wahrheit ist: Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es eine separate Berufsgruppe (die sogenannten Attention Engineers), deren alleinige Aufgabe es ist, Erkenntnisse der Psychologie zu nutzen, um Social-Media-Plattformen so zu gestalten, dass sie maximal süchtig machen.
Wie sollte ein Individuum jemals dagegen ankommen? Es liegt nicht an uns, wenn es uns nicht gelingt, gesund zu bleiben, während wir Social Media nutzen.
… über Authentizität
Wie authentisch können wir im Marketing sein, wenn wir das machen, was alle anderen auch tun? Wie können wir „wir selbst“ sein, wenn wir uns zu bestimmten Plattformen zwingen?
Wenn wir Social Media nicht mögen, können wir dennoch posten, Reels drehen und livegehen, doch wie können wir die richtigen Menschen damit anziehen, wenn wir selbst nur eine Rolle spielen?
… über Prioritäten
Wir können Social Media vom Ende aus betrachten und uns fragen:
Wie würde ich am Ende meines Lebens über die sozialen Medien denken?
Würde ich es bereuen, dass ich zu wenige Likes oder Follower hatte? Würde ich denken „Hätte ich doch mehr Selfies gepostet!“ oder „Hätte ich doch öfter Beiträge von Fremden im Internet kommentiert!“ oder „Wäre meine Interaktionsrate auf Insta bloß höher gewesen!“?
Oder würde ich es bereuen, zu wenig Zeit mit dem verbracht zu haben, was mir wirklich wichtig ist? Würde ich es bereuen, dass ich mich über Jahre zu etwas gezwungen habe, was ich gar nicht wollte?
… über Leichtigkeit
Leben und Arbeiten ohne Social Media heißt nicht unbedingt, dass alles „leicht“ ist. Arbeiten ohne Social Media ist immer noch Arbeit. Manchmal sogar sehr viel Arbeit. Und manche Tage fühlen sich auch ohne Social Media schwer und anstrengend an.
Doch das ist nicht weiter tragisch, denn entscheidend ist eine Balance. Eine Balance aus Anspannung und Entspannung, aus Herausforderung und Komfortzone, aus außen und innen, aus mit anderen und für sich.
Nicht Leichtigkeit, sondern diese Balance sorgt dafür, dass wir auch langfristig gesund bleiben und zufrieden in unserer Selbstständigkeit sind. Sich ständig außerhalb der Komfortzone aufzuhalten, ist das Anstrengende – nicht wenn es hin und wieder anstrengende Tage gibt.
… übers Genug-Sein
Über diese Fragen lohnt es sich nachzudenken:
Wann habe ich genug gearbeitet?
Wann habe ich genug Marketing gemacht?
Warum bin ich genug?
Soziale Medien lassen uns glauben, dass das, was wir tun, nie genug ist, dass wir nie genug sind. Doch das stimmt nicht. Wir können unser persönliches „Genug“ definieren. Wir können unser Gefühl fürs Genug-Sein zurückerobern, indem wir Social Media verlassen und vielleicht sogar unsere Social-Media-Kanäle löschen.
Vielleicht interessiert dich auch:
Website-Texte ohne toxisches Marketing – Gastartikel von Allegra Bob
Dies ist ein Gastartikel von Allegra Bob. Allegra ist Texterin für menschliches Marketing. In ihrem Artikel zeigt sie, wie du Websitetexte schreiben kannst, mit denen du auch ohne toxisches Marketing neue Kund*innen anziehst.
Das ist ein Gastartikel von Allegra Bob. Allegra ist Texterin für menschliches Marketing. Als solche unterstützt sie andere Selbständige dabei, auf ihre Art sichtbar zu werden und ihre Traumkundschaft zu begeistern: mit ihren Werten, ihrer Persönlichkeit und Expertise. Mit Inhalten, die inspirieren. Mit Empathie statt Manipulation. In ihrem Newsletter „Writing Rebels“ teilt sie auch regelmäßig Text-Tipps und Impulse für neue Töne im Marketing. Mehr über Allegra und darüber, wie du mit ihr zusammenarbeiten kannst, erfährst du auf ihrer Website.
Eine Website, die dir regelmäßig wertschätzende Kundschaft beschert. Die 24/7 für dich arbeitet – ohne dass du ständig vor der Kamera rumtanzen musst. Die dir gehört und nicht von den Launen eines Algorithmus oder eines Mark Zuckerberg abhängt. Das klingt wohl für viele Selbstständige verheißungsvoll.
Sehr viel weniger verheißungsvoll klingt dagegen: Website-Texte schreiben, die verkaufen. Denn darum geht’s ja letztendlich, oder? Ums Verkaufen.
Oh je. Beim Thema Verkaufen drehen die negativen Assoziationen gerne direkt frei:
„Ich muss anderen was andrehen.“
„Ich muss mich selbst gut verkaufen.“
„Ich muss dafür sämtliche Copywriting-Tipps umsetzen, die ich im Internet finden kann.“
Ich möchte dich beruhigen und dir erst mal sagen: Du musst gar nichts.
Und: Es geht auch anders.
Zum Beispiel so, dass du und dein Publikum euch gleichermaßen wohlfühlen.
Dafür schreibe ich heute diesen Artikel: Damit du Website-Texte schreiben kannst, mit denen du auch ohne toxisches Marketing neue Kund*innen anziehst und sie auch wirklich und ehrlich begeisterst.
Hier kommen ein paar Impulse für solche Texte.
Es muss nicht weh tun
„Aua.“ Das denke ich ab und zu, wenn ich Verkaufstexte lese.
Und das scheint auch das Ziel zu sein: ordentlich auf den sogenannten „Pain Points“ rumreiten – und anschließend die erleuchtende Lösung präsentieren.
Ich will das nicht verurteilen. Ich denke, viele haben es einfach genauso gelernt. Sie haben gelernt, dass das so funktioniert. Und das tut es ja offenbar. Wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass das so geht.
Ich habe nur irgendwann angefangen, da mal drüber nachzudenken, und kam zu dem Schluss: Ich finde das ganz schön problematisch.
Ich will niemandem sagen: „Du kannst einfach nicht schreiben. Du sitzt schon wieder vor dem weißen Blatt, das dich unbarmherzig anstarrt. Du fühlst dich wie in der Deutscharbeit in der 9. Klasse und weißt jetzt schon: Das wird wieder eine 5. Doch das muss nicht sein! Mit einer Texterin …“ Und so weiter.
Fühlt sich dadurch irgendwer motiviert, inspiriert, empowered? Wohl eher nicht. Ich finde es allerdings wichtig, dass (meine) Texte motivieren, inspirieren, empowern.
Ich will niemandem weh tun, indem ich noch Salz in die Wunde streue. Ich würde auch mit niemandem so reden. Also warum sollte ich es schreiben?
Klar: Wenn du ansprichst, wo bei deiner Zielgruppe der Schuh drückt, zeigst du ihr: Du verstehst sie. Du weißt, wo sie stehen – und kannst sie dort abholen.
Du musst das ja auch nicht völlig ignorieren. Ich möchte dich nur anregen, dich bewusst zu fragen: Willst du das ansprechen – und wenn ja, wie?
Wenn du es sensibler tun willst, habe ich hier drei Anregungen, wie das gehen kann:
#1 Fragen stellen statt Annahmen formulieren
Statt Unbekannten zu erklären:
„Du hast folgendes Problem …“
„Du fragst dich oft …“
„Du weißt einfach nicht …“
Lieber Fragen stellen:
„Geht’s dir auch manchmal so (wie mir)? …“
„Hast du auch (keine) Lust auf …?“
„Kommt dir das bekannt vor? …“
#2 Die „Pain Points“ als häufiges, aber nicht allgemeingültiges Phänomen darstellen
„Vielen meiner Kund*innen geht es so: …“
„Vielleicht kennst du das: …“
#3 Nicht mit den „Pain Points“ starten, sondern direkt mit dem Wunschzustand – sozusagen den „Gain Points“
„Wie wäre es, wenn …?“
„Stell dir vor …“
Womöglich hilft es uns auch, den Begriff „Pain Points“ selbst kritischer zu sehen – oder ihn gleich ganz zu ersetzen. (Du siehst anhand der Gänsefüßchen schon, dass ich ihn nicht einfach so nutzen kann und will.) Warum muss es schon wieder so ein Anglizismus sein? Damit wir Marketing-Leute schlau klingen?
Warum sprechen wir nicht einfach von Herausforderungen? Anliegen? Beweggründen? Antrieb? Motivation? Anreizen? Impulsen?
Ich muss doch nicht immer Schmerzen haben, um etwas kaufen zu wollen.
Und ich bin sicher: Du findest noch viele schönere Alternativen. Im Internet gibt es reichlich Synonyme für jedes Wort.
Positive Gefühle erzeugen statt FOMO
Freude.
Überraschung.
Angst.
Wut.
Ekel.
Trauer.
Verachtung.
Das sind die sieben Basis-Emotionen nach dem US-amerikanischen Anthropologen und Psychologen Paul Ekman.
Welche davon willst du mit deinem Marketing hervorrufen?
Ich habe den Eindruck, viele entscheiden sich für die Angst. Oder sie entscheiden sich gar nicht – sondern machen es einfach, weil „man“ es halt so macht. (Hinter diesem „man“ kann man sich leicht verstecken. Niemand weiß so genau, wer und wo es ist.)
„Man“ arbeitet jedenfalls gerne mal mit FOMO. Also „Fear of missing out“.
Mach den Leuten Angst, dass sie was verpassen, wenn sie dein Angebot nicht kaufen. Erkläre ihnen, dass das super dumm von ihnen wäre. Dass sie sich dann mega schlecht fühlen würden. Das ist leicht und effektiv. Es funktioniert.
Leider.
Und wieder denke ich: Ich will das aber nicht.
Ich will nicht, dass eine Person auf meine Frage, was sie zu mir führt, antwortet: „Angst.“ Ich will positive Gefühle und Zustände erzeugen. Wie Freude. Leichtigkeit. Sicherheit. Dieses Szenario entwerfe ich zum Beispiel auf meiner Website:
Du brauchst keine wildfremden Leute mehr anzuschreiben oder auf TikTok zu tanzen – du erhältst automatisch regelmäßig Anfragen über deine Website.
Diese Anfragen kommen von Menschen, die dich als Expertin sehen und schon wissen, dass sie dein Angebot wollen.
Diese Menschen zahlen gerne deine Preise und fragen dich nicht, ob das nicht etwas günstiger und schneller geht.
Falls doch jemand so etwas tut, schickst du ihn freundlich lächelnd woanders hin – denn du kannst deinen Kalender mit den Projekten füllen, die dir Spaß machen.
Du freust dich über die vielen Besucher*innen, denen du deine Website mit Stolz präsentieren kannst.
Ich denke, damit mache ich ein positives Angebot – das du auch ablehnen kannst, ohne dich schlecht zu fühlen.
Und ja – auch das funktioniert. Und erzeugt auch Freude bei mir selbst. Probier es ruhig mal aus.
Es gibt nicht den einen Weg, der alle zum Erfolg führt
Eine Taktik, die für mich mit FOMO zusammenhängt: so tun, als wäre Angebot A die einzige Lösung. Der einzige Weg, mit dem du wieder glücklich wirst.
Heißt umgekehrt: Wenn du es nicht buchst, gibt es für dich keine solche Möglichkeit mehr. Das erzeugt dann wahrscheinlich bei vielen FOMO.
Ich würde gerne mal eine Umfrage unter Selbständigen starten: „Glaubst du, dein Angebot oder deine Methode ist das/die einzig wahre? Und wer das nicht genauso macht, kommt nicht ans Ziel?“
Ich hoffe, das würden alle als rhetorische Frage erkennen. Denn natürlich führen viele Wege nach Rom. Natürlich kannst du auch ohne mich gelungene Website-Texte schreiben.
Jetzt kommt aber noch ein Aber: Ich glaube nicht, dass jeder alles schaffen kann.
Ich habe einfach genug von Aussagen wie: „Mit meinem Money-Mindset-Coaching erreichst du sechsstellige Monatsumsätze!“
Ach ja? Auch wenn ich chronisch krank bin? Oder alleinerziehend?
Gibst du mir darauf eine Garantie – und wenn es nicht klappt, den sechsstelligen Umsatz? Wahrscheinlich nicht.
Ich finde es unethisch, solche Versprechen zu machen – aus zwei Gründen:
1. Du kannst es nicht seriös garantieren.
2. Du hast keine Ahnung von der Lebenswirklichkeit der Person, die das liest. Deshalb sage ich: Ich würd’s lassen. Aber ich will das nicht verallgemeinern.
Aussagen differenzieren – durch Modalverben
Okay, und wie kannst du solchen Verallgemeinerungen und Versprechen sprachlich etwas entgegensetzen?
Dafür gebe ich dir einen Tipp, mit dem DIE Copywriting-Gurus mich wahrscheinlich mit ihren Standardwerken erschlagen würden:
Streue Modalverben ein.
Ja, hat sie grade wirklich gesagt. Als Texterin.
Lass es mich erklären: Grundsätzlich stehe ich auch für klare Ansagen. Für „Ich texte deine Website“ statt „Ich kann deine Website texten“ (wenn ich es wollte).
Aber ich sage niemandem: „Ich schreibe für dich Blogartikel, die bei Google auf Platz 1 ranken.“ Das kann ich nämlich nicht versprechen.
Genauso will ich eben vermitteln, dass mein Angebot nicht die einzige Lösung ist – zum Beispiel so: „Eine Texterin kann dir helfen, die richtigen Worte für dein Angebot zu finden.“
Auf diese Weise tust du auch eins:
Deinem Publikum das letzte Wort überlassen
Die Kaufentscheidung liegt bei der Person, die kauft.
Mich irritieren daher Sätze wie „Hier bist du genau richtig!“ Das weiß ich als Leserin doch besser, ob ich mich hier genau richtig fühle.
Wie kannst du also deinen Website-Besucher*innen das letzte Wort überlassen?
Eine Möglichkeit, die ich mag: mit dem Call-To-Action. Denn der ist gewissermaßen oft das letzte Wort.
Auf meiner Seite steht daher nicht auf jedem Button: „Buche hier dein kostenloses Erstgespräch!“ Sondern: „Erzähl mir mehr!“, „Ja, ich will!“, „Ich möchte mehr erfahren!“ und Ähnliches.
Wichtig: Ich verkaufe nichts auf meiner Seite. Diese Buttons leiten zu Unterseiten (wenn jemand mehr über mich oder meine Leistungen erfahren will) und insbesondere meiner Kontaktseite weiter (um ein Kennenlernen zu vereinbaren).
Bei einem Kauf-Button gilt: Er muss „unmissverständlich beschriftet sein und eindeutig erkennen lassen, dass durch Betätigung ein rechtsgültiger Kaufvertrag geschlossen wird, der mit einer Zahlungsforderung verbunden ist.“ (Sagt Digistore.)
Hier wird es also schnell unethisch, wenn eine Person unwissentlich einen Kaufvertrag schließt, weil sie „Ja, ich will!“ so schön findet.
Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt:
Transparenz und dadurch Vertrauen schaffen
Warum ich Transparenz so wichtig finde?
Weil du den Menschen auf deiner Seite damit die nötige Sicherheit gibst. Ein gutes Gefühl.
Transparenz schafft Vertrauen, dass sie bei dir wirklich richtig sind (und du das nicht nur schreibst). Dass du hältst, was du versprichst. Dass du kurz gesagt ein anständiger Mensch bist.
Wie kannst du Transparenz herstellen?
Ich finde: Das ist für jede der klassischen Unterseiten wichtig.
Auf deiner Über-Seite kannst du zum Beispiel:
Zeigen, wer du bist – mit vollem Namen und Bild. (Klingt banal, aber vergessen manche gerne.)
Deine Mission teilen: Warum tust du, was du tust? Hast du eine Geschichte zu erzählen, mit der andere sich identifizieren können?
Deinen Werdegang und deine Erfahrungen beschreiben: Warum kannst du das tun? Und: Hast du Beweise dafür (Auszeichnungen, Testimonials)? Denn wenn neben dir auch andere wohlwollend über dich sprechen, schafft das gleich mehr Vertrauen.
Auf deiner Angebots- oder Verkaufsseite kannst du dein Angebot detailliert beschreiben:
Wie läuft die Zusammenarbeit mit dir ab?
Welche Leistungen sind enthalten?
Was kostet das?
Welche häufigen Fragen und Einwände kannst du direkt klären? (FAQ)
So wissen die Leute genau, was sie bei dir wirklich bekommen. Natürlich kannst du auch hier noch mal eine Kundenstimme einbauen.
Und sogar auf deiner Kontaktseite finde ich Transparenz wichtig:
Wo sitzt dein Unternehmen?
Wann und wie bist du erreichbar?
Wie lange dauert es etwa, bis du auf Anfragen reagierst?
Mit Humor eine menschliche Verbindung herstellen
Es gibt ein weiteres, oft unterschätztes Mittel, um Vertrauen und Sympathie aufzubauen: Humor.
Nein, Humor auf Websites ist nicht unseriös. Manche bierernsten, hochtrabenden Formulierungen dagegen oft unfreiwillig komisch.
Ich meine: Lieber gewollt als ungewollt.
Du kennst ja schließlich auch sicher den alten Marketingsatz: „Menschen kaufen von Menschen.“ (Ka-Tching, 1 € fürs Phrasenschwein.) Und mit Humor zeigst du dich als menschliches Wesen – und ziehst andere auf menschliche Weise an.
Texte so schreiben, dass sie alle ansprechen
Ich kenne es von vielen anderen Selbständigen – und mir selbst: den Wunsch, mit dem eigenen Angebot möglichst viele/alle anzusprechen.
Was deine Positionierung und Zielgruppe betrifft, ist das sicher kein guter Rat. Aber: Ich finde schon, du kannst deine Texte so schreiben, dass sich alle angesprochen fühlen. Genauer gesagt: nicht nur Männer.
Für mich ist das ein ganz wichtiger Grund fürs Gendern: Ich möchte, dass sich zumindest hinsichtlich ihrer geschlechtlichen Identität alle in meinen Texten wiederfinden.
Und die Möglichkeiten dafür sind so bunt wie unsere Gesellschaft selbst:
Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich
adjektivische Umschreibungen („der ärztliche Rat lautet …“)
neutrale Formulierungen („Ansprechperson“)
direkte Ansprache („Du bekommst bei mir …“ statt „Meine Kunden bekommen bei mir …“) – das hilft auch dabei, Nähe aufzubauen
passive Formen (lieber sparsam!)
…
Was ich beim Gendern wichtig finde:
1. Dass du dir die Zeit nimmst, deinen Umgang damit bewusst zu entwickeln.
2. Dass du entspannt und flexibel rangehst. (Wie ans Marketing allgemein.)
Ich bin sicher, du findest deinen Weg, deine Wunschkundschaft menschlich anzusprechen – so, dass sie sich genauso gut damit fühlt wie du.
Texte fertig?
Du hast deine Website-Texte geschrieben – und weißt nicht so recht, ob das so gut ist? Dann kann ich dir zwei Dinge empfehlen:
1. Frage andere: „Wie wirkt der Text auf dich?“
2. Frage dich: „Würde ich so auch mit jemandem reden?“ Wie fühlt sich das an? Ich denke, du kannst bei ganz vielem auf deinen Bauch hören. Mehr als auf Marketing-Gurus.
Ich hoffe trotzdem, dass du zusätzlich zu deinem Bauchgefühl auch von meinen Tipps etwas mitnehmen kannst und sie dir das (Website-)Texten erleichtern.
Denk immer dran: Du machst dein Marketing nicht auf eine bestimmte Art, weil die nun mal funktioniert. Sondern weil DU das so möchtest.
Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks – ein Leitfaden
Marketing ohne Manipulation – wie geht das genau? Darauf möchte ich in diesem Blogartikel eingehen und zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Druck und Psychotricks mit dir teilen.
Hier sind zwölf Grundsätze für ein wertschätzendes Marketing ohne Manipulation, Druck und Psychotricks:
#1 Wir lassen Menschen die Wahl
Downloads an Newsletter koppeln
Webinare an Newsletter koppeln
Wartelisten an Newsletter koppeln
Käufe an Newsletter koppeln
Es ist inzwischen völlig normal geworden, dass wir – egal, wofür wir uns anmelden – automatisch einen Newsletter bekommen, sodass wir gar nicht mehr in Frage stellen, ob das überhaupt okay ist oder ob das nicht auch anders ginge.
Ich bin dafür, nicht mehr einfach so anzunehmen, dass jemand unseren Newsletter bekommen will, nur weil er oder sie sich mal zu einem unserer Webinare angemeldet hat.
Lassen wir Menschen doch stattdessen die Wahl: Sie können ein Webinar von uns besuchen und sich dabei für unseren Newsletter anmelden – müssen es aber nicht.
Aus meiner Sicht ist nämlich nicht das Koppeln an sich problematisch, sondern weil es zum einen ungefragt passiert und zum anderen keine andere Handlungsoption zur Verfügung steht.
Es spricht aus meiner Sicht nämlich überhaupt nichts dagegen …
beim Bestellformular auf Digistore oder Elopage eine Checkbox zu aktivieren und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich beim Kauf gleichzeitig auch zum Newsletter anzumelden
Menschen, die sich für ein Webinar oder ein anderes Online-Event angemeldet haben, nach dem Event eine Mail zu schicken und sie zu fragen, ob sie in Zukunft auch den Newsletter bekommen wollen
Das ist kein Zwang, sondern ein Angebot, das angenommen werden kann oder auch nicht.
Natürlich bedeutet das für uns Unternehmer*innen einen Mehraufwand. Und natürlich geht Listenwachstum so langsamer als mit ungefragtem Koppeln.
Doch es ist so: Wenn wir unsere E-Mail-Liste füllen, indem wir Menschen keine Wahl lassen und sie ungefragt hinzufügen, haben wir eine Menge Leute drin, die gar nicht explizit „Ja“ zu unserem Newsletter gesagt haben und sich vermutlich sowieso bald wieder abmelden werden. Und wem ist damit geholfen?
#2 Wir lassen Zeit für bewusste Kaufentscheidungen
Natürlich können wir als Unternehmer*innen nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern müssen Geld verdienen und unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen.
Doch das sollte kein Freifahrtschein sein, Menschen als Objekte zu behandeln und sie in unsere Programme „hineinzufunneln“.
Wenn wir ein Webinar halten, am Ende unser Onlineprogramm pitchen und Menschen genau drei Tage Zeit lassen, sich für oder gegen ein hochpreisiges Coaching zu entscheiden, ist das eine Menge Druck.
Und es wird nicht leichter, wenn wir dabei einen Bonus versprechen, der genau 24 Stunden gültig ist. Oder an einem Tag drölfzig E-Mails mit der immer gleichen Botschaft schicken: Die „Türen“ schließen gleich! Meld dich jetzt an! Sonst verpasst du was!
Lasst uns stattdessen Türen öffnen und unsere Pitches als Angebote verstehen.
Lasst uns Webinare oder andere Online-Events nach dem Motto „Hier ist das, was ich weiß. Und hier ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten.“ gestalten.
Ohne Zeitdruck. Ohne Psychospielchen. Und ohne repetitive Mails.
Werden sich dadurch weniger Menschen für unsere Onlineprogramme anmelden? Vermutlich.
Aber es werden Menschen sein, die sich aus freien Stücken für uns entschieden haben und perfekt zu uns und unseren Werten passen.
Und ist das nicht eine großartige Vorstellung und die beste Basis für eine gelungene Zusammenarbeit?
#3 Wir machen Preise ohne Gedöns
Hören wir doch endlich auf, bei unseren Preisen zu tricksen.
Hören wir doch endlich damit, „charmante“ Preise zu verwenden, die völlig willkürlich auf „9“ oder „7“ enden, um das Produkt günstiger erscheinen zu lassen.
Hören wird doch endlich auf damit, Menschen mit Rabatten in unsere Programme zu locken.
Arbeiten die meisten Onlineunternehmer*innen mit solchen Preistricks? Oh ja.
Doch das sollte uns nicht davon abhalten, einen anderen Weg einzuschlagen und den „richtigen“ Preis zu kommunizieren – egal, wie früh, spät, schnell oder langsam sich Menschen für einen Kauf entscheiden.
Außerdem ist es auch für mich als Onlineunternehmerin herrlich entspannend, meine Preise ohne Gedöns zu gestalten und mir keinen Kopf mehr über spezielle „Frühbucherpreise“, „Webinarpreise“, „Early-Bird-Preise“ oder „Black-Friday-Aktionen“ mehr machen zu müssen.
#4 Wir ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe
Apropos Preise: Selbst wenn unser Produkt nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurde und jeden einzelnen Cent wert ist, können sich nicht immer alle Menschen unsere Angebote leisten.
Und das hat auch nicht zwingend etwas mit einem „falschen Mindset“ oder „zu wenig Commitment“ zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass unterschiedliche Menschen über unterschiedliche Privilegien und damit finanzielle Ressourcen verfügen. (Und mit Fakten wie Inflation und sinkender Kaufkraft.)
Die Gründe sind vielfältig – und natürlich sind wir für die Finanzen unserer Kund*innen nicht verantwortlich.
Aber es heißt nicht, dass wir diese Situation noch mehr ausnutzen und mit Aufpreisen bei Ratenzahlungen arbeiten sollten.
Sehen wir den buchhalterischen Mehraufwand und das Risiko eines Zahlungsausfalls doch als das, was es ist: Ein Beitrag, dass sich auch Unternehmer*innen mit weniger finanziellen Mitteln ihre beruflichen Ziele erreichen.
#5 Wir triggern keine Ängste
Jede Kaufentscheidung ist ein emotionaler Vorgang, heißt es. Deshalb sollten wir im Marketing auch Emotionen wecken.
Ob alleine das schon problematisch ist, würde an dieser Stelle vermutlich zu weit führen. Mit Sicherheit problematisch ist es, wenn Marketing dazu genutzt wird, Urängste der Menschen zu triggern.
Die Angst, nicht dazuzugehören, zum Beispiel.
Oder die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.
So ist FOMO im Marketing nicht etwa eine super-duper „Strategie, die die Verkäufe ankurbelt“, sondern eine Strategie, die eine zutiefst menschliche Veranlagung für Profit ausnutzt.
Manchmal ist es hilfreich, sich zu fragen, wie man das, was man da gerade schreibt, selbst auffassen würde:
Würde das einen selbst stressen und unter Druck setzen? Würde es einen unruhig werden lassen?
Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es anderen Menschen ähnlich gehen könnte.
Hören wir doch auf, mit den Ängsten der Menschen zu spielen, als wären sie Pingpongbälle, die wir beliebig durch die Gegend werfen könnten.
#6 Wir säen Samen und legen Spuren
Erzeugt das Wort Reichweite bei dir genau so viel Druck wie bei mir?
Ich habe für mich festgestellt, dass mich alleine schon der Gedanke, meine „Reichweite vergrößern“ zu müssen, stresst und dass es mich mehr mit Zahlen und Funnels beschäftigen lässt als mit Menschen, Werten und Themen.
Inzwischen habe ich den Begriff der Reichweite ersetzt durch Samen säen.
Wenn ich in einem Podcast interviewt werde, habe ich einen Samen gesät. Ich weiß nicht, wie lange der Samen brauchen wird, damit eine Pflanze daraus wächst – einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr – aber ich weiß, dass die Zeit für mich arbeitet.
Möglicherweise wird sich schon heute jemand die Podcastfolge anhören und neugierig auf meiner Website landen. Möglicherweise wird sich aber auch erst nächste Woche jemand einen meiner Onlinekurse holen und mir daraufhin eine E-Mail schreiben. Oder vielleicht wird sich auch erst in einem Monat oder in einem Jahr jemand melden und sagen:
„Eine Freundin hat die Podcastfolge mit dir gehört und mich dir empfohlen – und hier bin ich nun.“
Wir können die Ergebnisse unserer Bemühungen, „Reichweite“ zu erzeugen, nie mit Gewissheit vorhersagen. Und meinem Verständnis nach müssen wir es auch nicht.
Es reicht, wenn wir uns auf unsere Themen besinnen und Samen säen – dann kommen die Früchte mit der Zeit von alleine.
#7 Wir arbeiten ohne versteckte Kosten
Was ich völlig unproblematisch finde und auch selbst mache, ist die glasklare Kommunikation eines Angebots nach einer Zusammenarbeit:
„Hey, dir hat das Programm gefallen und du möchtest ein zweites Mal dabei sein? Hier kannst du deinen Platz buchen.“
Völlig anders sieht es allerdings für mich aus, wenn während eines Onlineprogramms plötzlich klar wird, dass die Teilnehmer*innen für alles, womit für das Programm geworben wurde, zusätzlich zahlen müssen. Das ist nicht in Ordnung.
Denn nicht selten befinden sich die Teilnehmer*innen sogar in einer vulnerablen Lage. Sie haben sich „nackig“ gemacht und nun sagt die Coachin: „Ja, schlimmes Problem. Um das zu lösen, solltest du am besten eine zusätzliche Einzelsitzung bei mir buchen.“ Und schwupps, ist die Coachin wieder um mehrere tausend Euro reicher.
Lasst uns also Onlineprogramme erstellen, die für sich stehen und Menschen bereits wertvolle Lösungen bieten. Und wer weiß? Vielleicht arbeiten die Teilnehmer*innen ja sogar gerne ein zweites Mal mit uns zusammen – freiwillig.
#8 Wir sind ehrlich und transparent
Neulich hat mir jemand erzählt, dass sie in den ersten Wochen nach dem Kauf eines Onlineprogramms feststellen musste, dass die gemeinsamen Calls gar nicht von der Onlineunternehmerin, bei der sie gekauft hat, betreut wurden, sondern von einer Mitarbeiterin.
Nun spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, ein Team zu haben und Mitarbeiter*innen in die Betreuung der Teilnehmer*innen einzubinden. Allerdings ist es eine fragwürdige Strategie, das nicht vor dem Kauf so zu kommunizieren.
Wenn eine virtuelle Assistenz nicht bloß ergänzend in der FB-Gruppe nach dem Rechten sieht, sondern ausschließlich, will ich das vor dem Kauf wissen.
Wenn Menschen dir zwar Geld für dein Onlineprogramm zahlen, dich aber in den gemeinsamen Calls nur in der ersten Woche zu Gesicht kriegen, auch.
Und wer das nicht macht, wer seine Onlineprogramme auf Kosten von Ehrlichkeit und Transparenz skaliert, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er die potentiellen Käufer*innen nicht bewusst damit täuscht.
Lasst uns Menschen stattdessen Wertschätzung entgegenbringen und transparent sein, wie viel oder wenig sie von uns in unseren Programmen sehen werden, sodass sie selbst entscheiden können, ob ihnen das Programm den Preis wert ist.
Was sich übrigens hervorragend mit Transparenz kombinieren lässt, ist das Prinzip von Working out loud, sprich: Wir arbeiten nicht für uns in unserem stillen Kämmerlein, sondern lassen unsere Community an Gedanken, Prozessen und Hintergründen teilhaben.
Indem wir beispielsweise mal in einem Blogartikel erzählen, warum jetzt Mitarbeiterin X die Kursteilnehmer*innen betreut oder Mitarbeiterin Y jetzt die Calls zu Thema Z durchführt (möglicherweise ist sie in einem bestimmten Thema nämlich viel tiefer drin als du).
#9 Wir verzichten auf künstliche Verknappung
Marketing ohne Manipulation und künstliche Verknappungen sind keine gute Kombination.
Wenn ich also schon im Juli weiß, dass ich ab September ein bestimmtes Onlineprogramm anbieten will, aber erst kurz vorher mit einem Knall die Türen öffne – ist das eine Form der Verknappung, die streng genommen nicht nötig wäre und die natürlich viel eher dazu führt, dass ich in dieser kurzen Zeit mit Druck und Psychotricks arbeite, um das Programm zu füllen.
Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns willkürlich Boni überlegen, die es für eine willkürliche Anzahl an Stunden kostenlos dazugibt. Oder Rabatte, die nur gültig sind, solange das Webinar noch läuft.
Künstliche Verknappung erzeugt (unnötigerweise) Druck und führt nicht selten dazu, dass auch wir Onlineunternehmer*innen Launches als unglaublich anstrengend empfinden und gleich nach dem Launch schon urlaubsreif sind.
Wenn ich in meinem Programm allerdings nur 12 Plätze anbiete, weil ich weiß, dass das die Grenze ist, bei der ich individuelle Unterstützung garantieren kann, ist es keine künstliche Verknappung, sondern Verknappung mit einem guten, nachvollziehbaren Grund.
Ebenso wenig finde ich es problematisch, einen einheitlichen Starttermin zu haben und zu kommunizieren, dass man Anmeldungen nur bis zu diesem Datum annimmt, um eben gemeinsam als Gruppe starten zu können.
Natürlich brauche ich für solche natürlichen Verknappungen Klarheit darüber, wo meine persönlichen Grenzen sind.
Wie viele Stunden kann ich am Tag arbeiten, ohne auszubrennen?
Wie viele Menschen kann ich realistischerweise gleichzeitig unterstützen?
Wie viele Plätze kann dieses Programm haben, sodass eine gute Betreuung gewährleistet ist?
Und wenn ich das weiß, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es auch offen so – „working out loud“-mäßig – zu kommunizieren. So wie Hotels unaufgeregt kommunizieren, wie viel freie Betten sie haben.
#10 Wir stehen für Werte ein
Die meisten Selbstständigen wollen wachsen und es spricht ja zunächst einmal auch gar nichts dagegen:
Mehr Menschen auf der Website und auf der E-Mail-Liste bedeuten in vielen Fällen auch mehr zahlende Kund*innen und damit mehr Geld – für ein höheres Gehalt, für größere Rücklagen, für mehr Investitionen oder einfach nur für ein schöneres Leben.
Es spricht überhaupt nichts dagegen, mehr zu wollen. – Doch welche Werte haben wir neben Wachstum noch?
Wenn wir wachsen und skalieren, ohne No-Gos für uns zu definieren, überschreiten wir nicht selten auch ethisch-moralische Grenzen.
Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei massiv der Umwelt schaden?
Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir dabei andere Menschen belügen oder die Fakten zumindest so drehen, dass sie noch besser zu unserer Message passen?
Wollen wir wachsen und in Kauf nehmen, dass wir die Not der Menschen ausnutzen? Oder sie dazu ermuntern, Kredite aufzunehmen, um sich unsere Programme leisten zu können? Oder gar künstlich einen Bedarf kreieren, den es so gar nicht gibt?
Lasst uns also eine Grenze fürs Wachstum definieren – und auch entsprechend so handeln. Hier findest du eine Liste von Werten, an denen du dich in deinem Marketing orientieren kannst.
#11 Wir prüfen unsere Definition von Erfolg
Ich höre jetzt quasi schon die Stimmen, die da zweifelnd flüstern. „Hmmmm, und mit diesem Marketing kann man Erfolg haben?“
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es deshalb nicht, weil ich nicht weiß, was „Erfolg“ für dich bedeutet.
Verstehst du „Erfolg“ auf einer rein finanziellen Ebene, werden dir mit einem Marketing ohne Druck sicherlich einige Käufer*innen „durch die Lappen gehen“. Diejenigen nämlich, die gelockt und überredet werden wollen. Und die nur dann kaufen, weil sie FOMO bekommen, wenn sie nur daran denken, dass „die Türen“ bereits in drei Tagen wieder schließen.
Ist „Erfolg“ für dich mehr als nur Umsatz und ist es für dich nicht nur wichtig, Menschen zu erreichen, sondern die richtigen, sieht es schon wieder anders aus. Denn ein Leben, in dem deine Kund*innen nett, motiviert und wertschätzend sind und sich zu 100% aus freien Stücken für dich entschieden haben, hört sich für mich nach einem verdammt guten an.
#12 Wir denken langfristig
Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt: der Langfristigkeit.
Die Sache ist nämlich die: Manipulation funktioniert – aber nur kurzfristig.
Vielleicht gelingt es uns, unsere Umsatz- und Marketingziele zu erreichen und abends eine Flasche Champagner zu köpfen.
Doch was ist, wenn …
sich die Menschen, die bei uns gekauft haben, in Wahrheit zu der Entscheidung gedrängt gefühlt haben?
die Menschen in unseren Programmen gar nicht wirklich motiviert sind und deshalb keine guten Ergebnisse vorweisen?
wir den Druck, den wir auf andere Menschen ausgeübt haben, selbst in unserem Körper spüren, speichern und so immer mehr erschöpfen?
Was bedeuten diese manipulativen Taktiken für uns, unser Unternehmen und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf lange Sicht? Diese Frage darf jede*r für sich beantworten.
Hast du noch weitere Fragen zum Thema Marketing ohne Manipulation? Vielleicht wirst du hier fündig
Ist Marketing nicht „von Natur aus“ Manipulation?
Natürlich könnte man sagen: Kommunikation (und damit Marketing) ist immer ein Stück weit „manipulierend“. Und ja: Wenn ich mit anderen Menschen rede oder einen Text schreibe, mit dem ich etwas bewirken will, nehme ich bewusst oder unbewusst immer auch Einfluss auf die Gedanken, Gefühle und damit Entscheidungen der Menschen. Wir könnten „Manipulation“ so verstehen. Doch das wäre aus meiner Sicht ein sehr weiter Manipulationsbegriff.
Manipulatives Marketing meint für mich mehr. Es beinhaltet nicht nur Kommunikation und Selbstausdruck, sondern auch das Ausnutzen der menschlichen Psyche im Namen des Wachstums. Es beinhaltet nicht nur das Über-ein-Angebot-Sprechen, sondern ein Verkaufen um jeden Preis ohne Rückkopplung an Werte.
Bemühe ich mich, Menschen bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen, indem ich in meinem Marketing zum Beispiel deutlich mache, wofür ich stehe und welche Werte ich vertrete, für wen das Produkt richtig ist (und für wen nicht) oder welche Ergebnisse ich erwarten kann (und welche nicht), ist das aus meiner Sicht Transparenz – und keine Manipulation.
Ist ein Sales Funnel immer manipulierend?
Aus meiner Sicht ist es völlig unproblematisch, sich die Customer Journey zu durchdenken und sich zu fragen: Welche Stationen nehmen Menschen, bevor sie schließlich bei mir kaufen?
Wie will ich gefunden werden? (zum Beispiel durch meinen Blog)
Wie will ich mit ihnen in Kontakt kommen? (zum Beispiel in meinem Newsletter)
Wie will ich über meine Angebote sprechen? (zum Beispiel in Blog und Newsletter)
Die Antworten auf diese Fragen helfen mir dabei, Klarheit in meinem Marketing zu bekommen und zu entscheiden, wo ich meine Zeit, Energie und mein Geld investieren möchte.
Im Grunde kann ein „Sales Funnel“ durchaus etwas Ähnliches meinen, doch für mich ist das Menschenbild hinter dem Begriff ein anderes:
Da ist der Verkaufsprozess nicht etwa eine Reise und die anderen Menschen die Akteure, die selbstbestimmt und in ihrem Tempo den Weg zu mir finden dürfen. Bei einem Sales Funnel werden andere Menschen dem Begriff nach in einen Trichter gesteckt, sie fallen quasi durch, sind mehr passive Objekte als selbstbestimmte Akteure. Und am Ende des Trichters müssen sie durch die enge Öffnung gequetscht werden.
Das ist für mich nicht unbedingt eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen. Deshalb nutze ich den Begriff „Sales Funnel“ nicht mehr und spreche lieber von „Customer Journey“.
Ist Werbung immer Manipulation?
Auch hier kommt es aus meiner Sicht darauf an, wie eng oder weit wir den Begriff der Manipulation fassen.
Natürlich geben wir durch unsere Ads etwas Bestimmtem – einem Blogartikel, einem Webinar, einem Produkt – mehr Aufmerksamkeit, als es ohne die Ad bekommen würde. Ist diese Sichtbarkeit alleine schon Manipulation? Aus meiner Sicht nicht unbedingt.
Die Onlineunternehmerin, die ihr E-Book bewirbt, manipuliert meinem Verständnis nach also nicht zwingend, nur weil sie auf Instagram eine Ad schaltet.
Entscheidender sind für mich folgende Fragen:
Was bewerben wir? Bedienen wir mit unserem Angebot Wünsche von Menschen oder kreieren wir Sehnsüchte, die ursprünglich gar nicht da waren?
Wie bewerben wir es? Machen wir in unserer Ad „nur“ ein Angebot oder nutzen wir in unseren Werbebotschaften FOMO, um Angst vorm Verpassen zu erzeugen?
Was passiert nach der Ad? Können die Menschen einfach nur die beworbene Handlung ausführen oder kommen sie in ein ausgeklügeltes System von Tripwires, Upsells, Downsells und aggressiven E-Mail-Marketing, aus dem es kaum ein Entkommen mehr gibt?
Darüber hinaus sind mit Werbung natürlich auch viele ethische Fragen verbunden:
Welches System unterstützen wir, wenn wir eine Ad auf einer bestimmten Plattform schalten?
Bedienen wir ausgediente Klischees, die keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft haben sollten?
Werten wir vielleicht sogar einzelne Gruppen von Menschen ab, wenn wir die Anzeige auf eine bestimmte Art und Weise gestalten?
Hier sind noch einmal die zwölf Grundsätze für ein Marketing ohne Manipulation
Kund*innen schreibend gewinnen
„Ich würde gerne schreibend Kundinnen gewinnen“ – hast du diesen Gedanken schon einmal gehabt? Zu wissen, wie wir Marketing betreiben wollen (z.B. mit Blog und Newsletter), anstatt sich an Trends, Hypes und Meinungen von Experten und Expertinnen zu orientieren), ist kraftvoll.
Vor einiger Zeit hatte ich zum ersten Mal einen Gedanken.
Es war kein besonders spektakulärer oder tiefsinniger Gedanke. Und ich bin mir fast sicher, dass ich das bereits Jahre vorher so „gefühlt“ und „intuitiv gewusst“ habe.
Aber irgendwann kam der Gedanke endlich in meinem Kopf an:
„Ich möchte gerne schreibend online sichtbar werden und Menschen erreichen.“
Als ich diesen Gedanken zum ersten Mal – in aller Klarheit – so dachte, spürte ich eine große Erleichterung und Entspannung in meinem Körper. So, als würde ich nach langem Luftanhalten endlich frei durchatmen können.
Zu wissen, wie wir Marketing betreiben wollen (anstatt sich an Trends, Hypes und persönlichen Meinungen von Experten und Expertinnen zu orientieren), ist kraftvoll.
Denn damit wissen wir genau, …
wie wir den großen Teil unserer Tage verbringen wollen (zum Beispiel schreibend) und wie nicht (zum Beispiel redend, tanzend, Grafiken erstellend, live gehend)
welche Tools wir dafür nutzen wollen (zum Beispiel Website, Blog, Newsletter) und welche nicht (zum Beispiel Instagram-Storys, Reels)
welche Fähigkeiten wir kontinuierlich verbessern wollen (zum Beispiel Schreiben) und welche nicht (zum Beispiel vor der Kamera sprechen)
wofür wir uns den überwiegenden Teil unserer Zeit und Energie reservieren (zum Beispiel Schreiben) und wofür nicht (zum Beispiel Social Media)
und dass wir genug gemacht haben, wenn wir einfach „nur“ geschrieben haben
Wir reduzieren FOMO (kein „Alle haben Instagram, nur ich nicht“ mehr), haben Orientierung bei Entscheidungen („Soll ich einen Instagram-Kanal starten oder lieber ein zweites Buch schreiben?“) und geben nicht mehr Unsummen für Kurse und Weiterbildungen aus, die uns in unserem Wunsch, auf eine bestimmte Art und Weise Marketing zu betreiben, nicht weiterbringen.
Möchtest du auch schreibend online sichtbar werden und Kund*innen gewinnen?
Warum FOMO als Marketingstrategie ein Problem ist
Nutzt du bewusst oder unbewusst FOMO als Strategie in deinem Marketing? Warum das ein Problem ist, erfährst du in diesem Blogartikel.
Neulich wollte ich einen Newsletter schreiben und von all den neuen Texten erzählen, die ich in letzter Zeit auf meinem Blog veröffentlicht hatte.
Den Betreff musste ich nicht lange überlegen.
„Hast du das verpasst?“ schoss mir sofort als Betreffzeile in den Kopf.
An sich war die Betreffzeile gut gemeint: Im Frühjahr/Sommer sind bei mir so viele Blogartikel onlinegegangen, dass es mir gar nicht möglich war, von jedem einzelnen im Newsletter zu erzählen.
Gut möglich also, dass die meisten Newsletterabonnent*innen gar nicht mitbekommen haben, was in dieser Zeit auf dem Blog passierte.
Doch bei näherem Überlegen wäre diese Betreffzeile höchst problematisch gewesen:
Denn hier hätte ich um ein Haar mit etwas gespielt, was den meisten Menschen bekannt vorkommen dürfte: FOMO.
Beinahe hätte ich die Angst, etwas zu verpassen, ausgenutzt, um möglichst viele Menschen dazu zu bringen, meinen Newsletter zu lesen.
Was ist an FOMO im Marketing so schlimm?
Wenn ich nach „FOMO im Marketing“ in Google suche, sind die Suchergebnisse nicht etwa kritische Auseinandersetzungen oder ethische Überlegungen, sondern Anleitungen, wie Selbstständige das „mächtige Marketinginstrument“ und „eine der größten psychologischen Strategien des Social-Media-Zeitalters“ FOMO „richtig“ einsetzen können.
Oder warum „FOMO ein Marketingkonzept bereichert“ und „Verkäufe boostet“.
Die gemeinsame Botschaft der Artikel lautet: Wer versteht, wie Menschen ticken, verkauft mehr.
Ja, das ist sicherlich richtig. Wer die Psychologie des Menschen versteht und dieses Wissen fürs Marketing nutzt, hat einen großen Vorteil gegenüber Nichtwissenden und kann mehr verkaufen.
Richtig ist aber auch:
Wer versteht, wie Menschen ticken, und dieses Wissen ohne Reflexion, Verantwortung und ohne jegliche Rückkopplung an andere Werte zur Profitsteigerung nutzt, handelt sehr wahrscheinlich unethisch.
Da hilft übrigens der Zusatz in manchen Artikeln, dass „FOMO erzeugen nicht manipulieren heißt“, auch nicht wirklich.
Denn selbst wenn ein Produkt toll ist und man echten Mehrwert damit bietet, heißt es nicht, dass dadurch automatisch psychologische Tricksereien legitimiert sind.
Ich bin also sehr dafür, folgende Strategien (die in den besagten Artikeln als Tipps formuliert werden, um mehr zu verkaufen) als Red Flags zu betrachten, die alle Selbstständigen für sich reflektieren und kritisch beleuchten sollten.
FOMO im Marketing – eine Sache der Ethik
Marketingstrategien, die wir überdenken sollten
Mit Zeitdruck arbeiten
Der Klassiker für FOMO schlechthin ist, mit Zeitdruck zu arbeiten.
Schnell.
Nur noch heute.
Anmeldung schließt in einer Stunde.
Bonus gilt noch für die nächsten 30 Minuten.
„Aktiviere Push-Benachrichtigungen, um nichts mehr zu verpassen“
Auf Social Media wird FOMO häufig gezielt genutzt, um die Follower zu einer Handlung zu bringen.
Künstliche Verknappung
Klassisches Beispiel: Open und Closed Cart in Launches. Hier kann ein Programm nur wenige Tage im Jahr gebucht werden, selbst wenn man schon Monate vorher weiß, wann das Programm startet.
Das Wort „exklusiv“
Spielt mit dem Wunsch der Zugehörigkeit und der Angst, nicht dazuzugehören oder etwas zu verpassen, wenn man nicht dazugehört.
Social-Proof-Tools
Kritisch sehe ich auch die Benachrichtigungen „Anna L. hat das Produkt vor drei Stunden gekauft“, die viele Unternehmer*innen auf ihren Verkaufsseiten nutzen.
Nicht nur, dass ich – je nach Produkt – absolut keine Lust darauf hätte, dass mein Name, selbst wenn es nur der Vorname ist, dort erscheint und ich es datenschutzmäßig für äußerst problematisch halte, wird hier ganz klar mit der Angst gespielt, nicht dazuzugehören, wenn man das Produkt nicht kauft.
Nicht umsonst heißt einer der gängigsten Anbieter für diese Social-Proof-Benachrichtigungen „FOMO“. #JustSaying
Nur Live-Videos anbieten
An sich ist nichts gegen Live-Veranstaltungen zu sagen. Sie sind sicherlich eine tolle Möglichkeit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und mit Interessent*innen zu kommunizieren.
Allerdings können Live-Videos (sei es in Social Media oder als Webinar) auch FOMO erzeugen, weil sie natürlich nur einmal zu einer bestimmten Zeit stattfinden.
Einfacher Ausweg: Aufzeichnung des Live-Videos anbieten und Abstand von Botschaften wie „Das darfst du nicht verpassen“ nehmen.
„Du kannst nicht dabei sein? Macht nichts. Es wird einen Aufzeichnung geben.“
Und schon ist die übermäßige Angst, etwas zu verpassen, kleiner geworden.
Zeitlich begrenzte Rabatte
Flashsales.
Webinarrabatte.
Frühbucherpreise.
30% nur noch heute.
Angeblich zeitlich begrenzt verfügbare Angebote
Du abonnierst einen Newsletter oder kaufst ein Produkt und auf der Dankeseite bekommst du ein unwiderstehliches Angebot, das nur noch die nächsten 15 Minuten so unverschämt günstig ist. Kennste?
Natürlich ist das Produkt nicht wirklich nur die nächsten 15 Minuten so günstig. Die Botschaft wird allen angezeigt, egal, ob sie heute, morgen oder in drei Monaten auf der Seite landen.
Falls du jetzt an einigen Stellen denkst: „Aber ein paar Sachen davon hast du doch auch mal gemacht, Alex!“
Ja, durchaus.
Da nehme ich mich selber gar nicht raus. Denn auch ich bin durch eine „konventionelle“ Marketingschule gegangen und habe dementsprechend noch viele Überbleibsel in mir, die mir nach und nach überhaupt bewusst werden und die ich dann reflektiere, ändere oder ganz eliminiere.
Aber für mich ist das so wie mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch:
Wir brauchen nicht wenige Menschen, die es perfekt machen, sondern ganz, ganz viele, die es unperfekt machen.
Und vor allem brauchen wir Menschen, die es jeden Tag aufs Neue versuchen und bereit sind, ihre Handlungen kontinuierlich zu reflektieren.
Wenn du dich also heute nach diesem Text entschließt, auch nur eine einzige Strategie zu überdenken, zu ändern oder ganz sein zu lassen, dann: Großartig!
PS: Ich hätte die Zitate im Text natürlich mit Quellen belegen müssen, aber in einem Anflug von zivilem Ungehorsam entschied ich mich, diesen Seiten nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben, als sie es vermutlich eh schon haben.
Ich hab’ Beef mit Jeff! – Warum ich nicht mehr launchen will
Ich habe keine Lust mehr darauf, klassisch zu launchen und Menschen in meine Programme „hineinzufunneln“. Warum ich mich gegen künstliche Verknappung und Co. entschieden habe.
Auf meinem Weg zu einem Social-Media-freien, ethischen Marketing habe ich mein nächstes Dorn im Auge: das Launchen.
Ich mag nämlich nicht mehr Menschen in meine Programme „hineinfunneln“.🙈
Das „klassische“ Launchen, so wie wir es aus dem Onlinemarketing kennen und so wie ich es jahrelang für mich praktiziert habe, ist nämlich alles andere als achtsam und ethisch, wenn wir ehrlich sind.
Sowohl für mich als „Launchende“.
(Manchmal war ich nach dem Launch so ausgebrannt, dass ich dringend Urlaub gebraucht hätte. Und da war der Kurs, den ich gelauncht habe, noch nicht einmal gestartet …)
Als auch für die Menschen, an die ich meine Programme gelauncht habe.
(Ich schätze mal, niemand möchte gerne Mails à „Das Angebot gibt es nur noch eine Stunde – friss oder stirb“ bekommen.)
Doch wie können wir unsere Onlineprogramme mit Teilnehmer*innen füllen, ohne mit Druck, psychologischen Tricks und dem üblichen Marketing-Blabla zu arbeiten?
Lass uns dafür zunächst einmal das klassische Launchprinzip angucken.
Das klassische Launchen nach Jeff Walker
Launchen, so wie wir es kennen, basiert auf der sogenannten „Product Launch Formula“ von Jeff Walker.
Der gute Jeff hat nämlich herausgefunden, dass man Programme und digitale Produkte viel besser verkauft, wenn es eine künstliche Verknappung gibt.
So wird der Warenkorb an einem Tag – meist durch ein Webinar – geöffnet („Open Cart“) und nach ein paar Tagen wieder geschlossen („Closed Cart“). Und davor und danach kann das Programm nicht mehr gekauft werden.
In der Open-Cart-Phase bedient sich Jeff der üblichen E-Mail-Marketing-Taktiken mit Deadlines, Timern und sogenannten „mentalen Triggern“, also psychologischen Tricks, die Menschen dazu bringen sollen, das Produkt zu kaufen.
Warum ich Beef mit Jeff hab
Zunächst einmal hat Jeff natürlich absolut Recht:
Marketing mit Verknappung und anderen mentalen Triggern „funktioniert“. In dem Sinne, dass ein Programm tatsächlich interessanter ist und ein „Habenwollen“ auslöst, wenn es nur wenige Tage im Jahr zur Verfügung steht.
Ist bei mir ein bisschen so wie mit Bärlauch. Ich mag ihn nicht besonders. Aber wenn ich ihn im Frühling beim Spaziergang mit dem Hund entdecke, denke ich: „Nimmst ihn halt mal mit, sonst musst du wieder ein Jahr warten … “
Alle großen Online-Unternehmer*innen, die ich kenne, bedienen sich dieser Bärlauch-Taktik. Und das erfolgreich.
Doch darf ich mich psychologischen Tricks bedienen, einfach nur weil … es funktioniert? Darf ich ggf. fragwürdige Marketingtaktiken anwenden, einfach nur weil … es alle machen? Darf Wachstum und finanzieller Erfolg der einzige Wert sein, den ich im Marketing verfolge?
Ich glaube:
Nein.
Nein.
Und nein.
Und ich schätze mal, du siehst es ähnlich.
Ja, vermutlich sehen das die meisten Selbstständigen ähnlich.
Niemand will manipuliert werden. (Doch die meisten Selbstständigen manipulieren.)
Und da nehme ich mich selbst nicht raus. In der Vergangenheit habe ich auch Jeffs Buch inhaliert und mit Deadlines und Timern gearbeitet, weil es so schön „funktioniert“ hat. Doch was ist die Alternative?
Vielleicht denkst du jetzt:
„Ist ja schön und gut. Ich bin auch für Ethik und Moral. Aber gleichzeitig will ich von meiner Selbstständigkeit leben können. Was ist also die Alternative?“
Ich weiß es nicht so genau.
(Also noch nicht.)
Aber ich begebe mich auf die Suche.
Ich bin auf dem Weg.
Und ich werde berichten.😊
Was ich ab sofort nicht mehr mache
Einiges habe ich aber schon in den letzten Wochen umgesetzt und geändert.
Keine „charmanten Preise“ mehr
Da wäre zum einen die Sache mit den Preisen.
Bestimmt ist dir nämlich schon aufgefallen, dass Preise sehr häufig auf „7“ oder „9“ enden, oder? Sei es im Discounter oder bei hochpreisigen Coaching-Angeboten …
„Charm Pricing“ nennt sich das und meint die psychologische Preisgestaltung, die suggeriert, dass ein Produkt günstiger ist, als es ist.
Deshalb kosten Onlinekurse auch oft „497“, „997“ oder „1497“ Euro.
Wir denken „Cool, noch dreistellig“ und kaufen, ohne mit der Wimper zu zucken, das Produkt, das eigentlich bereits vierstellig kostet.
Auch ich habe mich jahrelang dieser Strategie bedient.
Gar nicht mal, weil ich dachte: „Jetzt will ich Menschen zum Kauf meines Produktes manipulieren. MuahahaHAHAHA.“
Sondern weil es alle so machten.
Ich weiß, dass „Weil es alle machen“ ein doofer Grund ist. Und genau deshalb habe ich mich, bei den Dingen, die ich anbiete (wie meinen Onlinekursen zum Beispiel), gefragt, ob ich mich noch länger dieser psychologischen Preisgestaltung bedienen will.
Und: nein.
Will ich nicht.
Deshalb enden meine Preise jetzt – wie mein Stundensatz ja auch – regulär auf einer „0“.
Kein Aufpreis mehr für Ratenzahlungen
Eine zweite Sache, die ich bei der Preisgestaltung für meine Produkte geändert habe, betrifft die Ratenzahlung.
Klassischerweise sollen im Launch Einmalzahlungen belohnt und Ratenzahlung bestraft werden. Deshalb sind Ratenzahlungen bei den meisten Onlineprogrammen auch teurer.
Dafür gibt es an sich eine vernünftige Erklärung:
Ratenzahlungen bedeuten für den oder die Anbieter*in einen buchhalterischen Mehraufwand und natürlich ist da immer auch ein gewisses Risiko, dass die letzten Raten nicht bezahlt werden.
Das ist alles richtig. Doch inzwischen empfinde ich einen Aufpreis für Ratenzahlungen einfach nicht mehr als sozial.
Gerade Einsteiger*innen können sich vier- oder fünfstellige Produkte – selbst wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurden und ihren Preis absolut wert sind – oft noch nicht leisten.
Sie sind auf Ratenzahlungen angewiesen, und wie doof ist es eigentlich, diese Situation als Unternehmerin auszunutzen und Einsteiger*innen mit höheren Preisen zu „bestrafen“? (Um nicht zu sagen: zu diskriminieren.)
Dabei ist es für Unternehmer*innen mit mehr finanziellen Ressourcen doch ein Leichtes, solidarisch mit denjenigen zu sein, die weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben, und soziale Preismodelle anzubieten?!
Umso mehr, wenn genau diese Unternehmer*innen regelmäßig größere Summen an Hilfsorganisationen spenden und sich auf Social Media als wahnsinnig „sozial“ geben.
Ratenzahlungen biete ich deshalb ab sofort ohne Aufpreis an.
Keine Timer und künstliche Deadlines mehr
Wenn es kein klassisches „Open Cart“ und „Closed Cart“ gibt, brauche ich auch keine Timer und künstlichen Deadlines mehr.
(Juhu!🥳 Hab sie sowieso immer gehasst!)
„Nur noch zwei Stunden sind die Türen zu meinem Programm geöffnet. Buche jetzt noch schnell.“
Solche Mails möchte ich in Zukunft nicht mehr verschicken.
Kein Zeitdruck mehr für mich
Und schließlich ist das Ganze auch noch für mich viel entspannter.😊
Auf andere Menschen Druck auszuüben, selbst wenn es „nur“ per E-Mail ist, hat natürlich auch auf mich selbst Druck ausgeübt.
Kein Wunder, dass ich mich nach Launches so oft ausgelaugt und erschöpft fühlte.
Mehrere Wochen vor einem gemeinsamen Start die Türen zu einem Programm zu öffnen, fühlt sich herrlich entspannt an. Ich muss nicht – pünktlich zu einem Webinar – fit sein, sondern mehrere Wochen Zeit, um auf dem Blog oder Newsletter über mein Programm zu reden.😊
Stattdessen will ich nun Folgendes tun
Fiese Gedanke verbannen und stärkende Gedanken denken
Zunächst einmal starte ich – wie immer – im Innern. Da ist nämlich dieser hartnäckige Glaubenssatz in mir, dass ich nicht erfolgreich sein kann, wenn ich ethisch handle.🙈
Verrückt, oder?
Ich vermute: Das ist Gedankengut aus Sowjetzeiten, wo jede*r, der oder die erfolgreich sein wollte, krumme Dinger drehen und jemanden bestechen musste. (Ich wünschte, das wäre ein Witz.)
Weg damit.
„Ich kann ein ethischer Mensch sein und genügend Umsatz machen, um ein schönes Leben zu führen.“
Viel besser.
Diesen Satz schreibe ich mir nun jeden Tag zehnmal irgendwohin, bis auch die letzte Zelle in meinem Körper verstanden hat, dass es so ist.😜
Wartelisten
Solange ich nicht genau weiß, wann ich das nächste Mal ein Programm anbieten kann und will, biete ich Menschen die Möglichkeiten an, sich in Wartelisten einzutragen.
Das möchte ich auch in Zukunft so handhaben.
Wartelisten finde ich für beide Seiten herrlich entspannt und unkompliziert.
Menschen, die grundsätzlich Interesse an einem Programm haben, tragen sich in eine Warteliste ein, selbst wenn ich die Details noch nicht festgelegt habe.
Sobald Zeitraum, Leistungsumfang und Preis feststehen, schreibe ich ihnen eine Mail und sag ihnen Bescheid.
Natürliche Verknappung(en) kommunizieren
Es gibt für mich einen großen Unterschied zwischen künstlicher und natürlicher Verknappung.
Natürliche Verknappung hat einen guten, nachvollziehbaren Grund wie
eine begrenzte Zahl der Teilnehmer*innen, um alle bestmöglich unterstützen zu können
begrenzt freie Slots für Mentorings, weil der Tag nun mal 24 Stunden hat und ich nicht mehr als X Mentoringkund*innen parallel haben kann, ohne mich zu verzetteln
Anmeldemöglichkeit endet an Tag X, weil wir am Tag darauf gemeinsam starten
Diese natürlichen Verknappungen, empfinde ich nicht als Manipulation und werde sie auch weiterhin kommunizieren.
Schließlich ist es auch absolut in Ordnung, wenn Hotels oder Restaurants auf ihrer Website erzählen, dass sie nur eine begrenzte Anzahl an Zimmern oder Plätzen zur Verfügung haben.
Oder hast du schon einmal gedacht:
„Boah, nur 40 Hotelzimmer?! Wie können sie es wagen, so viel Druck auf mich auszuüben?!“
Kapazitäten transparent zu kommunizieren oder die Zahl der Teilnehmer*innen zu begrenzen (um sie optimal unterstützen zu können), finde ich immer noch absolut legitim. Für Hotels und Restaurants. Und natürlich auch für Berater*innen und Coaches.
Working out loud
Ich liebe das Konzept von „Working out loud“.
„Working out loud“ heißt vereinfacht, dass ich nicht einfach nur im stillen Kämmerlein vor mich hin arbeite, sondern dass ich Menschen an meiner Arbeit teilhaben lasse und Wissen teile.
Das kann ein Behind-the-Scenes-Blogartikel so wie dieser hier sein. Oder auch ein persönlicher Newsletter.
Statt mich unnahbar zu geben und Entwicklungen oder Erkenntnisse zu verheimlichen, erzähle ich offen die Hintergrundgeschichten zu meinen Angeboten, rede über meine Werte, Denkprozesse und (innere oder äußere) Veränderungen.
Das ist für mich nicht Manipulation.
Das ist Sichtbarkeit.
Das ist Teilen von Wissen.
Das ist „Working out loud“.
Online-Events
Online-Events wie Webinare, Workshops oder Kongresse sind aus meiner Sicht nicht per se „manipulativ“.
Sie können – wie im klassischen Launchen – natürlich als Strategie genutzt werden, um die Open-Cart-Phase einzuleiten und Menschen in den „Funnel“ zu bekommen.
Sie können aber auch einfach nur eine Möglichkeit sein, um sichtbar zu machen, was wir wissen und wie wir Menschen mit unseren Angeboten helfen können.
Und Letzteres finde ich immer noch absolut in Ordnung.
Eine Online-Veranstaltung nach dem Muster
„Hier ist das was ich weiß, tue und kann. Und hier ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten.“
ist nämlich etwas völlig anderes als
„Hier ist das, was ich weiß, tue und kann. Und du hast nun fünf Tage Zeit zu entscheiden, ob du mit mir zusammenarbeiten willst. (Ansonsten erst nächstes Jahr wieder! #SorryNotSorry) Und wenn du dich in den nächsten 15 Minuten entscheidest, bekommst du Boni im Wert von drölfzig tausend Euro.“
Das Erste ist Sichtbarkeit. Das Zweite ist Druck. (Und psychologische Trickserei.)
FOMO (Fear Of Missing Out): Symptome, Gründe, Tipps
Was ist FOMO aka Fear Of Missing Out genau? Was hat FOMO mit Social Media zu tun, wie zeigt sie sich im Alltag und vor allem: Was können wir tun, um FOMO zu reduzieren oder vielleicht sogar in JOMO (Joy Of Missing Out) zu verwandeln?
Eine Kollegin ist bei einem Netzwerk-Event und postet ein Selfie mit anderen Kolleginnen …
Eine zweite erzählt in ihren Storys, dass sie jetzt auf dieser angesagten neuen Plattform ist und schon 10k Follower hat…
Eine dritte lacht auf Facebook in die Kamera, während sie ins Flugzeug nach Bali steigt …
Eine vierte hat ein zweites Unternehmen gegründet, das schon nach acht Wochen durch die Decke geht …
Eine fünfte verkündet stolz, dass sie dieses Jahr eine Million Euro Umsatz gemacht hat …
Und du?
Du liegst gerade in Embryonalstellung auf der Couch, scrollst apathisch durch deinen Feed (während im Hintergrund die fünfundzwanzigste Wiederholung von Friends läuft) und fragst dich, ob du der langweiligste Loser bist, den die Menschheit je gesehen hat.
Ein typischer Fall von FOMO.
Inhalt
Welche Rolle spielen Smartphones, das Internet und Social Media?
Doch halt … Was bedeutet FOMO eigentlich?
FOMO = Fear Of Missing Out
FOMO ist ein Akronym, das sich aus den Anfangsbuchstaben von „Fear Of Missing Out“ zusammensetzt und auf deutsch „Angst, etwas zu verpassen“ bedeutet.
Dieses „etwas“ kann dabei theoretisch alles sein:
eine soziale Interaktion
eine Begegnung
eine Erfahrung
ein Ereignis
ein Erlebnis oder auch
eine Möglichkeit, neue Kund*innen zu gewinnen
So äußert sich das Phänomen FOMO in der Angst, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, abgehängt zu werden und außen vor zu bleiben.
Egal, ob in der Schule, im Studium, im Job, in der Selbstständigkeit, in der Freizeit oder in allen Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen: unter Freundinnen, Kollegen oder Familie.
FOMO: Welche Rolle spielen Smartphones, das Internet und Social Media?
Während die Angst, etwas zu verpassen, mit Sicherheit so alt ist, wie die Menschheit selbst („Oi, da hinten wird ein Mammut zerlegt, schnell hin, bevor der Säbelzahntiger kommt!“), ist der eigentliche Begriff FOMO noch relativ jung.
Patric James McGinnis verwendete ihn das erste Mal im Jahre 2004 in seinem Artikel für das Magazin der Harvard Business School. Darin beschrieb er als erster ein Gefühl, das ein typisches Syndrom für unseren digitalisierten Alltag werden sollte.
FOMO und Social Media
Kein Wunder eigentlich, dass im selben Jahrzehnt nicht nur das erste iPhone erschien (2007), sondern auch Facebook (2004) und Instagram (2010) gegründet wurden.
Denn Social Media ist für FOMO vor allem eins: Öl im Feuer.
Auf einmal können wir durch Statusupdates, Bilder oder Videos zu jeder Tages- und Nachtzeit Einblick in das Leben der anderen bekommen.
Egal, wo sie wohnen.
Und egal, wer sie sind. (Ob Cousine dritten Grades oder Beyoncé.)
Wir können uns mit unseren liebsten Freundinnen freuen.
Checken, was unsere jugendlichen Kinder so treiben.
Wir können unsere Ex-Partner „stalken“.
Nachgucken, ob unser Schwarm aus der Grundschule schon eine Glatze hat.
Oder ob die Erzfeindin aus der 7. Klasse mittlerweile vielleicht schon geschieden ist.
Sehen, wie es unserer Großtante in Kanada geht.
Und wie erfolgreich (oder nicht erfolgreich) unsere Kolleginnen sind.
FOMO und Nachrichtenkonsum
Auch die Nachrichtenseiten mit ihren sich minütlich aktualisierten Inhalten wecken den Wunsch, ständig up to date zu bleiben.
Statt einmal am Tag die Tageszeitung zu lesen oder abends die Nachrichten im Fernsehen zu gucken, checken wir nun mehrmals täglich (stündlich, minütlich), was es Neues in der Welt gibt.
Gleich morgens im Bett (oder allerspätestens auf dem Klo) nehmen wir das Smartphone zur Hand und hüpfen von einem Newsfeed zum nächsten:
Live-Blog zur Corona-Pandemie.
Live-Blog zur Bundestagswahl.
Live-Blog zum Ukraine-Krieg.
Bloß keine Meldung verpassen. Könnte ja etwas Wichtiges sein.
FOMO und E-Mails
Und wer kennt diesen Drang nicht, alle paar Minuten seinen Posteingang zu checken?
Schließlich könnte ja die Anfrage, die Zusage oder das Angebot drin sein!
Die typischen FOMO-Symptome
Doch die Möglichkeit, jederzeit an Neuigkeiten zu kommen und mit allen jederzeit online in Verbindung bleiben zu können, kommt mit einem hohen Preis.
Die Liste in lang:
FOMO und POPC
Eng verknüpft mit FOMO ist das Phänomen POPC, was „permanently online, permanently connected“ bedeutet.
Die Angst, etwas zu verpassen, führt zu einer Dauerpräsenz in den sozialen Netzwerken.
Und so wird Instagram nicht nur geöffnet, wenn man alleine ist und sich langweilt, sondern auch, wenn man mit anderen Menschen beisammensitzt, mit Freunden etwas unternimmt, während des Essens oder sogar während der Autofahrt.
Das Smartphone wird das erste sein, was man morgens nach dem Aufwachen berührt, und das letzte, bevor man abends einschläft.
Und mittlerweile hat die Angst, ohne Smartphone zu sein, sogar einen eigenen Namen bekommen: Nomophobie.
FOMO und FOBO
In einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten wird es immer schwerer, sich für eine Option zu entscheiden – und dabei zu bleiben.
Denn egal, wie toll dein Job, Hobby, Urlaub, ja dein Leben klingen mag – auf Instagram findest du mit Sicherheit jemanden, dessen Leben noch ein bisschen eindrucksvoller und spannender ist.
FOBO bedeutet „Fear Of Better Options“ und beschreibt die Angst vor besseren Möglichkeiten, also die Angst, dass sich hinter dem nächsten Klick mit Sicherheit eine noch bessere Alternative versteckt.
Ob ich schon einmal mehrere Stunden durch Pinterest gescrollt und nach einem Rezept für ein nahrhaftes Abendessen gesucht habe, um dann anschließend frustriert (und aus Zeitnot) einfach nur Pizza zu bestellen?!
I have.
Chronischer Stress
FOMO, FOBO, POPC – die Abkürzungen mögen zwar lustig klingen, aber die Folgen sind es nicht:
Die ständige Angst, etwas zu verpassen, der Druck, ständig online sein zu müssen, die ewige Jagd nach der noch besseren Alternative – all das erzeugt chronischen Stress.
Dieser kann sich in einer inneren Unruhe äußern, falls man mal nicht am Smartphone ist, und auch zu Schlafstörungen oder psychosomatischen Beschwerden wie Schweißausbrüchen führen.
Wir verlernen, präsent zu sein, und einen Moment wirklich zu genießen.
Stattdessen suchen wir jede Minute unseres Alltags darauf ab, ob sich daraus ein Post oder zumindest eine nette Story machen lässt.
Pic or it didn’t happen!
Die Konzentrationsfähigkeit und Produktivität nehmen ab
Irgendwann können wir uns nicht mehr so gut konzentrieren.
Zwischen dem Checken der Nachrichten-Live-Blogs, des Insta-Feeds, der Mails, der WhatsApps, der Likes, Follower und Kommentare schieben wir unsere „eigentlichen“ Aufgaben dazwischen, kommen aber zu nichts.
Denn unser Gehirn ist zu sehr damit beschäftigt, zwischen unzähligen Aufgaben zu switchen, und bekommt gar nicht erst die Chance, tiefer in eine Aufgabe einzutauchen und in den Flow zu kommen.
Wie unkonzentriert und unproduktiv ich durch FOMO und Social Media wurde, habe ich hier aufgeschrieben.
Überreizung, Erschöpfung und Schlafstörungen
Als introvertierter und hochsensibler Mensch habe ich es am eigenen Leib erfahren: Die vielen Videos und Posts, die kurzen Storys, die ständigen Pushbenachrichtigungen – es waren einfach zu viele Reize.
Schon fünf Minuten durch den Feed scrollen bedeutete für mich eine so große Menge an Informationen, dass ich sie gar nicht richtig verarbeiten konnte.
Ich fühlte mich ausgelaugt und erschöpft.
Jeden Tag.
Doch es gibt noch einen weiteren Grund für Erschöpfung durch FOMO:
Viele Jugendliche lassen sich nachts von ihrem Smartphone wecken und sind infolgedessen tagsüber übermüdet. Einer Studie zufolge stehen rund 20% aller Jugendlichen nachts auf, um Nachrichten oder Social Media zu checken.
Vergleicheritis
Kuratierte Highlights von Fremden im Internet führen dazu, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen.
Wie wir unsere Freizeit verbringen …
Wie viel Umsatz wir machen …
Unsere Reiseziele …
Unsere Wohnung …
… nichts ist im Vergleich zu den auf Hochglanz polierten Social-Media-Fassungen mehr gut genug.
Gefühl der sozialen Isolation
Daraus kann sich eine gefährliche Spirale entwickeln: Man fühlt sich einsam, nutzt die sozialen Netzwerke, um Verbindung mit anderen Menschen zu spüren – und fühlt sich letzten Endes (da alle anderen vermeintlich erfolgreicher sind und das spannendere Leben führen) isolierter als zuvor.
Angststörungen und Depressionen
Inwiefern soziale Medien Angststörungen und Depressionen begünstigen oder verstärken, ist inzwischen Gegenstand vieler Studien.
Manche sagen: nein.
Andere sagen: ja. (Vor allem bei jungen Mädchen.)
Mehr Unfälle im Straßenverkehr
FOMO ist aber nicht nur eine Gefahr für die mentale Gesundheit, sondern auch für die körperliche.
Einer Studie zufolge führt FOMO – völlig unabhängig von Alter und Geschlecht – zu einem risikoreichen Verhalten und damit zu potentiell mehr Unfällen im Straßenverkehr. Denn immer mehr Menschen nutzen ihr Smartphone nicht nur im Sitzen, sondern auch während sie auf der Straße laufen.
Gründe für FOMO
Woran liegt es, dass manche Menschen mehr unter FOMO leiden als andere?
Unerfüllte Bedürfnisse nach Autonomie und Verbindung
US-amerikanische und englische Forscher*innen haben in ihren Studien zu FOMO herausgefunden, dass es unter anderem mit unerfüllten Bedürfnissen nach Autonomie und Verbindung beginnt:
Wer sich einsam fühlt und mit seiner Lebenssituation unzufrieden ist, spürt häufiger FOMO und nutzt daraufhin vermehrt Social Media, um Verbindung zu anderen Menschen herzustellen.
Doch soziale Medien lösen FOMO nicht, sondern verstärken FOMO oft, was wiederum zu noch mehr Social-Media-Nutzung führt.
Eine doofe Spirale, aus der es gar nicht so leicht ist, wieder rauszukommen.
Geringes Selbstwertgefühl
Für mich ist FOMO immer auch mit dem Selbstwertgefühl verbunden. Denn letzten Endes steckt hinter FOMO immer die Annahme, dass
dort, wo ich jetzt bin,
das, was ich jetzt weiß,
das, was ich jetzt kann, und
das, was ich jetzt habe,
nicht genug ist.
Toxische Hustle Culture
Für Selbstständige spielt die Hustle Culture oft noch eine wichtige Rolle.
Der Lifestyle, in dem Karriere und Selbstverwirklichung wichtiger sind als Gesundheit, Familie und Hobbys, wird so verinnerlicht, dass es zur Normalität wird, permanent zu arbeiten.
GaryV zum Beispiel zelebriert diesen Lifestyle in den meisten seiner Videos, wenn er sich als der Hustle-Papst darstellt, der täglich 15 Stunden arbeitet, nie Feierabend macht, sich am Wochenende nicht ausruht und niemals in den Urlaub fährt.
„Kein Wunder, dass du nicht erfolgreich bist“, ist seine Message dann. „Schließlich nimmst du dir am Samstag frei, anstatt Content für deine Follower zu erstellen.“
#redflag
Selbstoptimierungs- und Produktivitätshype
Eng damit verknüpft sind der Selbstoptimierungs- und Produktivitätshype: Jede Minute des Tages gilt es inzwischen, produktiv zu nutzen.
Ausschlafen war gestern. Heute hat jeder einen „Miracle Morning“ und steht um 5 Uhr nachts auf, um Yoga zu machen.
Einfach so spazieren gehen und die Sonne genießen? Undenkbar! Lieber währenddessen einen Podcast hören, um sich gezielt weiterzubilden. 🤓
Das gleiche gilt fürs Kochen, Putzen und Wäsche waschen. Bitte immer mit Knopf im Ohr mit der neuesten Episode deines liebsten Podcasts zur Persönlichkeitsentwicklung.
(Sonst entwickelt sich deine Persönlichkeit noch zurück, wenn du das Klo putzt, während du Rage against the Machine hörst.)
Lesen? Ja, aber bitte nur Sachbücher, die dich beruflich weiterbringen. Am besten jeden Tag 20 Seiten, bevor du deinen Bulletproof-Kaffee trinkst.
Produktiv ist das neue Normal.
Kapitalismus
Stell dir vor, wenn alle Menschen sich nachmittags glücklich und zufrieden in die Sonne legen und ihren Feierabend mit ihrer Familie verbringen würden, anstatt ihre Zeit auf Social Media zu vertrödeln. – Wer würde dann auf all die Werbeanzeigen klicken und Dinge kaufen, die niemand wirklich braucht?
Deshalb ist es im Kapitalismus durchaus erwünscht, dass du ständig Angst hast, etwas zu verpassen. So kannst du dich noch mehr auf Social Media rumtreiben und noch mehr konsumieren.
Aufmerksamkeitsökonomie Social Media
Natürlich gab es Werbung und damit den Kampf um deine Aufmerksamkeit auch schon vor Social Media.
Doch noch nie ließ es sich so exakt messen, welche Themen, Headlines, Content-Formate und Co. funktionieren.
In Zeiten von Clickbaiting, Fake News und Katzenvideos scheint alles legitim zu sein, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hauptsache, die Engagement-Rate stimmt!
Man könnte es auch so formulieren:
Es gibt Menschen, deren Job ist es, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen und es dir möglichst schwer zu machen, offline zu gehen.
Kein Wunder, dass es nahezu unmöglich scheint, FOMO wieder loszuwerden.
Tipps, um FOMO loszuwerden oder zu vermeiden
„Nobody really cares if you don’t go to the party“
Hustle Culture durchbrechen
Es wäre viel gewonnen, wenn Selbstständige es schaffen würden, die Hustle Culture, der sie überall auf Social Media ausgesetzt sind, zu durchbrechen.
Wenn sie ihre Selbstständigkeit als nur einen von mehreren wichtigen Bereichen des Lebens begreifen und ihn nicht Tag für Tag aufs Neue gegenüber Gesundheit, Familie, Freunden und ihren Hobbys priorisieren würden.
Das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen verändern. Aber du kannst schon heute damit beginnen und …
Kund*innen gegenüber Grenzen setzen und dein Smartphone einfach mal ausstellen, wenn du Feierabend hast
dir auch wirklich einen Feierabend nehmen, wenn wir schon dabei sind
deine Gesundheit ernst zu nehmen und für ausreichend Bewegung sorgen
dein Smartphone aus dem Schlafzimmer verbannen
Beim Selbstwertgefühl ansetzen
Sich klarmachen, dass du gut genug bist.
Dass das, was du weißt,
das, was du kannst, und
das, was du tust,
jederzeit zu 100% gut genug ist.
Du kannst das nutzen, was du bereits hast (Wissen, Erfahrungen, Intuition) und musst dir nicht erst noch drölfzig YouTube-Videos ansehen oder Onlinekurse kaufen.
Verhalten reflektieren
Du kannst dein Verhalten reflektieren und dich fragen:
Warum habe ich jetzt das Smartphone in die Hand genommen?
Was brauche ich gerade eigentlich?
Kann mir das Smartphone geben, was ich brauche?
Welches Bedürfnis versuche ich mit dem Social-Media-Konsum zu erfüllen?
Bringt mich dieses Scrollen irgendwie weiter?
Welche Gewohnheit steckt hinter dem Griff zum Smartphone? (Kann ich einen Auslöser identifizieren?)
Journaling kann eine gute Möglichkeit, um den Reflexionsprozess zu begleiten.
Akzeptieren, dass jeder Mensch einzigartig ist
Es ist verrückt: Eigentlich hasse ich als introvertierter Mensch Großveranstaltungen mit jeder Faser meines Körpers. Doch wenn ich sehe, wie Kolleg*innen sich auf genau diesen Veranstaltungen rumtreiben und ihre Selfies schießen, werde ich ein bisschen neidisch … 🙈
Warum eigentlich?
Jeder Mensch hat unterschiedliche Persönlichkeiten, Werte, Interessen und Ziele.
Und nur weil manche Menschen es toll finden, alle Zelte abzubrechen, um in einem kleinen Van durch die Welt zu reisen, heißt es nicht, dass es auch zwingend ein passender Lebensentwurf für mich sein muss.
Hier ist ein Satz, der mir immer geholfen hat, wenn die Vergleicheritis auf Social Media überhand genommen hat:
Es ist okay, ein ruhiges Leben zu führen und zufrieden zu sein.
(Selbst wenn andere Menschen ein wildes führen.)
Präsenz trainieren
Es kann hilfreich sein, sich dafür zu entscheiden, in bestimmten Situationen kein Smartphone mehr zu nutzen und Smartphone-freie Zonen oder Smartphone-freie Zeiten zu etablieren.
Hier sind drei Ideen:
Ganz bewusst ohne Smartphone essen
Ohne Smartphone (und Podcast!) spazierengehen
Schlafzimmer zur Smartphone-freien Zone erklären
Wie kannst du lernen, den Moment zu genießen? Denn wenn du zufrieden in deinem Strandkorb an der Nordsee sitzt (oder auf deinem Liegestuhl im Garten), ist es auch egal, dass Influencer*innen gerade auf Bali in der Hängematte schaukeln.
Natürlich kannst du auch digitale Achtsamkeit in deine Social-Media-Praxis integrieren und beispielsweise
Accounts, die dir nicht gut tun und FOMO auslösen, ganz gezielt entfolgen
Social-Media-Apps am Wochenende deinstallieren
oder gleich einen längeren Social-Media-Detox oder gleich einen Digital Detox einlegen
21 Ideen für Social-Media-Pausen habe ich hier aufgeschrieben.
Hinter die Kulissen blicken
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass du immer nur die Bühnenfassung in den sozialen Medien siehst.
Die Highlights.
Das Endprodukt.
Die Crème de la Crème.
Du siehst die retuschierten, auf Hochglanz polierten Momentaufnahmen, die in den meisten Fällen nicht der (vollständigen) Realität entsprechen. Und wenn du dein Behind-the-Scenes-Ich mit der Bühnenfassung eines Menschen auf Social Media vergleichst, kannst du nur verlieren.
Wenn FOMO oder Vergleicheritis aufploppen, kannst du dir deshalb sagen:
Das ist nicht das ganze Bild.
Das ist verkürzt dargestellt.
Das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Alleinsein lernen
Du kannst dich darin üben, Zeit alleine zu verbringen. Gerne erst fünf Minuten, wenn dich ein längerer Zeitraum noch überfordert.
Du kannst die Gedanken und Gefühle, die hochkommen, beobachten und dich auf deinen Atem konzentrieren.
Vielleicht genießt du es schon bald, etwas alleine und nur für dich zu tun? Einen Spaziergang zum Beispiel. Oder das Aufschreiben von Gedanken, Lesen, ein Musikinstrument spielen und so weiter.
FOMO in JOMO (= Joy Of Missing Out) oder LOMO (= Love Of Missing Out) verwandeln
Was liebe ich es inzwischen, Dinge auf Social Media zu verpassen.😁
Die Bots.
Den Hass.
Die Schwurbler.
Die realitätsfremden Ratschläge von priviligierten Coaches, die keine Ahnung haben, was es heißt, als Mutter selbstständig zu sein und mit Kind, Job und Haushalt zu jonglieren.
Alles hat zwei Seiten.
Wenn du dir klarmachst, was du gewinnst, wenn du etwas auf Social Media verpasst, ist es viel leichter.
Unproduktivität lernen
Du kannst den Produktivitäts- und Selbstoptimierungshype auch einfach ignorieren und so etwas Verrücktes tun wie
Ausschlafen
dir spontan freinehmen und den ganzen Arbeitstag damit verbringen, dir die zweite Staffel von Bridgerton reinzuziehen
einen seichten Roman lesen, bei dem du schon auf der ersten Seite weißt, wie die Geschichte ausgeht
Ohne Podcast kochen (😱) und mit deinen Mitmenschen reden
Du musst nicht jede Minute des Lebens etwas leisten, ständig online sein. Du darfst auch einfach nur sein.
Social-Media-Kanäle löschen
Ich selbst habe einen radikalen Schritt gemacht, um FOMO loszuwerden, und meine Social-Media-Profile gelöscht.
Es war faszinierend zu beobachten, dass ich in den ersten Tagen immer noch automatisch nach dem Smartphone gegriffen habe, um Insta zu checken, sich das aber nach wenigen Wochen bereits vollständig gelegt hat.
Inzwischen spüre ich 0,0% FOMO, wenn ich an Social Media denke, und zu 100% JOMO.😊
Und wenn ich wissen will, wie es bestimmten Menschen geht, dann schreibe ich ihnen einfach eine Nachricht, treffe mich mit ihnen auf einen virtuellen Kaffee in Zoom oder sehe sie gleich live und in Farbe.
E-Mails vom Smartphone deinstallieren
Falls du zu den Menschen gehörst, die ständig E-Mails checken, probiere es mal aus, die E-Mail-Apps von deinem Smartphone zu deinstallieren.
Plus: E-Mails am Smartphone sind richtige Zeitfresser. Meist lesen wir die Mails nur und antworten später, wenn wir wieder am Rechner sitzen. Ich habe für mich schon vor Jahren beschlossen, dass ich keine E-Mails auf meinem Smartphone brauche. Und es ist herrlich.
Rituale etablieren
Hier sind drei Ideen:
Tag ohne Smartphone beginnen
Tag ohne Smartphone beenden
Pausen ohne Smartphone verbringen
Solche Rituale sind der beste Garant für digitale Balance.
Fragen zu FOMO (Fear of missing out)
Was bedeutet die Abkürzung FOMO?
Die Abkürzung FOMO („Fear of missing out“) steht für die Angst, etwas zu verpassen.
Was ist das Gegenteil von FOMO?
Das Gegenteil von FOMO ist JOMO, was „Joy of missing out“ bedeutet und mit „Freude, etwas zu verpassen“ übersetzt werden kann. Denn etwas zu verpassen, muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein.
Was bedeuten die Abkürzung LOMO, FOBO und MOMO?
Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine neue Abkürzung daher.😊
Neben FOMO und JOMO gibt es auch die Abkürzungen LOMO, FOBO UND MOMO.
LOMO ist quasi die Steigerung von JOMO und bedeutet „Love of missing out“ („Die Liebe, etwas zu verpassen“).
FOBO steht für „Fear of better options“ und beschreibt die Angst, die viele Menschen haben, dass an der Ecke eine noch bessere Option wartet. Entscheidungsschwierigkeiten also.
Du weißt, dass deine Freunde sich ohne dich treffen, aber bisher wurden noch keine Fotos auf Instagram mit Cocktails gepostet? Ein typischer Fall von MOMO („Mystery Of Missing Out“).
Was bedeutet Nomophobie?
Nomophobie bezeichnet die Angst, ohne Handy zu sein.
Wie zeigt sich FOMO im Marketing?
FOMO wird von Selbstständigen und Unternehmen gerne und oft im Marketing verwendet, um Menschen zum Kaufen zu bringen. Meine Gedanken dazu habe ich im Blogartikel „Warum FOMO als Marketingstrategie ein Problem ist“ aufgeschrieben.
Ist FOMO eine Krankheit?
Eine Krankheit im Sinne des ICD ist FOMO (noch) nicht. Aber eins steht auf jeden Fall fest: FOMO kann sich auf jeden Fall zu einer ernsten Belastung entwickeln. Glücklicherweise lässt sich FOMO mit Gewohnheiten auf ein Minimum reduzieren.
Was kann man gegen FOMO tun?
Wer FOMO wieder loswerden will, hat mehrere Möglichkeiten. Eine Herangehensweise ist, die Hustle Culture, nach der Selbstständige immer busy sein zu haben, zu durchbrechen und auch mal unproduktiv zu sein. Gerade präsent zu sein, spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, FOMO loszuwerden. Denn wer präsent ist – wirklich da im Moment –, der muss nicht zwingend nach dem Smartphone greifen und gucken, was gerade so auf Instagram passiert.
Apropos: Wenn es die sozialen Netzwerke sind, die FOMO auslösen, sollte man überlegen, den Konsum auf ein Minimum zu reduzieren oder einige Kanäle ganz zu löschen. Das Wichtigste ist aber sicherlich die Reflexion des eigenen Verhaltens.
Wie entsteht FOMO?
US-amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass vor allem unerfüllte Bedürfnisse nach Autonomie und Verbindung die Entstehung von FOMO begünstigen. Daneben ist es auch ein geringes Selbstwertgefühl, das uns glauben lässt, dass das, was wir sind, wissen und können, nicht genug ist.
Und schließlich sorgen auch die toxische Hustle Culture sowie der Selbstoptimierungshype dafür, dass wir glauben, immer produktiv und online sein zu müssen.
Wer ist von FOMO betroffen?
In der öffentlichen Diskussion wird FOMO als ein Phänomen dargestellt, das vor allem Jugendliche und junge Erwachsene betrifft. Allerdings kann FOMO natürlich jeden Menschen treffen – unabhängig von Alter oder Geschlecht. Die Nutzung eines Smartphones, von Social Media und Messengerdiensten scheint FOMO zu begünstigen.
Warum habe ich immer Angst, etwas zu verpassen?
Es gibt viele verschiedene Gründe für FOMO. Am besten ist, sein Verhalten kritisch zu reflektieren und die Trigger zu identifizieren.
Warum ist FOMO so weit verbreitet?
FOMO ist so weit verbreitet, weil es durch Smartphone, Internet, Social Media und Messengerdienste wie WhatsApp begünstigt wird.
Gibt es Studien zu FOMO?
Ja. FOMO wird in der Psychologie bereits eingehend untersucht.
Diese Studie zeigt, dass FOMO zu einem riskanteren Verhalten im Straßenverkehr führen kann.
Diese Studie zeigt unter anderem, dass soziale Medien mit FOMO verknüpft sind.
In dieser Studie wird untersucht, welche Rolle FOMO und Vergleicheritis bei Depressionen spielen.
Dem Zusammenhang von FOMO und mentaler Gesundheit wird auch in dieser Studie nachgegangen.
Fazit: FOMO aka Fear Of Missing Out – it‘s a thing!
Mit den Möglichkeiten des Smartphones, Internets und der sozialen Medien haben immer mehr Menschen Angst, etwas zu verpassen, wenn sie offline gehen.
Dauerpräsenz in den sozialen Netzwerken, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und produktiv zu arbeiten, chronischer Stress und soziale Isolation sind häufige FOMO-Symptome.
Doch es ist möglich, FOMO loszuwerden und eine gesunde Phone-Life-Balance zu etablieren: mit Reflexion, gesunden Gewohnheiten und Präsenz.
„Hilfe, ich brauche eine Social-Media-Pause!“😱
Du brauchst eine Pause von sozialen Medien? In diesem Blogartikel stelle ich dir 21 Möglichkeiten für Social-Media-Pausen vor, wenn dich die sozialen Medien mal wieder überfordern. Von App deinstallieren über Digital Detox bis hin zu „Zeiten ohne Social Media definieren“ sind viele Ideen dabei.
Bevor ich am 21. September 2021 meinen Instagram-Account unwiderruflich löschte, probierte ich eine Meeenge aus, um mit den Anforderungen und Auswirkungen von Social Media umzugehen.
Davon möchte ich dir in diesem Blogartikel erzählen.
Wenn auch du
genug von Social Media hast
deinen Social-Media-Konsum deutlich reduzieren willst
dringend eine Pause von Social Media brauchst (nur in welcher Form?)
oder Social Media endgültig bye bye sagen willst
kommen hier 21 Ideen.
Inhalt
1. Pushbenachrichtigungen deaktivieren
3. Problematischen Accounts entfolgen
9. Social Media nur noch über den Desktop nutzen
10. Handyfreie Zeiten definieren
11. Handyfreie Räume definieren
12. Social-Media-Marketing outsourcen
13. Social-Media-freies Wochenende
14. Social-Media-freier Urlaub
17. Ein Berufshandy
19. Social Media als Messenger nutzen
20. Social-Media-Konto deaktivieren
#1 Push-Benachrichtigungen deaktivieren
Beginnen wir mit den Basics: Wenn du zu denjenigen gehörst, bei denen das Smartphone minütlich oder sekündlich bimmelt und du dich vor lauter Störungen nicht mehr konzentrieren kannst, ist die erste naheliegende Handlung, die Push-Benachrichtigungen zu deaktivieren.
Die Idee dahinter: Wenn dich die ständigen Benachrichtigungen über neue Likes, Kommentare oder DMs stören, schalte sie aus und voilà: Du hast Ruhe und Frieden.
Viele Selbstständige schwören darauf. Bei mir hat das Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen leider keine Erleichterung verschafft, sondern die Situation noch verschärft.
Zwar wurde ich nicht mehr bei meiner Arbeit gestört, ja. Aber da ich nun nicht mehr wusste, ob ich einen neuen Like, Kommentar oder eine neue DM hatte, begann ich etwas, was man nur als „Exzessive Checkeritis“ bezeichnen kann: Ich checkte mein Smartphone. Stündlich, minütlich, sekündlich … und dann checkte ich es erneut.
Irgendwann bestand gefühlt mein halbes Leben aus „Checken“. Nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch abends, am Wochenende und mit der Familie.
Keine schöne Art und Weise, sein Leben zu verbringen.
Dass das Auststellen der Pushbenachrichtigungen kein Allheilmittel ist und zu FOMO und Ängsten führen kann, legt übrigens auch eine Studie nahe.
#2 Smartphone lautlos stellen
Eine Alternative, aber irgendwie auch dasselbe in grün, ist, das Smartphone lautlos zu stellen oder es ganz auszuschalten, während du arbeitest.
Somit wirst du weder von Social-Media-Benachrichtigungen unterbrochen noch von einkommenden E-Mails, Anrufen oder verzweifelten Nachrichten der Bauch-Beine-Po-WhatsApp-Gruppe.
Auch diese Lösung war für mich in der Praxis unbrauchbar. Wer – so wie ich – Kinder in Kindergarten oder Schule hat, muss für Notfälle permanent erreichbar sein und kann sich den Luxus, das Smartphone auszuschalten, leider nicht erlauben.
#3 Problematischen Social-Media-Accounts entfolgen
Wenn dich nur bestimmte Accounts nerven, triggern oder mit der Welt hadern lassen, kannst du die Sache auch selbst in die Hand nehmen und nur noch den Menschen oder Marken folgen, die dein Leben bereichern.
Viele Selbstständige schwören darauf, „sich ihren Feed zu gestalten“. Und vielleicht hast du auch mal Lust, einen „Social-Media-Frühjahrsputz“ zu machen und mal so richtig auszumisten.
Bei mir hat diese Strategie allerdings nicht funktioniert, und zwar aus folgenden Gründen:
Solch eine kontinuierliche Pflege des Accounts braucht Zeit – und das war es mir schlicht und einfach nicht wert. Ich konnte spontan 1327 Dinge aufzählen, die ich lieber machen würde, als mich damit zu beschäftigen, wem ich wo und warum folge oder nicht.
Selbst wenn ich mich nur noch mit Menschen, Marken und Themen umgebe, die ich liebe – an der grundsätzlichen Funktionsweise von Social Media und dem Einfluss auf meine mentale Gesundheit änderte es nichts.
#4 Social-Media-Accounts muten
Wenn du jetzt denkst: „Accounts entfolgen hört sich ja theoretisch gut an, aber ich traue mich nicht, den Menschen zu entfolgen, die ich persönlich kenne.“
I feel you!
Mir ging es ebenfalls häufig so, dass es gerade die Menschen waren, die ich persönlich kannte, deren „Social-Media-Ich“ ich manchmal nicht ertragen konnte.
Zum Glück bieten die meisten Social-Media-Kanäle auch dafür eine Lösung.
Auf Instagram zum Beispiel kannst du Accounts muten („stummschalten“) – vorübergehend oder dauerhaft.
Auf Facebook kannst du deine Freunde 30 Tage „auf Snooze schalten“ oder sogar „nicht mehr folgen“. Damit bleibt ihr offiziell Freunde, aber du siehst die Beiträge dieser Person nicht mehr.
Doch auch hier gilt: Die Pflege und das ständige Nachjustieren der Accounts, denen man folgt, kostet Zeit, Konzentration und Energie. Wenn man sich erst einmal bewusst macht, wie viele Accounts, denen man folgt, einem eigentlich nicht gut tun, ist man gut beschäftigt.
Und ob das Sinn der Sache ist?
#5 Social-Media-Accounts blockieren
Für alle 23-jährigen Tobis, die einem die (Business-)Welt erklären wollen (sorry übrigens, wenn du Tobi heißt – ich mein es nicht so), Trolls, Bots oder andere Menschen, die einen in irgendeiner Weise belästigen, beleidigen oder doofe Nachrichten oder Bilder schicken, wurde die Blockierfunktion erfunden. (Hallelujah!)
Hast du einen Social-Media-Account blockiert, sieht er deine Posts nicht mehr, kann dir nicht mehr folgen, schreiben oder über die Suchfunktion finden.
Da ist also erst einmal Ruhe im Karton. Theoretisch.
Denn meist kommt nach wenigen Stunden leider schon der nächste Tobi um die Ecke, der dringend blockiert werden will. Eine never ending Story und für mich deshalb keine wirklich nachhaltige Lösung, um mit dem Social-Media-Wahnsinn umzugehen.
#6 Allen Social-Media-Accounts entfolgen (Ja, allen!)
Bevor ich im August 2020 meinen Instagram-Account stilllegte, wagte ich ein kleines Experiment: Ich entfolgte allen Accounts, um zu gucken, wen ich überhaupt vermissen würde.
Ob das eine empfehlenswerte Strategie ist?
Sagen wir mal so – es gab gemischte Reaktionen:
Die einen empfanden dieses Experiment als sehr „unsozial“, meinten, dass solch „einseitiges“ Folgen nicht Sinn und Zweck von Social Media sei, und entfolgten mir augenblicklich. (Einer empfahl mir, einen Psychologen aufzusuchen.)
Die anderen feierten das Experiment, meinten, dass sie heimlich auch davon träumen, sich das aber nicht trauen, und nahmen es – so zumindest mein Eindruck – nicht persönlich.
Für mich hat das Experiment eine Menge über mich und mein Verhältnis zu Instagram offenbart:
Es ist erschreckend, wie automatisch ich zum Smartphone greife und Instagram öffne, wenn ich warte oder eigentlich Pause machen will.
Es ist überraschend, wie schnell sich dieser Automatismus wieder legt, wenn ich merke: Da gibt es nichts zu sehen.
Es ist beruhigend, dass ich Instagram nicht vermisse, wenn ich es nicht nutze. So gar nicht.
Es ist herrlich, welche Ruhe im Kopf einkehrt, wenn ich nicht den halben Tag damit verbringe, Content zu konsumieren.
Es ist spannend, nach Jahren mal wieder die eigene Stimme zu hören, weil sie mal nicht durch Meinungen von Expert*innen überlagert wird. (Kann ich allen Selbstständigen nur empfehlen!)
Als ich nach rund einer Woche zu business as usual zurückkehrte und anfing, meinen Lieblingsaccounts wieder zu folgen, wusste ich, dass das ein Fehler war.
Nicht weil ich die Menschen nicht mochte. (Viele mochte ich sogar sehr.) Nicht weil mich ihre Themen nicht interessierten. Es war der „Content-Overload“ und die grundsätzliche Funktionsweise von Social Media, die für mich das Problem waren.
Also hörte ich im Sommer 2020 einfach auf zu posten …
#7 Social-Media-Accounts stilllegen
Die Stilllegung eines Accounts ist eine unverbindliche Möglichkeit zu testen, wie dein Leben und Business ohne Social Media so läuft.
Du kannst es bei deinen Follower*innen ankündigen („Ich nehme mir auf unbestimmte Zeit eine Pause von diesem Kanal. Sich für meinen Newsletter anzumelden, ist jetzt sicherlich nicht die schlechteste Idee.“) oder auch nicht.
Vielleicht merkst du, dass dir deine Kanäle, Menschen und Instastorys mit Heliumstimme furchtbar fehlen. Dann gehst du halt wieder zurück und knüpfst dort an, wo du aufgehört hast.
„Moment, Moment“, denkst du dir jetzt vielleicht, „ich will meine Social-Media-Accounts nicht gleich stilllegen. Ich will nur öfter Social-Media-Pausen einlegen!“
I got you!
Im Folgenden stelle ich einige Möglichkeiten vor, wie du deine Social-Media-Aktivitäten erst einmal reduzierst oder begrenzt, wenn dir danach ist.
#8 Social-Media-App(s) deinstallieren
Folgende Routine hat sich bei mir irgendwann eingebürgert:
Freitagnachmittag werden die Social-Media-Apps deinstalliert. Montagmorgen wieder installiert.
Und dazwischen? Ein herrlich entspanntes Wochenende, in dem ich nicht versucht bin, auf Instagram „nur mal schnell“ nach dem Rechten zu sehen oder eine Story zu posten, obwohl ich eigentlich gerade Zeit mit der Familie verbringe.
Du kannst die App natürlich auch zu allen anderen Anlässen deinstallieren:
Wenn du mal eine Woche konzentriert an einem Projekt arbeiten willst
Im Urlaub
An Weihnachten
Den Aufwand dahinter fand ich übrigens gar nicht schlimm. Nur habe ich mich irgendwann bei dem Gedanken „Oh schade, schon wieder Montag“ ertappt und musste mir eingestehen: Die Apps zu deinstallieren wird mir auf Dauer zu wenig sein.
#9 Social Media nur noch über den Desktop nutzen
Und wenn du schon dabei bist und die Social-Media-Apps deinstalliert hast – vielleicht gefällt dir auch die Möglichkeit, Social Media ausschließlich über den Desktop zu nutzen?
Wenn du sowieso nicht der Typ Mensch bist, der dauernd Storys postet und live geht, könnte es eine Idee sein, die Social-Media-Aktivitäten auf die Arbeitszeit und den Desktop zu beschränken.
Die Facebook-App hatte ich mir eh schon immer sporadisch fürs Live-Gehen installiert (und dann anschließend sofort wieder deinstalliert).
Selbst Instagram-Content kannst du inzwischen im Creator Studio posten, wenn du deinen Instagram-Account mit Facebook verknüpft hast.
Und Liken, Kommentieren und Nachrichten schreiben kannst du über den Desktop natürlich auch.
#10 Smartphone-freie Zeiten definieren
Falls Instagram und Smartphone bei dir so zusammengehören wie Marco und Polo, könntest du überlegen, stattdessen handyfreie Zeiten zu definieren. Zum Beispiel:
Von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens schalte ich mein Handy aus und lege es in eine Schublade.
Die erste Stunde des Tages ist immer handyfrei.
Wenn ich meinen Kindern vorlese, ist das Handy in einem anderen Raum.
Es ist nicht immer leicht, diese Prinzipien durchzusetzen. Denn die Gewohnheit, das Smartphone rauszuholen und Social Media zu checken, ist manchmal übermächtig. Aber Versuch macht bekanntlich kluch.
(Und wenn du dir dafür erst einmal einen Wecker fürs Schlafzimmer kaufen musst, mach es – dein Schlaf wird es dir danken!)
#11 Smartphone-freie Räume definieren
Eine Alternative zu handyfreien Zeiten sind handyfreie Räume oder Zonen: Schlafzimmer, Esstisch, Klo. Es gibt Orte, da kommen wir meist wunderbar ohne Handy aus.
Wirklich.😁
#12 Social-Media-Marketing outsourcen
Ich hab es zweimal versucht und bin zweimal kläglich gescheitert:
Social Media outsourcen war für mich als Einzelunternehmerin theoretisch eine gute Möglichkeit, weniger mit Social Media zu tun haben, ohne meine Accounts gleich zu löschen. Aber in der Praxis fand ich es – trotz eines Überangebots an virtuellen Assistent*innen – gar nicht so leicht.
Herausforderung #1:
Jemanden finden, die sich wirklich mit meinem Thema auskennt und mein Zeugs sinnvoll für Social Media aufbereiten kann. Das mag für einige Themen gut funktionieren. Für mein eher nerdig-nischiges Pinterest-Thema war es damals schwer. Und dabei bin ich wirklich keine kontrollsüchtige Tante, die grundsätzlich nichts aus der Hand geben kann.
Herausforderung #2:
Wer interagiert mit den Reaktionen auf meine Posts? Selbst der besten virtuellen Assistentin der Welt hätte ich es nicht zugetraut, meine Art zu reden, schreiben und unpassende GIFs zu verschicken, zu kopieren. Da hätte ich also wieder ran gemusst.
Ich konnte also beide Herausforderungen nicht für mich lösen und hab daher die Idee, Instagram auszulagern, ad acta gelegt. Doch vielleicht hast du mehr Glück und gibst du dieser Strategie mal eine Chance?
#13 Social-Media-freies Wochenende
Auch wenn du Social Media beruflich brauchst (oder denkst, es unbedingt zu brauchen 😉), das Wochenende grundsätzlich frei von Social Media zu halten kann eine gute Strategie sein, um eine Balance zwischen online und offline zu finden, zum Beispiel:
Unter der Woche nutzt du Social Media.
Am Wochenende machst du Pause.
Ob du das mit purer Willenskraft löst, die App vorsichtshalber deinstallierst (mein Favorit) oder das Handy ausschaltest, bleibt dir überlassen.
#14 Social-Media-freier Urlaub
Zu den gefährlichsten und blödsinnigsten Ratschlägen von Content- und Social-Media-Expert*innen gehören für mich Aussagen wie „Wer sein Business liebt, braucht keine Pause“ oder „Poste ab und zu mal ein Lebensszeichen aus deinem Urlaub, sonst vergessen dich deine Follower noch“.
So. Ein. Bullshit.
Auch wenn du deine Kundschaft sogar mehr liebst als deine*n Partner*in – du hast jederzeit das Recht, kürzere oder längere Social-Media-Pausen einzulegen. Wenn du die sechs Wochen Sommerferien deiner Kinder dazu nutzen willst, ebenfalls mal ein paar Wochen nichts auf Social Media zu tun – so be it. Die richtigen Follower, Leser*innen und Kund*innen bleiben dir treu.
Und du wirst umso entspannter, kraftvoller und motivierter zurückkommen und alle mit deiner Energie umhauen!
#15 Social-Media-Detox
Detox bedeutet „Entgiften“ und soll den Körper reinigen. Schon längst ist dieser Begriff nicht mehr nur für Ernährung reserviert, sondern auch für Social Media.
Die Idee dahinter:
Innerhalb eines bestimmten Zeitraums (einer Woche zum Beispiel) verzichten wir auf Social Media (Social-Media-Detox) oder grundsätzlich auf alles Digitale wie E-Mails, Nachrichten oder Netflix (Digital Detox). Danach haben wir uns „entgiftet“ und fühlen uns wieder frisch und erholt, sodass wir wieder mehr Kraft für den Social-Media-Wahnsinn haben.
Ich persönlich bin nicht so gut auf einen „Detox“ zu sprechen:
Der Effekt ist meiner Erfahrung nach maximal kurzfristig. Sobald ich mich wieder in Social Media einloggte, waren auch die alten, ungesunden Gewohnheiten wieder da. (Vielleicht sogar inklusive „Jo-Jo-Effekt“!)
Wer sich ständig „entgiften“ muss und von Social-Media-Detox zu Social-Media-Detox hangelt, sollte sich überlegen, warum sie*er die restliche Zeit sich einem „Gift“ aussetzt, was ihr*ihm so offensichtlich schadet. (Eine Tatsache, die ich viel zu lange nicht wahrhaben wollte.)
Ein Detox kann also eine sinnvolle erste Notfall-Maßnahme sein, wenn Social Media akut überfordert – idealerweise aber auch der Ausgangspunkt für eine grundlegende Änderung der Social-Media-Gewohnheiten.
#16 Social-Media-Sabbatical
Manche geben sich nicht nur mit einem Social-Media-freien Wochenende oder Urlaub zufrieden, sondern planen, gleich mehrere Monate oder ein Jahr auf Social Media zu verzichten. Analog zu einer beruflichen Auszeit könnte man eine längere Social-Media-Pause als ein Sabbatical bezeichnen.
Mir begegnet diese Strategie manchmal bei Autor*innen, die sich in dieser Zeit zum Beispiel bewusst aufs Schreiben fokussieren möchten.
Du kannst es – wie bei einer kürzeren Pause – deinen Follower*innen ankündigen oder es sein lassen und mal gucken, wer dich so vermisst.
#17 Ein Berufshandy
Seit der Erfindung des Smartphones ist es schwieriger geworden, zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden. Vor allem, wenn es um Social Media geht.
Ist es noch Arbeit, wenn ich einer Kollegin, die ich mag, eine DM schreibe? Oder ist das schon Freizeit?
Ist es Freizeit, wenn ich mir einige Storys von Accounts, die ich mag, angucke? Oder ist es Arbeit, weil die Accounts potenzielle Kund*innen sind?
Ich habe für mich irgendwann beschlossen, Social Media grundsätzlich als Arbeit zu betrachten – und es auch so zu behandeln. Also habe ich mir im September 2020 ein altes Nokia-Handy als Notfallhandy zugelegt.
Die Idee dahinter: Ich behandle mein Smartphone als ein Berufshandy. Wenn ich Pausen von der Online-Welt brauche, schalte ich mein Smartphone mit dem Zugang zu Social Media und Internet aus. Die wichtigsten Menschen bekommen die Nummer von meinem Nokia-Handy, mit dem ich außer telefonieren und SMS schreiben eh nichts machen kann.
Klang in der Theorie ganz gut. Hat in der Praxis aber nicht funktioniert. Denn so ein olles Nokia-Handy ist ganz schön umständlich und ungewohnt, wenn man ein iPhone gewöhnt ist (#FirstWorldProblems). Und irgendwie war es nie aufgeladen, wenn ich es gebraucht habe.
Doch vielleicht hast du ja irgendwo ein schickes Vorgängermodell liegen, das du als Berufs- oder Notfallhandy verwenden kannst?
#18 Nur noch Ads schalten
Falls dich organisches Social-Media-Marketing anstrengt, du aber kein grundsätzliches Problem mit Social Media hast, kannst du phasenweise auch einfach Werbeanzeigen schalten.
Somit entfällt der Druck, täglich posten und interagieren zu müssen, aber du bist immer noch einigermaßen präsent bei deinen Follower*innen und kannst neue Menschen erreichen.
(Update: Ich selbst nutze keine Social-Media-Ads mehr 👉 aus diesen Gründen.)
#19 Social Media als Messenger nutzen
Als ich im Sommer 2020 meine Social-Media-Accounts stilllegte und nichts mehr postete, schrieben mich immer noch Menschen über meine Social-Media-Kanäle an.
Sie stellten mir Fragen zu Pinterest oder zu meinen Angeboten oder wollten nur mal Hallo sagen. Für eine Zeit war das auch völlig okay so für mich:
Da ich sowieso niemandem folgte, war mein Feed leer, wenn ich mich in Instagram einloggte.
Da ich die App schon lange von meinem Handy deinstalliert hatte, öffnete ich Instagram ausschließlich während meiner Arbeitszeit am Desktop.
Allerdings merkte ich irgendwann: Obwohl ich gedanklich mit Instagram „durch“ war, nahm die Plattform immer noch Platz in meinem Kopf ein. („Du musst heute noch bei Insta gucken, ob du neue Nachrichten bekommen hast.“)
Daher entschied ich mich im August 2021, mein Instagram-Konto vorläufig zu deaktivieren und damit auch die Messenger-Funktion auf Instagram nicht mehr zu nutzen.
#20 Social-Media-Konto deaktivieren
Bevor du ein Social-Media-Konto unwiderruflich löschst (ich weiß, welch großer, schwieriger Schritt das sein kann!), kannst du dein Konto auch erst einmal „nur“ deaktivieren.
Damit ist dein Konto nicht mehr sichtbar, aber alle deine Fotos, Likes, Nachrichten und Kommentare bleiben dir erhalten.
Solltest du es dir anders überlegen, loggst du dich einfach wieder in dein Konto ein und voilà: Dein Konto wird wiederhergestellt.
#21 Social-Media-Konto löschen
Wir sind am Ende angelangt. Denn wenn all die Social-Media-Pausen, die Social-Media-freien Wochenende, Urlaube, Zeiten und Räume nichts bringen, stehst du vielleicht vor der Frage, ob du deine Social-Media-Kanäle nicht ganz löschst.
Für mich haben letzten Endes unter anderem folgende Faktoren den Ausschlag gegeben:
meine mentale Gesundheit: Ich wusste, dass ich als introvertierter, hochsensibler Mensch mir mit Social Media massiv schade und langfristig krank werde …
meine Freude: Diese ist mir mit Social Media völlig abhanden gekommen, denn es ist ätzend, sich tagaus, tagein mit Aufgaben busy zu halten, die einen nicht erfüllen.
meine anderen Strategien: Mit meinem Blog, Newsletter und Netzwerk hatte ich genügend andere Möglichkeiten, online gefunden zu werden, Reichweite zu generieren und zu verkaufen. Ein Blick in Google Analytics hat mir gezeigt, wie wenige Menschen durch Insta oder Facebook eigentlich zu mir auf die Website finden.
die Rebellin in mir: Ohne ein bisschen Mut ging es nicht. Denn wenn dir 99% aller Menschen eintrichtern, dass du unbedingt Social Media brauchst, wenn du selbstständig bist, ist es gar nicht so leicht zu sagen: „Scheiß drauf! Ich mach es trotzdem und finde schon meinen Weg.“
Deshalb ist mein Instagram-Konto seit dem 21. September offiziell gelöscht.
Hast du entschieden, dein Instagram-Konto erst einmal zu deaktivieren oder endgültig zu löschen? Hier habe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt.
Fazit: Es gibt eine Menge Möglichkeiten für eine Pause von Social Media
In diesem Blogartikel habe ich dir 21 Ideen bei akuter oder grundsätzlicher Social-Media-Überforderung vorgestellt:
Push-Benachrichtigungen deaktivieren
Smartphone lautlos stellen
Problematischen Accounts entfolgen
Accounts muten
Accounts blockieren
Allen Accounts entfolgen
Account stilllegen
App(s) deinstallieren
Social Media nur noch über den Desktop nutzen
Handyfreie Zeiten definieren
Handyfreie Räume definieren
Social Media outsourcen
Social-Media-freies Wochenende
Social-Media-freier Urlaub
Social-Media-Detox
Social-Media-Sabbatical
Ein Berufshandy
Nur noch Ads schalten
Social Media als Messenger nutzen
Social-Media-Konto deaktivieren
Social-Media-Konto löschen
Ich hoffe, es war etwas für dich dabei.
Die häufigsten Fragen zum Thema „Pause von Social Media“
Wie lange sollte man eine Social-Media-Pause einlegen?
Ob ein Tag, ein Wochenende, ein Monat oder für immer – das bestimmst natürlich ganz alleine du!
Aus Erfahrung kann ich dir sagen: Die ersten Tage (wenn nicht gar Wochen) ohne Social Media sind schwierig. Und man verbringt noch viel Zeit damit, automatisch zum Handy zu greifen und nach den Apps zu suchen. Wenn dann aber auch das Hirn verstanden hat, dass da nichts mehr auf dem Handy ist, das sich zum Öffnen lohnt, wird es leichter und erholsam.
Ist ein Leben ohne Social Media überhaupt möglich?
Ein Leben ohne Social Media ist definitiv möglich und ich würde sagen: auch sehr erstrebenswert.😊
Wenn du selbstständig bist, ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel sehr groß, dass du eine Menge Zeit mit nicht nachhaltigen Social-Media-Aufgaben verplemperst und die wirklich wichtigen Aufgaben möglicherweise prokrastinierst.
Und was die private Nutzung angeht: Wie viele „echte“ Menschen kennst du auf Social Media wirklich? Und wie viele davon magst du überhaupt? Mit unseren Lieblingsmenschen halten wir ja sowieso oft auf anderen Wegen Kontakt, sodass wir, wenn wir ehrlich sind, oft gar nicht auf Social Media angewiesen sind.
Ist man ohne Social Media glücklicher?
Welchen Einfluss Social Media auf deine mentale Gesundheit hat, weißt natürlich du am besten. Ich persönlich bin ohne Social Media definitiv zufriedener, ausgeglichener, ruhiger, konzentrierter, produktiver, fokussierter und deshalb, ja: definitiv glücklicher.
Was passiert, wenn man auf Social Media verzichtet?
Die ersten Tage sind hart. Möglicherweise kommt es bei der Social-Media-Pause sogar zu Entzugserscheinungen oder Ersatzhandlungen wie Online-Shopping (schüttet auch Dopamin aus) oder erhöhtem Nachrichtenkonsum (ist auch ein niemals endender Feed). Auf jeden Fall brauchst du also einige Zeit, um sich an deinen Alltag ohne Social Media zu gewöhnen und nicht mehr alle paar Minuten nach deinem Handy zu greifen.
Danach passiert aber die Magie: Ohne Social Media hast du zum Beispiel statistisch 84 Minuten täglich mehr Zeit und kannst spannende berufliche Projekte, die du bisher immer auf später verschoben hast, endlich realisieren, ein neues Musikinstrument lernen oder auch einfach nur einen ausgedehnten Mittagsschlaf halten. (I don’t judge.) Auch zwischenmenschliche Beziehungen sind schöner, wenn man nicht ständig durch „Plings“ und „Plongs“ unterbrochen wird und sich öfter in die Augen guckt als aufs Smartphone.😉
Wie lange nutzen Menschen Social Media durchschnittlich am Tag?
Laut Statista verbringen Menschen in Deutschland durchschnittlich 84 Minuten mit Social Media. (Wobei die Dunkelziffer da sicherlich höher ist, wenn du mich fragst. Vor allem, wenn du als Selbstständige*r Social Media auch noch beruflich nutzt.)
Spitzenreiter sind die Philippinen mit unfassbaren 255 Minuten täglich.
Hier findest du die aktuelle Nutzungsdauer von Social Media weltweit im Jahr 2023.
Wie viel Social Media am Tag ist gesund?
Da gibt es inzwischen eine Menge Studien dazu. Klar ist: Wer weniger Social Media nutzt, hat statistisch auch weniger mit Depressionen, Einsamkeit und Ängsten zu kämpfen.
Diese Studie legt zum Beispiel nahe, dass die Reduzierung von Social Media auf 30 Minuten täglich, bereits positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat.
Aktuell sorgen übrigens die Facebook Files für Aufsehen. Frances Haugen hat öffentlich gemacht, dass Facebook genau weiß, dass Instagram insbesondere jungen Mädchen und Frauen schadet, aber nichts dagegen unternimmt.
Keine sozialen Medien mehr: Mein Plädoyer für eine entspannte Selbstständigkeit ohne Insta & Co.
Keine Social Media nutzen als Selbstständige? Kein Problem! Doch dafür müssen wir über Bord werfen, was wir über Social Media und die Selbstständigkeit denken, und uns erlauben, auf unsere Stärken zu vertrauen.
Hier ist eine Liste von Dingen, die ich nicht glaube:
Dass ich Social Media nutzen muss, wenn ich selbstständig bin.
Dass ich ohne Social Media keine Kund*innen finde.
Dass ich mich nicht so anstellen und halt zusammenreißen muss, wenn mir Instagram und Co. keinen Spaß machen.
Dass ich jeden Tag online sein muss, damit ich erfolgreich bin.
Dass ich etwas verpasse, wenn ich nicht auf Instagram bin.
Dass etwas mit mir nicht stimmt, wenn mir Social-Media-Marketing keinen Spaß macht.
Dass mehr immer besser ist.
Dass ich keine Pausen brauche, wenn ich „mein Business liebe“.
Dass ich allen Social-Media-Trends folgen muss, wenn ich selbstständig bin.
Dass ich im Zweifel immer auf Ratschläge von Expert*innen hören muss, statt meinem Bauchgefühl zu vertrauen.
Ich erkläre diese Glaubenssätze hiermit für ausgedient. Für beendet. Sie haben keine Funktion mehr.
Sie machen uns müde, unglücklich und krank.
Sie helfen uns nicht dabei, unsere Selbstständigkeit nach unseren Vorstellungen zu gestalten, im Gegenteil: Sie halten uns davon ab, unser wahres Potenzial zu entfalten.
Stattdessen schlage ich folgende Glaubenssätze vor:
Dass soziale Medien nur eine Option für Selbstständige sind und keine Pflicht.
Dass soziale Medien nur eine von unzähligen Möglichkeiten sind, Kund*innen zu finden.
Dass ich in meiner Selbstständigkeit der Freude folgen darf.
Dass Offline-Zeiten für alle Menschen, also auch für Selbstständige, wichtig sind.
Dass ich nichts Wichtiges verpasse, wenn ich eine Plattform nicht nutze, die mir keine Freude bereitet.
Dass mit mir alles in Ordnung ist, wenn ich Social Media doof finde und sie für meine Selbstständigkeit nicht nutzen möchte.
Dass Qualität wichtiger ist als Quantität.
Dass Pausen mich nicht von wichtigen Aufgaben abhalten, sondern dass sie die wichtigste Aufgabe sind.
Dass ich Social-Media-Trends ausprobieren kann, wenn sie sich spannend anhören, mich meine Selbstständigkeit dazu aber nicht verpflichtet.
Dass ich meinen Stärken, meinen Fähigkeiten und meinem Bauchgefühl vertrauen und im Zweifel auf Ratschläge von Expert*innen pfeifen darf.
Kurz:
Dass ich mir endlich die Erlaubnis geben darf, meine Selbstständigkeit nach meinen eigenen Regeln zu gestalten.
Das muss sich dafür verändern:
Von „fremdgesteuert“ zu „selbstbestimmt“
Es wird Zeit, dass wir wieder die Entscheidungsfreiheit und Verantwortung für unser privates und berufliches Leben übernehmen und sagen:
„Dieser Social-Media-Kanal passt nicht zu mir und meinem Leben.“
Haben wir uns denn nicht selbstständig gemacht, um selbstbestimmt zu arbeiten? Um keinen blöden Chef zu haben, der uns andauernd sagt, was wir zu tun haben? Um unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten?
Stattdessen haben wir uns ein neues Hamsterrad geschaffen – das Social-Media-Hamsterrad – bei dem unseren Arbeitsalltag danach ausrichten, was Algorithmen von uns wollen.
Was wir posten. Wie oft. Wann. In welchem Format.
Doch was ist das überhaupt für eine seltsame Vorstellung, dass wir unser Leben nach den Anforderungen von Algorithmen ausrichten und nicht umgekehrt?
Dass wir um acht Uhr abends alles stehen und liegen lassen, weil das laut Analytics nun mal die beste Zeit zum Posten ist?
Dass wir unseren Feierabend unterbrechen (oder uns überhaupt keinen Feierabend gönnen), weil wir wollen, dass unser Post die beste Aussicht auf Erfolg hat?
Dass wir zu unseren Kindern, Partnern oder Freundinnen sagen „Warte mal kurz, ich muss das mal schnell bei Instagram posten“, statt den Tag gemütlich mit ihnen ausklingen zu lassen?
Viel zu lange schon haben wir nach den Regeln von Social-Media-Plattformen gespielt. Haben sie brav befolgt, auch wenn sie uns genervt oder gar unglücklich gemacht haben. Haben uns öfter nach Algorithmen gerichtet als nach unseren Bedürfnissen.
Wie wäre es deshalb, wenn wir die Frage „Wann muss ich was posten, um möglichst viele Menschen zu erreichen?“ ersatzlos streichen und uns stattdessen lieber fragen:
Passt der Social-Media-Kanal eigentlich zu mir?
Passt er zu meiner Persönlichkeit?
Passt er zu meinen Stärken?
Passt er zu meiner familiären Situation?
Passt er zu meinen Werten?
Passt er zu meinem Leben?
Es ist kein Drama und erst recht keine Schande, sich einzugestehen, dass ein bestimmter Social-Media-Kanal (oder Social Media im Allgemeinen) keinen Platz in einem Leben hat.
Von „Blind Expert*innen-Ratschlägen folgen“ zu „Sich an den eigenen Stärken orientieren“
Es wird Zeit, dass wir uns selbst wieder mehr vertrauen als Menschen, die wir nur aus dem Internet kennen.
Was ist das überhaupt für ein Gedanke, dass jemand, der mich noch nie getroffen hat, besser einschätzen kann, was ich brauche und was ich machen sollte, als ich?
Dass die Frage nach meinen Stärken, Interessen und Wünschen nicht so wichtig ist wie die Frage, was eine Plattform von mir erwartet?
Dass ich mich jeden Tag aufs Neue mit einer verstörenden Selbstverständlichkeit zu Aufgaben zwinge, die mir nicht nur keine Freude machen, sondern langfristig auch krank?
Dabei kann Marketing doch auch ganz einfach sein:
Wenn du schreiben willst, dann schreibe – Blogartikel, Newsletter, Bücher.
Wenn du fotografieren willst, dann fotografiere. (Und poste Bilder, wenn dir danach ist.)
Wenn du gerne mit Menschen redest, dann interviewe sie. (Und starte einen Podcast, wenn du magst.)
Wenn du es liebst, Videos zu erstellen, dann erstelle Videos. (Und starte einen YouTube-Kanal, wenn du Bock darauf hast.)
Mach die Dinge, weil du sie liebst und gut kannst – und nicht, weil dir jemand auf Instagram eingeredet hat, dass du sie unbedingt machen musst, um erfolgreich zu sein.
Statt „Welche Plattform muss ich wie nutzen, um viele Menschen zu erreichen?“ schlage ich dir deshalb folgende Fragen vor:
Worin bin ich richtig gut?
Was macht mir Spaß?
Womit könnte ich den ganzen Tag verbringen?
Was ist mir wichtig?
Welche Werte vertrete ich?
Wie soll mein Tag aussehen?
Will ich dieses System wirklich unterstützen?
Verbinde dich zuallererst mit deinen Stärken und Wünschen und suche dir danach die passende Marketingplattform aus. Nicht umgekehrt.
Von „FOMO“ zu „JOMO“
Es wird Zeit, dass wir endlich Gefallen daran finden, Dinge auf Social Media zu verpassen.
Noch viel zu viele Selbstständige haben FOMO („Fear of Missing out“) und denken, dass ihnen etwas Wichtiges entgeht, wenn sie ihre Social-Media-Kanäle löschen.
Dass sie wichtige Informationen verpassen. Von Kolleg*innen vergessen werden. Keine Kundschaft mehr finden.
(Spoiler-Alert: All diese Dinge kannst du auch ganz entspannt ohne Social Media erreichen. Doch dazu an anderer Stelle mehr.)
Hier empfehle ich dir von Herzen JOMO („Joy of Missing Out“) oder zu deutsch: die heilende Kraft von „Scheiß drauf“.
Lass mich dir das mal anhand von Elternabenden illustrieren:
Dreißig gestresste Erwachsene, die einen zu langen Arbeitstag hinter sich, aber keine Zeit mehr für ein vernünftiges Abendessen hatten, sich nicht an den letzten freien Abend erinnern können und nun zusammengepfercht auf zu kleinen Stühlen oder (wenn sie Glück haben) auf dem Boden um eine bronzefarbene Klangschale versammelt sitzen und sich über solch unbrisanten Themen wie Erziehung oder das richtige Essen für Kinder unterhalten – what could possibly go wrong? Seit ich es mir erlaubt habe, Elternabende auf ein Minimum zu reduzieren, ist mein Leben um einiges leichter, entspannter und glücklicher geworden.
Denn erstens: Es fühlt sich einfach grandios an, einen seichten Schnulzroman zu lesen und zu wissen, dass überambitionierte Eltern gerade „Apocalypse Now“ nachspielen.
Und zweitens: Alles, was auf dem Elternabend besprochen wird, flattert sowieso als Protokoll direkt in meinen Posteingang. Und die Kirsche auf der Sahnehaube: Die aufgestauten und abgeladenen Emotionen, unhaltbare Anschuldigungen und unreflektierte Seitenhiebe auf Veganer, die aus irgendeinem unerklärlichen Grund auch auf Elternabenden ihren Platz finden, werden zuverlässig rausgefiltert.
Das nenne ich mal Joy of Missing out!
So ähnlich kann es auch mit Social Media der Fall sein, wenn du es dir erlaubst.
Denn wenn du dir einmal bewusst machst, was du da eigentlich verpasst, wird es auf einmal sehr verlockend, Social Media bye bye zu sagen:
Trolls, Bots und Spammer
DMs von 23-jährigen Tobis, die dir die Welt erklären
Fake News und Hatespeech
Dieser Druck, ständig posten zu müssen
Dieser Druck, in Storys nicht allzu verwahrlost auszusehen
Immer diese Frage beim Frühstück: Soll ich das jetzt posten?
Diese Vergleicheritis
Redaktionspläne (<-- hate them!)
Social-Media-Trends (Sie kommen und gehen. Und kommen und gehen. Ist irgendwie immer wieder dasselbe.)
Nach einem Jahr ohne Social Media ist bei mir 0,0% FOMO und 100% JOMO da, wenn ich an Social Media denke. Und glaube mir: Dieses herrliche Gefühl kannst du auch haben!
Von „Abkürzungen“ zu „eigenen Weg gehen“
Es wird Zeit, dass wir uns davon verabschieden, dass wir immer eine Abkürzung brauchen, um erfolgreich zu sein.
Dass es irgendwo da draußen einen Quick Fix gibt. Ein Geheimrezept. Eine Erfolgsgarantie. Die Autobahn zum Glück.
Soziale Medien kommen mit dem Versprechen, dass alles möglich ist – und dass es schnell gehen kann.
Reichweite.
Follower*innen.
Kund*innen.
Geld.
Erfolg.
Wir müssen „nur“ posten.
„Nur“ täglich aktiv sein.
„Nur“ liken, teilen, kommentieren – und die Welt gehört uns.
Wir könnten jederzeit viral gehen, und die „Erfolgreich über Nacht“-Geschichten einiger weniger hören sich so verlockend an, dass wir völlig vergessen, dass wir auch einfach unseren eigenen Weg gehen könnten. Den mit Umwegen und unbetretenen Pfaden, die erst noch erkundet werden müssen.
Dieser Weg mag länger, manchmal anstrengender sein. Aber was, wenn das der schönere Weg ist? Der nachhaltigere? Der entspanntere? Weil dieser Weg zu uns gehört.
Daran glaube ich ganz fest:
Schnelligkeit und Abkürzungen sind überbewertet.
Ich darf mich für die längere Business-Reise entscheiden und jeden Schritt zelebrieren.
Ich darf so viele Pausen einlegen, wie ich will, und die Aussicht genießen.
Ich darf auch mal umkehren, wenn ich merke, dass ich mich verlaufen habe.
Mein eigener Weg ist der nachhaltigere, weil das der Weg ist, bei dem ich am besten in Kontakt mit mir und meinen Werten bleibe.
Ich darf auch unbetretene Pfade gehen – sie führen oft zu traumhaft schönen Zielen.
Ich muss nicht immer wachsen und darf auch mal nur sein. (Da. Müde. Traurig.)
Vom „ergebnisorientierter“ zur „prozess- und werteorientierter“ Selbstständigkeit
Es wird Zeit, dass wir endlich aufhören, willkürlichen, bedeutungslosen Metriken nachzujagen, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt.
Hier sind fünf Dinge, die ich höchstwahrscheinlich nicht auf meinem Sterbebett sagen werde:
Hätte ich doch mehr Follower*innen gehabt – dann wäre alles anders gekommen.
Hätte ich meine Interaktionsrate doch um 1,6 Prozent gesteigert – dann hätte ich mich richtig glücklich gefühlt.
Hätte ich doch nicht zweimal, sondern fünfmal pro Woche gepostet – das hätte mein Leben richtig bereichert.
Hätte ich doch konsequenter auf jeden Kommentar unter meinen Posts geantwortet – davon hätte ich später noch meinen Enkeln erzählen können.
Hätte ich doch schneller auf DMs reagiert – dann hätten das meine Kinder jetzt auf meinen Grabstein schreiben können.
Falls der etwas plakative, makabre Exkurs noch nicht drastisch genug war, hier nochmal in aller Deutlichkeit:
Social-Media-Metriken machen nicht glücklich.
Sie verleihen unserem Leben keinen Sinn.
Sie machen uns nicht zu zufriedeneren Menschen.
Es ist eine typische Lose-lose-Situation: Erreichst du dein Ziel nicht, fühlst du dich mies. (Warum schaffe ich es nicht, mehr Follower*innen auf Instagram zu gewinnen?) Erreichst du dein Ziel, muss augenblicklich ein neues, größeres Ziel her (noch mehr Follower).
Und so verbringen wir Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr damit, immer höheren Zielen nachzujagen. Uns Sorgen zu machen, ob wir sie tatsächlich erreichen. Uns nie damit zufrieden zu geben, was wir bereits haben. Doch wie lange soll das so weitergehen?
Wann haben wir endlich genug Follower*innen, Likes und Kommentare? Wann dürfen wir auch mal ruhen, präsent sein, genießen?
Dabei kannst du dich als Selbstständige auch an anderen Maßstäben orientieren als an Metriken. An Prozessen zum Beispiel. Und an Werten.
Statt Wie kann ich diesen Monat 1000 neue Follower*innen gewinnen? kannst du dir auch folgende Fragen stellen:
Wie möchte ich meinen Arbeitstag verbringen? (Hauptsächlich mit Aufgaben, die mich erfüllen? Oder mit Aufgaben, zu denen ich mich jeden Tag aufs Neue zwingen muss?)
Welche Gefühle möchte ich fühlen? (Spaß und Freude oder Stress und Lustlosigkeit?)
Warum will ich etwas tun? (Weil ich intrinsisch motiviert bin oder weil ich glaube, es tun zu müssen?)
Bin ich mit mir im Reinen, wenn ich das so mache? (Passt das zu meinen Werten oder verdränge ich hier, was mir wichtig ist?)
Von „vielen Kontakten“ zu „bedeutungsvollen Kontakten“
Es wird Zeit, dass wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir Social Media brauchen, um „social“ zu sein.
Social Media ist wie die überlaufene Hochzeitsfeier deiner Cousine dritten Grades. Mehrere hundert Menschen sind eingeladen, doch die meisten davon hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Einige Gäste nerven gewaltig. Hier und da zwingst du dich zu höflichem Smalltalk über die schöne Braut. Aber den meisten Spaß hast du mit Onkel Udo an der Bar, wo ihr zwei Stunden damit verbringt, nerdige Theorien über den Terminator auszutauschen.
Hier ist eine Liste von Dingen, auf die ich keine Lust mehr habe:
Smalltalk
oberflächliche Kommentare
Liken (<-- hate it)
um Aufmerksamkeit kämpfen
Herzchen verschicken nach einer Story
„OMG“, „Wie cool ist das denn?!“ oder andere Bemerkungen, die verraten, dass ich gerade absolut keine Lust habe, mir einen sinnvollen Kommentar zu überlegen
Diese Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist seltsam und führt in 99,9% der Fälle nicht zu bedeutungsvollen Beziehungen. Oder hast du schon irgendwann einmal gedacht:
„Sie hat immer zuverlässig meine Posts geliket – deshalb wurden wir beste Freundinnen.“
Hier ist eine Liste von Dingen, die wir als Selbstständige stattdessen machen können:
spontane (virtuelle) Kaffee-Dates mit Kolleg*innen
regelmäßigen, fachlichen Austausch
Offline-Treffen von Lieblingskund*innen
Kooperationen mit Lieblingskolleg*innen
Telefonieren (wenn du es magst)
Fragen wie „Wie geht es dir gerade wirklich? Was beschäftigt dich zur Zeit?“
begeisterte E-Mails an jemanden, dessen Blog oder Podcast du liebst
Diese Kontakte und Gespräche sind es, die unser Leben schöner machen und uns in der Selbstständigkeit vorwärts bringen. Nicht das fünfundzwanzigste Herzchen für Fremde im Internet.
Von „niemals frei“ zu „richtigen Pausen“
Es wird Zeit, dass wir es uns wieder erlauben, „richtige“ Pausen zu machen, anstatt „Fake-Pausen“ mit Social Media.
Hier ist eine Liste von Dingen, die Arbeit sind (auch wenn es sich manchmal gar nicht so anfühlt):
„nur mal schnell“ was posten
„nur mal schnell“ eine Story machen
„nur mal schnell“ die Likes checken
„nur mal schnell“ auf die Kommentare eingehen
„nur mal schnell“ die DMs beantworten
„nur mal schnell“ in die FB-Gruppe gucken
Wenn man die vielen kleinen „Nur mal Schnell“s addiert, ist die Summe ein Leben, das langfristig auslaugt.
Denn wir erledigen diese Aufgaben meist dann, wenn wir uns eigentlich ausruhen und neue Kraft schöpfen sollten: zwischen zwei Terminen, auf dem Klo, abends oder gar nachts, am Wochenende, im Urlaub.
Wir „belohnen“ uns mit Social Media, prokrastinieren mit Social Media, „schalten ab“ mit Social Media, „entspannen“ mit Social Media – und merken nicht, wie wir eigentlich noch mehr arbeiten und niemals wirklich frei haben.
Hier ist eine Liste von Dingen, die wir Selbstständigen stattdessen machen können, um kleine Pausen von unserer Arbeit einzulegen.
Fenster auf, Luft rein, atmen
Spaziergang an der frischen Luft
Yoga (auch wenn es mal nur Shavasana ist)
Musik hören, eine Runde tanzen
Ukulele spielen und dazu singen (auch wenn es schief ist)
Frisches Gemüse schnibbeln und – ohne Smartphone in der Hand – knabbern
ein Mittagsdöschen
den Bauch vom Hund kraulen
Tee trinken und in die Luft gucken
…
(Hier sind noch mehr Ideen für Pausen ohne Social Media und Smartphone.)
Egal, ob du Social Media „nur“ reduzieren oder völlig Lebewohl sagen willst – du verdienst „richtige“ Pausen.
Und zwar jeden einzelnen Tag.

Themenwünsche?
Wenn dir ein wichtiges Thema im Blog fehlt, sag mir gerne Bescheid. Ich freue ich mich auf deine Nachricht.