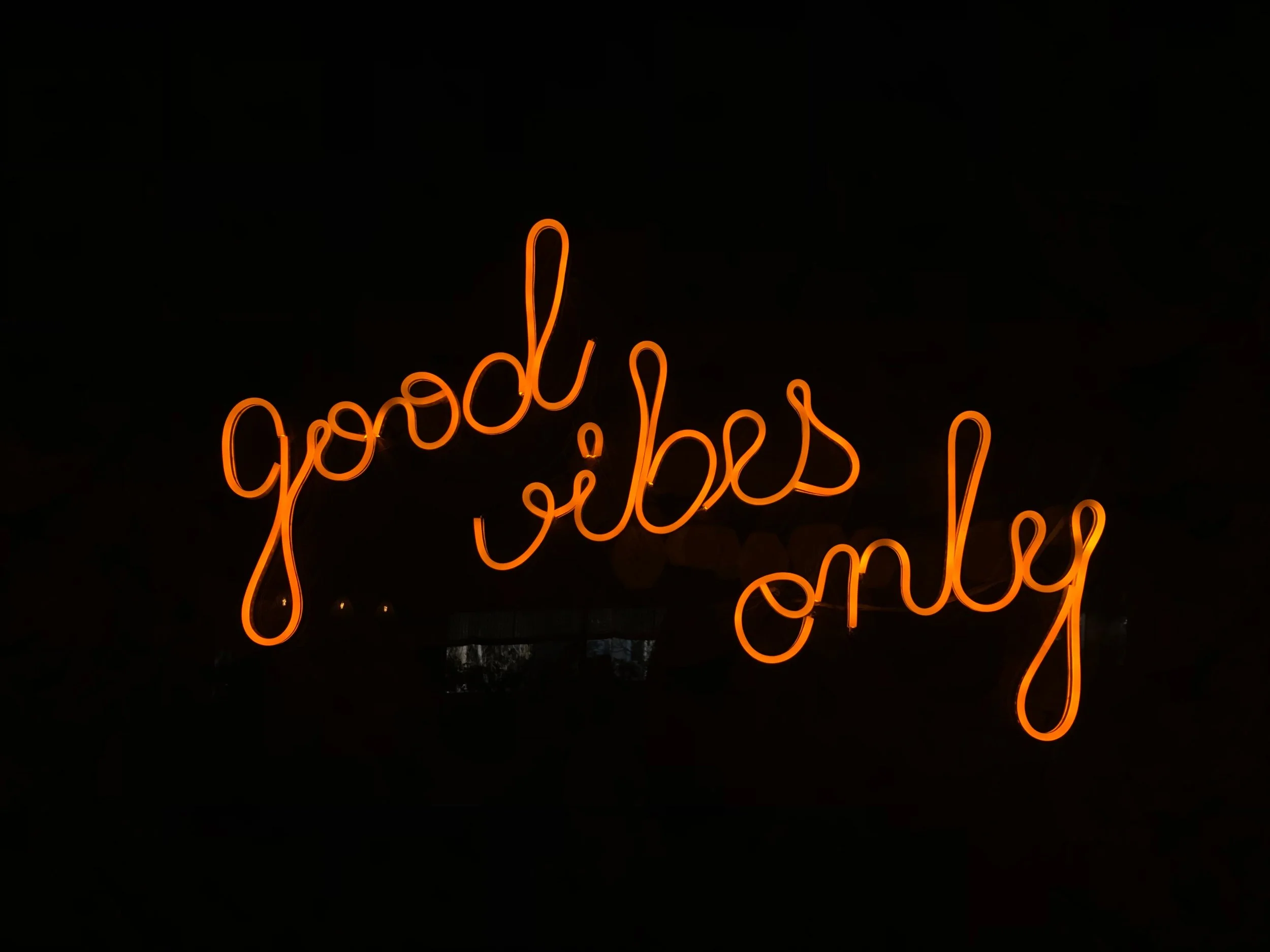Blog
Hier dreht sich alles um wertebasiertes Marketing ohne Social Media, Psychotricks und das übliche Marketing-Blabla.
Was Emotionsarbeit mit unserer Selbstständigkeit zu tun hat
Was ist Emotionsarbeit, was hat das mit Selbstständigkeit, Social Media und Dienstleistungen zu tun und wie können wir mit den Auswirkungen und Herausforderungen von Emotionsarbeit zurechtkommen?
Hast du schon einmal locker, flockig in die Kamera für eine Instastory gesprochen und so getan, als wärst du bester Laune, obwohl dir gerade eigentlich eher nach Heulen zumute war?
Warst du schon einmal freundlich zu einem Kunden, obwohl du ihn aufgrund seiner problematischen Aussagen am liebsten zum Mond geschossen hättest?
Hast du auch schon mal eine Kollegin angelächelt, obwohl dir gerade gar nicht nach lächeln war?
Wenn du diese oder ähnliche Situationen schon einmal erlebt hast, dann hast du bereits Bekanntschaft mit Emotionsarbeit gemacht.
Was Emotionsarbeit ist, was es mit der Selbstständigkeit und Social Media zu tun hat und warum es so wichtig für Selbstständige ist, sich der geleisteten Emotionsarbeit bewusst zu werden, möchte ich in diesem Blogartikel zeigen.
Was ist Emotionsarbeit?
Emotionsarbeit ist ein Konzept, das in der Soziologie und Psychologie eine immer größere Bedeutung erlangt. Im Kern geht es um die Anstrengungen, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, auszudrücken oder zu modifizieren, um sozialen Erwartungen gerecht zu werden.
Emotionsarbeit tritt in verschiedenen Bereichen des Lebens auf: auf der Arbeit, in der Partnerschaft, in der Eltern-Kind-Beziehung oder auf Social Media.
Emotionsarbeit als Selbstständige
Gerade in Dienstleistungs- und Serviceberufen haben Selbstständige häufigen Kontakt zu anderen Menschen. Per E-Mail, in Zoom, auf Social Media oder persönlich. Und natürlich geht diese Arbeit mit verschiedensten emotionalen Zuständen einher:
Manchmal geht es uns gerade nicht gut. (Wir fühlen uns traurig, wütend, gestresst, leer oder irgendwas dazwischen.)
Manchmal geht es unserem Gegenüber nicht gut (Er fühlt sich traurig, wütend, gestresst, leer oder irgendwas dazwischen.).
Doch egal, wie es uns oder unserem Interaktionspartner geht – die meisten Selbstständigen bemühen sich in solchen Situationen, professionell zu bleiben und das heißt: freundlich, empathisch, zurückhaltend.
Und so haben wir selbst in Zeiten größter persönlicher Herausforderungen ein Lächeln für unsere Kund*innen übrig. Oder bleiben ruhig, selbst wenn es – angesichts eines doofen Spruchs – innerlich in uns tobt.
Emotionsarbeit auf Social Media
Auch auf Social Media findet Emotionsarbeit statt.
Jemand findet in einem Kommentar nicht gerade nette Worte für uns – wir schlucken’s runter und versprühen weiterhin „Good Vibes“.
Und auch der Druck, ständig glücklich, erfolgreich und positiv zu erscheinen, führt zu einer verstärkten Emotionsarbeit, denn – surprise, surprise – wir sind nicht jeden Tag glücklich, erfolgreich und positiv.
Es gibt viele weitere Formen emotionaler Arbeit auf Social Media:
Vergleich: Wir vergleichen jeden Aspekt unseres Berufslebens mit anderen und müssen mit Gefühlen wie Unzulänglichkeiten klarkommen.
Inszenierung: Wir stellen uns anders da, als wir wirklich sind. Manchmal ist die Abweichung minimal. Manchmal etwas größer. Was macht das mit unseren Gefühlen?
Bewertungen: Likes oder keine Likes, positive, negative oder gar keine Kommentare. Wir werden auf Social Media ständig bewertet – das ist nicht immer angenehm. Kritik oder Anfeindungen erfordern emotionale Resilienz.
Erwartungen: Was, wie und wie oft wir posten – unsere Follower haben ganz konkrete Erwartungen und lassen es uns öfter auch wissen, wenn wir ihre Erwartungen enttäuscht haben. Wie geht es uns dabei? Reden wir mit jemandem darüber?
Privatsphäre: Selbstständige müssen ständig entscheiden, wie viel von sich selbst sie auf Social Media zeigen wollen. Das erfordert Emotionsarbeit.
Andere Formen der Emotionsarbeit
Auch eine Migrationsgeschichte kann bedeuten, zusätzliche Emotionsarbeit leisten zu müssen. Neben Marketing, Buchhaltung und der Zusammenarbeit mit Menschen geht es bei Selbstständigen mit Migrationsgeschichte oft auch darum, aktuelle Ereignisse wie Krieg und Krisen zu verarbeiten oder mit Traumata umzugehen.
Auch aus feministischer Perspektive ist Emotionsarbeit wichtig. Denn es sind häufig Frauen, die – in der Familie oder im Büro – Streit schlichten, vermitteln oder für Harmonie sorgen.
Die Auswirkungen von Emotionsarbeit
Warum ist es für Selbstständige nun so wichtig, über Emotionsarbeit Bescheid zu wissen?
Zunächst einmal: Weil Emotionsarbeit auch Arbeit ist. Selbst wenn sie nicht bezahlt, nicht wertgeschätzt und oft auch nicht gesehen wird, erfordert Emotionsarbeit unsere Zeit, Energie und manchmal auch Geld.
Das kann dazu führen, dass wir uns müde fühlen, ja regelrecht erschöpft und ausgebrannt. Selbst wenn wir nicht viele Termine haben und eigentlich nur im Homeoffice arbeiten.
Eng mit der Emotionsarbeit verknüpft ist auch das Konzept der emotionalen Dissonanz.
Emotionale Dissonanz tritt auf, wenn es eine Spannung gibt zwischen den tatsächlichen Emotionen und den Emotionen, die gezeigt oder ausgedrückt werden.
Klassisches Beispiel: Aufgrund einer Trennung oder eines Todesfalls ist jemand zutiefst traurig, zwingt sich aber dazu, auf Instagram „Good Vibes“ zu versprühen. Das erzeugt einen inneren Konflikt, der dann noch mehr Emotionsarbeit benötigt.
Manchmal kann der Erwartungsdruck auf Social Media, ständig gut gelaunt zu sein, sich bis ins Toxische steigern, was wiederum zu verstärkter Emotionsarbeit führen kann. Denn die Erwartung, immer glücklich oder positiv zu sein, heißt oft, die tatsächlich erlebten Gefühle zu unterdrücken oder zu verstecken.
Was ist im Hinblick auf Selbstständigkeit und Emotionsarbeit wichtig?
Es geht nicht darum, Emotionsarbeit abzuschaffen. Im Gegenteil: Emotionsarbeit ist notwendig für eine Gesellschaft.
Wem als Selbstständige*r psychische Gesundheit wichtig ist, sollte aber erst einmal ganz grundlegend anerkennen und auf dem Schirm haben, dass es Emotionsarbeit gibt und dass sie geleistet wird. Oft jeden Tag.
Vor allem bei Selbstständigen in Dienstleistungsberufen, auf Social Media, mit Migrationsgeschichte oder bei Selbstständigen mit Kindern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Emotionsarbeit einen großen Teil der Zeit und Energie beansprucht. (Und Introvertierte können Emotionsarbeit vielleicht sogar noch zusätzlich als anstrengender empfinden.)
Was mir persönlich geholfen hat, war bekanntermaßen, Social Media zu verlassen und in meinem Marketing auf Social-Media-freie Plattformen zu setzen.
Ansonsten ist authentischer Selbstausdruck oft die beste Prävention. Und in einem akuten Fall von Erschöpfung heißt es: gut zu sich sein, ausruhen und Auszeiten einlegen. Auch wenn das bedeutet, nicht so schnell voranzukommen, wie die schnelllebige Welt das von uns will.
Selbstständig mit Migrationsgeschichte: Was unsere Herkunft mit unserer Selbstständigkeit zu tun hat
Knapp jede vierte unternehmerisch tätige Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Was bedeutet die Einwanderungsgeschichte für Selbstständige? Wie zeigt sich die Herkunft im Arbeitsalltag?
Als ich nach Deutschland kam, war ich fast acht Jahre alt und kannte genau zwei deutsche Wörter: „Banane“ und „Nudelsuppe“.
„Banane“, weil das für meine Familie das Symbol des Westens war. („Stell dir vor: In Deutschland kann man Bananen im Geschäft kaufen! Bananen!!!“)
„Nudelsuppe“, weil es die bei uns wie bei fast allen Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion jeden Sonntag zum Mittagessen gab. Mit selbstgemachten Bandnudeln, für die meine Oma meist den ganzen Vormittag in der Küche stand.
Ich bin 1983 in Nowosibirsk geboren.
Meine deutschen Vorfahren kamen unter Katharina der Großen nach Russland, lebten dort als Landwirte oder Schreiner, überlebten Umsiedlungen, Deportationen, Arbeitslager. Mal lebten sie in der heutigen Ukraine, mal im eiskalten Sibirien.
1991 zog meine Familie wieder zurück nach Deutschland, 2016 machte ich mich selbstständig.
Die längste Zeit meiner Selbstständigkeit dachte ich, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Doch heute denke ich, dass meine Herkunft einen großen Anteil an meinen Irrungen und Wirrungen als Selbstständige hat.
Sozialismus im Kopf
Geschätzt machen sich weniger als 2% der Russischstämmigen selbstständig.
Das ist deutlich weniger als die knapp 10% von allen Erwerbstätigen in Deutschland. Oder von den 7,4% türkischstämmigen Berufstätigen (Quelle nicht mehr online).
Ich finde es nicht überraschend.
Wenn ich an meine Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion denke, sehe ich mich immer irgendwo mit meinen Eltern in einer Schlange stehen.
Wir stehen an, weil mein Vater gehört hat, dass es in diesem Geschäft Sahne gibt. Oder weil die Cousine der Nachbarin erfahren hat, dass ein bestimmtes Geschäft Fleisch verkauft.
Wir stehen und warten und drehen Däumchen, um am Ende gesagt zu bekommen, dass wir zu spät sind und alles ausverkauft ist. Oder wir gehen durch die nahezu leeren Regale im Geschäft auf der Suche nach Brot und freuen uns nen Keks, wenn wir noch einen Laib erwischen.
Mein Default-Setting ist der Mangel.
Es ist zu wenig da.
Es reicht nicht für alle.
Es fehlt an allen Ecken und Kanten.
Als ich Ende 2015 meine Zehen in das kalte Selbstständigsein-Wasser tunkte, waren das meine Wahrheiten, die ich erst einmal nicht hinterfragte.
Gedanklich in einem Mangel zu leben, war als Selbstständige anstrengend:
Ich traute mich nicht, über Geld zu sprechen.
Ich nahm jeden noch so schlecht bezahlten Auftrag an und …
jede Kollegin als „Bedrohung“ wahr – schließlich ist ja nicht genug für alle da
Ich verbrachte Jahre, um mir dieser sabotierender Gedanken bewusst zu werden und sie gegen andere – stärkende – zu tauschen.
Bloß nicht auffallen
Aufwachsen im Sozialismus heißt auch: Wir bekommen ein Päckchen aus dem Westen – die mit Gummibärchen, losem Kaffee und Vollmilchnussschokolade aus dem Aldi – und ich soll niemandem davon erzählen.
Niemand soll wissen, dass wir Deutsche sind und Verwandtschaft im Westen haben. Dass wir keine „richtigen“ Russen sind.
Ich nehme heimlich Süßigkeiten mit nach draußen und verteile sie an die Nachbarskinder. Einige Tage später gucken mich einige Kinder komisch an und jemand sagt, dass ich ein „Nazi“ bin.
In Deutschland angekommen, bin ich die „Russin“. Auf der Tafel malt ein Mitschüler Russland auf, „zerbombt“ es mit Papierkugeln und sieht mir dabei herausfordernd in die Augen.
Und so ist es auch mit der Onlinesichtbarkeit, als ich mich fast dreißig Jahre später selbstständig mache: Sie klingt potentiell gefährlich.
Noch immer höre ich irgendwo eine Stimme in mir, die sagt:
Lieber nicht auffallen.
Bloß nichts riskieren.
Niemanden kritisieren.
Noch immer habe ich ein leicht mulmiges Gefühl, wenn ich auf meinem Blog auf den „Veröffentlichen“-Button drücke. Oder bei dem brandneuen Podcast. Ich muss mich bewusst daran erinnern, dass ich hier sicher bin. Dass ich auffallen und meine Meinung sagen darf.
Als ich dann vor Social Media verlasse, eine eher „rebellische“ Haltung zu Marketing einnehme und mir erlaube, auch mal anzuecken, fühlt sich das abwechselnd befreiend und beängstigend an. Eine wilde Mischung.
Der böse Staat
Die Steigerung „Sei vorsichtig, traue niemandem, du weißt nie, wer mithört“ – das hatte ich auch schon als kleines Kind in der Sowjetunion verstanden.
Die Behörden und der Staat sind die Bösen. Wir müssen auf der Hut sein.
Und so löst noch heute jeder Brief vom Finanzamt Herzklopfen aus. Jedes drohende Telefonat, jeder Gang zum Gewerbeamt klingt irgendwie gefährlich. Hat das Imposter-Syndrom vielleicht auch etwas damit zu tun?
Der fremdklingende Nachname
In den ersten Jahren in Deutschland habe ich mich für meinen Nachnamen geschämt.
In der Schulzeit wird es etwas besser, doch ich muss meinen Nachnamen immer wieder buchstabieren, werde gefragt, wie man ihn „richtig ausspricht“. Meist dient mein Nachname als Anlass zur Frage, wo ich herkomme.
Die Kleinstadt in Hessen, in der ich, seit wir in Deutschland sind, lebe, ist damit nicht gemeint. Das stelle ich immer wieder fest. „Nein, wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren?”, haken Menschen dann gerne nach.
Wenn ich „Russland“ sage, ernte ich meist ein „Ah“. Über Russland gibt es nichts Gutes zu sagen, deshalb ist das Gespräch an dieser Stelle meist wieder beendet. War auch schon in den 90ern so. „Hätte dem Klang nach auch Italien sein können“, sagen manche noch. Ja, hätte es. Ist es aber nicht.
Meine gesamte Kindheit und Jugend wünsche ich mir einen anderen Nachnamen. Am besten den deutschesten aller deutschen, damit ich endlich nicht mehr auffalle.
Als ich dann einen „Müller“ heirate – ich schwöre, ich hab ihn mir nicht wegen seines Nachnamens ausgesucht –, entscheide ich mich auf dem Weg zum Rathaus spontan für einen Doppelnamen. Irgendwie kann ich es mir plötzlich nicht mehr vorstellen, den Namen, mit dem ich ein Vierteljahrhundert gelebt habe, wieder abzulegen.
Und als ich mich selbstständig mache, entscheide ich mich dafür, das völlig unter meinem Mädchennamen zu tun.
Und dann kam der Krieg
Als dann das Unvorstellbare passiert und wieder Krieg in Europa ist, bin ich wie gelähmt. Für die nächsten Monate ist Ausnahmezustand in meinem Kopf. Ich bin nicht leistungsfähig. Lebe wie unter einem Schleier. Lese zu viele Nachrichten.
Durch meine Familiengeschichte fühle ich mich seltsam betroffen, selbst wenn ich Tausende von Kilometern weit weg bin und gerade keine Verwandtschaft mehr in der Ukraine lebt. (Dafür aber immer noch in Russland.)
Zusätzlich frage ich mich, was das nun für mich als Selbstständige bedeutet:
Wird sich jemand durch meinen russischen Nachnamen abgeschreckt fühlen und nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen?
Muss ich mich aktiv vom Krieg distanzieren oder ist Menschen, die mich kennen, klar, dass ich kein großer Fan von Größenwahnsinnigen mit imperialen Machtansprüchen bin?
Was ist, wenn ich – so wie meine Vorfahren – den Wohlstand verliere und wieder neu anfangen muss?
Diese Gedanken sage ich niemandem, schreibe sie nicht auf. Zu groß ist die Angst, dass das negative Konsequenzen für mich hätte.
Und auch jetzt denke ich: Ist das wirklich eine so gute Idee, diesen Text zu schreiben und zu veröffentlichen? Was werden andere Menschen sagen? Was werden sie – im stillen Kämmerlein – über mich denken?
Doch gleichzeitig finde ich es wichtig.
Wir sehen Menschen ihre Einwanderungsgeschichte nicht an.
Wir sehen transgenerationale Traumata oder Diskriminierungserfahrungen nicht an.
Aber sie sind da. Unsichtbar.
Und vor allem bedeuten sie für uns nicht selten Emotionsarbeit – zusätzlich zu den Herausforderungen, die eine Selbstständigkeit eh schon so mit sich bringt.
Deshalb kann es gut sein, dass wir dann und wann das Tempo drosseln, wenn andere Vollgas geben. Dass wir mit Verarbeiten und Heilen beschäftigt sind und nicht mit Wachsen. Dass Nachrichten und Kriege uns mehr aus der Bahn werfen als andere Selbstständige.
Es ist okay. Seien wir gut zu uns.
Toxische Positivität auf Social Media: Ein kritischer Blick auf die „Good Vibes Only“-Bubble
Warum toxische Positivität auf Social Media ein großes Problem ist und wir als Selbstständige die „Good Vibes only“-Bubble auf Social Media dringend verlassen sollten.
Toxische Positivität – einer der Gründe, warum ich vor gut einem Jahr meinen Instagram-Account gelöscht habe.
Was dieser Begriff genau meint, welche Rolle soziale Medien bei der toxischen Positivität spielen und warum ich es so wichtig für Selbstständige finde, aus der „Good Vibes only“-Bubble auszusteigen, erzähle ich in diesem Artikel.
Inhalt
Was ist toxische Positivität? Eine Definition
Beispiele für toxische Positivität
Warum ist toxische Positivität so problematisch für Selbstständige?
All feelings welcome – Warum wir auch die unangenehmen Gefühle in der Selbstständigkeit brauchen
Was ist toxische Positivität? Eine Definition
Toxische Positivität meint eine Form von übertriebenem Optimismus und einen so starken Fokus auf das Positive, dass es zum Negieren, Ignorieren oder Verdrängen von bestimmten „unbequemen“ Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Enttäuschung oder Angst kommt.
In jeder Situation wird versucht, „positiv zu denken“. Und wenn andere Menschen traurig oder enttäuscht sind, wird ihnen gerne mal ein „Sieh es doch mal positiv“ oder „Don’t worry, be happy“ entgegengebracht.
Beispiele für toxische Positivität
Soweit die Theorie. Lass uns das Ganze jetzt mal an einigen konkreten Beispielen durchspielen, die den meisten Selbstständigen bekannt vorkommen dürften.
Toxische Positivität in der Offlinewelt
Zunächst einmal ist toxische Positivität nicht für die Onlinewelt reserviert. Wir finden sie auch im „wirklichen Leben“:
Wenn ein langjähriger Kunde gekündigt hat, wir enttäuscht sind und unsere Freundin sagt: „Kopf hoch! Das wird schon wieder …“
Wenn wir ein Ziel haben, es nicht erreichen, traurig sind und der Partner sagt: „Ist doch nicht so schlimm. Du machst doch trotzdem alles super …“
Wenn uns die Reaktion einer Kundin wütend macht und wir von der Mutter gesagt bekommen: „Du musst das Ganze positiv sehen …“
Alles toxische Positivität.
Diese Worte mögen zwar nett gemeint oder sogar als liebevoller Trost gedacht sein, aber in erster Linie negieren oder ignorieren sie die Gefühle, die wir in diesem Augenblick fühlen.
Enttäuschung, Traurigkeit, Wut.
Alles normale Gefühle, die zur normalen Bandbreite der menschlichen Empfindungen gehören und per se nicht schlechter sind als Freude, Neugier oder Glück.
Nicht nur im Privatleben, sondern auch in der Selbstständigkeit.
Toxische Positivität in sozialen Medien
Social Media hat toxische Positivität also nicht erfunden, treibt das Phänomen aber nochmal ins Extreme. Denn je nach Plattform und Bubble kann es sein, dass wir uns in einer Welt wiederfinden, in der alle ausschließlich immer nur gute Laune haben.
Sie machen einen total romantischen Herbstspaziergang.
Haben die besten und treuesten Kundinnen.
Haben ihre Jahresumsätze verhundertdreißigfacht.
Machen die siebte Workation in Island dieses Jahr.
Sind dreiundzwanzig Monate im Voraus ausgebucht.
Haben sich fünfzehn neue Kund*innen manifestiert.
Dazwischen gibt es Motivations- und Inspirationszitate am Fließband:
Good vibes only.
Bad vibes don’t go with my outfit.
Radiate positivity.
She just shines.
Things are gonna totally work out.
Don’t forget to smile.
Good Vibes Only – ein häufiges Motto auf Social Media
Warum ist toxische Positivität so problematisch für Selbstständige?
Abgesehen davon, dass natürlich niemandem jeden Tag die Sonne aus dem Popo scheint und manche Dinge auch mal nicht funktionieren werden, sind für mich insbesondere drei Punkte an toxischer Positivität ein Problem:
#1 Fehler, Probleme, Herausforderungen und damit verbundene Gefühle wie Enttäuschung, Frust und Traurigkeit sind in den sozialen Medien chronisch unterrepräsentiert
Hier werden Erfolge gefeiert und siebenstellige Jahresumsätze manifestiert, doch nur selten redet jemand über Absagen, Geldnot, Herausforderungen, Fehler oder Misserfolge und damit verbundenen Gefühle.
Die Unterrepräsentation von diesen Herausforderungen und „unangenehmen“ Gefühlen ist auf der einen Seite natürlich verständlich. Kaum jemand möchte sich vor allen Leuten verletzlich machen, kaum jemand möchte zugeben, dass er oder sie auch mal struggelt.
Das Bild, das andere Menschen von uns haben sollen, soll ein positives sein. Vor allem, wenn wir als Selbstständige darauf angewiesen sind, dass Menschen uns gut finden und mit uns zusammenarbeiten wollen.
Das erklärt, warum viele Selbstständige nur dann ihre Struggles teilen, wenn sie ein entsprechendes „Learning“ vorweisen können. („Ich hab einen Fehler gemacht und dann – Heureka! – habe ich etwas Entscheidendes gelernt und bin jetzt noch erfolgreicher als jemals zuvor.“)
Auf der anderen Seite ist diese Unterrepräsentation zutiefst problematisch. Denn dadurch denken viele Selbstständige, dass …
alle wissen, wie der Hase läuft, nur sie nicht
alle mit Erfolg gesegnet sind, nur sie diejenigen sind, die Geldsorgen und zu wenige Kund*innen haben
oder kurz: dass alle anderen „normal“ sind, dass aber mit ihnen etwas nicht stimmt, weil ihre Pläne nicht immer funktionieren und sie auch mal schwierige(re) Zeiten durchleben
Toxische Positivität isoliert also (= alle anderen sind normal und richtig, ich bin unnormal, falsch und gehöre nicht dazu). Und Isolation kann auf Dauer eine immense Herausforderung für die mentale Gesundheit werden.
#2 Toxische Positivität verändert unser eigenes Verhalten auf Social Media
Wenn alle immer gut gelaunt sind, dann tun wir halt auch so, als wäre bei uns alles in Butter.
Denn wir wollen natürlich dazu gehören zum Social-Media-Club.
Bloß nicht negativ auffallen, uns nicht „blamieren“.
Bloß nicht zugeben, dass ein Auftrag überraschend geplatzt ist, eine Kundin plötzlich gekündigt hat, dass wir in der Anfangszeit der Selbstständigkeit keine Kunden finden und deshalb traurig, enttäuscht oder frustriert sind.
Wir passen uns der heilen Instagram-Welt an und erzählen auch überwiegend von den guten Tagen, unseren kleinen und großen Erfolgen und den erreichten Zielen.
Und ehe wir uns versehen, leisten wir auch unseren Beitrag dazu, dass die Maschinerie „toxische Positivität“ in Gang bleibt.
Ein teuflischer Kreislauf.
#3 Wir fühlen uns schlecht, weil wir uns schlecht fühlen
Die Unterrepräsentation von Herausforderungen und bestimmten Gefühlen auf Social Media führt nicht nur dazu, dass wir diese Gefühle selbst nicht mehr öffentlich zeigen. Sie führt auch dazu, dass wir denken, dass Herausforderungen in der Selbstständigkeit und die damit verbundenen Gefühle nicht in Ordnung sind.
Dass Enttäuschung, Frust, Trauer oder Wut nicht in Ordnung sind, weil wir sie online nicht mehr sehen. Vielleicht bei irgendwelchen Trolls und Spammern, aber nicht bei unseren Kolleg*innen oder Kund*innen.
Schließlich sehen wir ja nur ihre guten Tage und größten Erfolge.
Und wenn uns dann ein Kunde absagt, fühlen wir uns nicht nur schlecht, weil der Kunde abgesagt hat. Wir fühlen uns nun auch schlecht, weil wir uns schlecht fühlen.
Und wenn wir noch nicht fünf- und sechsstellige Monatsumsätze haben, weil wir uns gerade erst selbstständig gemacht haben, fühlen wir uns nicht nur frustriert, weil zu viel Monat für den Kontostand übrig ist. Wir fühlen uns auch schlecht, weil wir frustriert sind und mal keine „Good vibes“ versprühen.
„Moment einmal“, denkst du dir jetzt vielleicht, „was spricht denn überhaupt gegen positives Denken oder Optimismus?“
Nichts spricht dagegen.
Zumindest, wenn du unter „positivem Denken“ oder „Optimismus“ eine zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung verstehst. Die habe ich ja auch.
Toxische Positivität ist aber mehr als das.
Es ist ein „Positiv um jeden Preis“.
Es ist das Negieren, Ignorieren, Verdrängen oder Abstreiten von bestimmten Emotionen.
Es ist ein so starker Fokus auf das Positive, dass kein authentisches Empfinden, kein authentischer Ausdruck mehr möglich ist.
Toxische Positivität zu kritisieren, heißt also nicht, Pessimistin zu sein oder sich „in Selbstmitleid zu suhlen“. Es heißt einfach nur, für einen authentischen Ausdruck als Mensch einzustehen – mit allen Gefühlen, die dazu gehören.
Es heißt, Probleme, Herausforderungen und Fehler anzunehmen – und nicht totzuschweigen.
Es heißt, es sich erlauben, alle Gefühle auszudrücken und zu fühlen – und sie nicht etwa mit Social Media zu betäuben.
All feelings welcome – Warum wir (auch) die unangenehmen Gefühle in unserer Selbstständigkeit brauchen
Denn wir brauchen alle Gefühle als Selbstständige.
Nicht nur Freude und Glück und Begeisterung. Sondern auch Wut, Enttäuschung, Frust oder Traurigkeit.
Ja, Sie mögen unangenehme Gefühle sein, aber sie sind gleichzeitig auch so unendlich wertvoll. Warum? Darum:
#1 Weil unangenehme Gefühle unerfüllte Bedürfnisse zeigen
Warum ist mir das so wichtig? Was ist mir überhaupt wichtig? Warum habe ich überhaupt so reagiert?
Gefühle sind eine großartige Möglichkeit, mehr über uns und unsere Bedürfnisse zu erfahren.
So ist in der gewaltfreien Kommunikation Wut nichts anderes als ein Warnblinker, der anzeigt, dass irgendein elementares Bedürfnis zu kurz kommt. Ein Hilfeschrei des Körpers quasi.
So wie in einem Auto der Motor kaputt gehen kann, wenn wir wichtige Warnungen ignorieren, können auch wir richtig krank werden, wenn wir bestimmte Gefühle und damit unerfüllte Bedürfnisse (zu lange) verdrängen.
Oder anders formuliert: Wir brauchen Frust, Ärger, Trauer und Wut, um unseren unerfüllten Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und mental und körperlich gesund zu bleiben.
#2 Weil unangenehme Gefühle große Transformation bewirken können
Alle großen beruflichen Veränderungen in den letzten Jahren wurden bei mir durch unangenehme Gefühle in Gang gesetzt.
Als ich wütend war, dass ein Kunde – und ich tippe diese Zeilen gerade mit dem Mittelfinger – immer wieder die Zeche prellte, wusste ich, dass ich meine Beratungen ab sofort nur noch per Vorkasse anbieten wollte.
Als ich im Sommer 2020 so erschöpft war, dass ich noch nicht mal mehr meine Gedanken hören konnte, wusste ich, dass es Zeit war, mich von Social Media zu verabschieden und meine Social-Media-Kanäle zu löschen.
Wut. Frust. Erschöpfung – alles normale Gefühle und eine riesige Chance für tiefgreifende Veränderung und echtes Wachstum.
#3 Weil unangenehme Gefühle tiefe Verbindungen zu Menschen schaffen
Manchmal struggelt eine Teilnehmerin in einem meiner Programme so sehr, dass sie vor allen anderen weint, während sie von ihrer Herausforderung erzählt.
Auch wenn es sich auf den ersten Blick seltsam anhören mag, aber diese Momente gehören zu den wertvollsten Erfahrungen, die ich der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleben darf. Denn wenn Teilnehmerinnen merken, dass sich jemand öffnet – wirklich öffnet und Gefühle zeigt – passiert eine Magie, die sich kaum in Worte fassen lässt.
Es entsteht eine Verbindung zwischen den Teilnehmerinnen, die nicht möglich wäre, wenn alle so tun würden, als wäre alles in Butter. Diese Verbindung ist unsichtbar und dennoch fast greifbar. Und sie zeigt sich nicht zuletzt in der Empathie und dem Verständnis, das der Teilnehmerin von allen Seiten entgegengebracht wird.
#4 Weil überstandene Krisen Resilienz ausbilden
Das Schöne an Trauer, Frust und Enttäuschungen ist: dass sie uns stärker machen.
Wenn wir diese Gefühle verarbeiten, indem wir sie nicht verdrängen, ignorieren oder betäuben, sondern …
sie annehmen
ihnen Zeit und Raum geben
sie fühlen („Was spüre ich wo im Körper?“)
sie benennen und kategorisieren („Ich fühle mich traurig, weil …“)
neugierig sind und versuchen, sie zu verstehen („Warum fühle ich mich so? Welches unerfüllte Bedürfnis steckt dahinter?“)
… können wir als Selbstständige Resilienz ausbilden.
Und selbst wenn wir niemals zu 100% sagen können, dass schon „alles gut wird“, wissen wir damit doch, dass wir klarkommen – egal, was passiert.
Selbstständig in Krisenzeiten – Wie mit Krieg und Katastrophen umgehen?
Wie können Selbstständige mit Krisen, Krieg und Katastrophen umgehen? Einige Vorschläge und Gedankenanstöße gibt es in diesem Blogartikel.
Es ist Krieg in Europa und wir sind alle fassungslos angesichts der unvorstellbaren Zerstörung und des unendlichen Leids der Menschen in der Ukraine.
Als Menschen fühlen wir mit den Opfern des Krieges mit. Möglicherweise weinen wir, verzweifeln und verstehen die Welt nicht mehr.
Als Selbstständige beschäftigen uns zusätzlich noch andere Fragen:
Soll ich mich zu den aktuellen Geschehnissen äußern oder lieber schweigen?
Wie soll ich mich gegenüber meinen Kund*innen verhalten?
Was soll ich auf Social Media sagen?
Darf ich in einer Krise überhaupt „normal“ arbeiten und Geld verdienen?
Muss ich jetzt meinen Launch absagen?
Darf ich auch erstmal völlig von der Bildfläche verschwinden?
Wie gehe ich als Selbstständige also mit Krisen, Krieg und Katastrophen um?
Einige Vorschläge und Gedankenanstöße habe ich dir im Folgenden zusammengetragen:
Inhalt
#1 Den ersten Schock verarbeiten
Die berühmte Sauerstoffmaske im Flugzeug – wir setzen sie uns immer zuerst selbst auf.
Noch bevor wir daran denken, anderen Menschen zu helfen, helfen wir zuerst uns. Das gilt nicht nur für Eltern und Kinder im Flugzeug, sondern auch für uns als Selbstständige.
Noch bevor wir also an Kund*innen, Social-Media-Posts oder anstehende Launches denken, sorgen wir erst einmal für uns und leisten uns erste Hilfe.
✅ Pause einlegen
Wenn du gerade nicht „business as usual“ machen kannst, kannst du dir ein guter Freund sein und auf den Pausenknopf drücken. Minuten, Stunden, Tage, Wochen – alles ist okay, wenn du es für dich einrichten kannst.
Dass du gerade nicht kreativ arbeiten kannst, hat einen Grund:
Laut der Maslow’schen Bedürfnispyramide müssen zuerst elementare Bedürfnisse erfüllt sein, bevor wir uns um „Luxusbedürfnisse“ wie Selbstverwirklichung kümmern können.
Will heißen: Solange Ängste und Sorgen dominieren und das Bedürfnis nach Sicherheit unerfüllt bleibt, ist es schwer für Menschen, kreativ zu arbeiten.
Somit hat es überhaupt keinen Sinn, sich zum Arbeiten zu zwingen. Sinnvoller ist es, eine Pause einzulegen und Selbstfürsorge zu betreiben: Laptop zuklappen, Social-Media-Apps deinstallieren oder Smartphone ganz ausschalten und sich etwas Gutes tun wie zum Beispiel ein Spaziergang oder ein schönes Essen.
Du kannst partout nicht freimachen?
Vielleicht kannst du dich fragen:
Welche Aufgaben sind wirklich wichtig?
Was muss ich unbedingt heute machen und was kann ich auf später verschieben?
Welche Termine kann ich verlegen?
Was kann ich vielleicht ganz absagen, weil ich den Termin eh nicht wollte?
Und: Welche eine kleine Sache kann ich heute für mich tun, damit es mir ein bisschen besser geht?
✅ Gefühle verarbeiten
Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um in Kontakt mit unseren Gefühlen zu kommen, zum Beispiel indem wir …
… in unseren Körper hineinspüren und uns fragen: Wie geht der Atem? Wie schlägt das Herz?
… unsere Gefühle benennen und kategorisieren, zum Beispiel „Ich fühle mich wütend / ohnmächtig / traurig / ängstlich / ruhig.“
Es gibt keine „guten“ oder „schlechten“ Gefühle. All feelings are welcome.
Mir persönlich hilft der Austausch mit anderen.
Zu sagen „Ich bin fassungslos, wenn ich an all die Menschen denke, die jetzt sterben“ und zu hören „Du, mir geht es genauso. Es ist so unfassbar, was gerade passiert“, wird die Weltlage nicht verändern, aber es wird dir zeigen, dass …
du nicht alleine mit deinen Gefühlen bist
du verstanden und gesehen wirst
du auch in schwierigen Zeiten Verbindung zu anderen Menschen herstellen kannst
Weitere Möglichkeiten, dir deiner Gefühle klar zu werden und/oder sie zu verarbeiten:
Schreiben
Musik hören
Humor (Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es heißt nicht umsonst „Comic Relief“.)
❌ Schlechtes Gewissen und Rechtfertigungen
Alle anderen leiden, doch du kommst mit den Geschehnissen gut zurecht?
Es ist okay.
Genauso wie es in Ordnung ist, unter einer Krisensituation zu leiden, ist es natürlich auch völlig in Ordnung, resilient und stark zu sein. (Du weißt schon: All feelings are welcome.)
Es ist in Ordnung zu sagen: Ich sehe all das furchtbare Leid, das der Krieg hervorbringt, und es furchtbar, aber … ich bin soweit okay.
Es ist okay, okay zu sein.
Niemand braucht ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben.
Auch wenn du weitestgehend „normal“ arbeiten und dich konzentrieren kannst, musst du dich niemandem gegenüber rechtfertigen. Wenn dich deine Arbeit ablenkt und dir gut tut, umso besser.
❌ Toxische Positivität
Etwas anderes ist es, eigene Gefühle zu verdrängen oder den Sorgen und Ängsten deiner Mitmenschen „Es wird schon alles gut.“ oder „Wir sehen das jetzt mal positiv.“ entgegenzubringen.
Es spricht auch in Krisenzeiten nichts gegen Optimismus und eine zuversichtliche Lebenseinstellung.
Aber ein so starker Fokus auf das Positive, dass es zum Negieren, Ignorieren, Verdrängen oder Abstreiten von bestimmten Emotionen kommt und kein authentisches Empfinden mehr möglich ist, hilft niemandem.
Auch dir nicht.
❌ Zwang und Druck
Ich glaube: Wer sich als Business-Coach nicht dazu motivieren kann, auf den Kanälen Business-Tipps zu geben, kann davon ausgehen, dass es seiner Community ähnlich geht und sie gerade eh keinen Kopf für Businesstipps haben.
Ich würde mich nicht zum Arbeiten zwingen (oder zum Posten, Tippsgeben, Bloggen oder Newsletterschreiben), sondern vielmehr darauf vertrauen, dass ich wieder Freude und Motivation bei meiner Arbeit spüren werde, wenn es mir wieder besser geht.
#2 Menschlich sein
Als Selbstständige wollen wir in erster Linie als Expertin wahrgenommen werden.
Doch meiner Erfahrung nach sind Krisenzeiten eher dafür da, menschlich zu sein – auch unseren Kund*innen, Newsletterabonnent*innen oder Followern gegenüber.
✅ Gefühle teilen
Wer will, kann seine oder ihre Gefühle teilen und erzählen, wie es ihm oder ihr im Moment geht.
Ich habe meine Gefühle angesichts des Kriegs in der Ukraine in meinem Newsletter beschrieben und war überwältigt von den Reaktionen, der Anteilnahme und der Hilfsbereitschaft der Menschen.
✅ Verbindung suchen
Wenn du nicht weißt, was du angesichts der schrecklichen Ereignisse sagen sollst, kannst du auch „nur“ Verbindung suchen.
Einen Dialog starten.
Menschen fragen, wie es ihnen mit der Situation geht.
Zuhören.
Manchmal ist es genug, da zu sein und Kommunikationsräume zu eröffnen – selbst wenn du „im wahren Leben“ Webdesigner*in oder Fotograf*in bist.
❌ Dampf ablassen
Emotionen, die du selbst noch nicht klar gekriegt hast, würde ich persönlich nicht mit deiner Community teilen.
Bereits kategorisierte Gefühle zeigen („Ich bin zutiefst geschockt/traurig/wütend.“) – ja.
Deine Community nutzen, um Dampf abzulassen („Dieses verf*ckte A*schloch soll in der Hölle schmoren!!!“) – nein.
Worte, die du im Newsletter geschrieben oder auf Social Media geteilt hast, kannst du nicht so schnell wieder zurücknehmen.
#3 Solidarität zeigen
Nach dem ersten Schock und der Lethargie merken wir, dass wir dringend etwas tun müssen, weil wir sonst verrückt werden, wenn wir noch mehr von diesen schrecklichen Bildern sehen.
Nicht nur als Menschen, auch in unserer Funktion als Unternehmer*in können wir uns mit den betroffenen Menschen solidarisieren, unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen und Menschen helfen.
✅ Kleine Gesten
Es muss nicht immer gleich der große Wurf sein.
Ich habe, noch bevor ich in der Lage war, auch nur irgendetwas zu tun, ein gelbes und ein blaues Herzchen in meinen Footer eingebunden.
In einem der wenigen Newsletter, die ich noch abonniert habe, wurde eine Playlist mit heilsamen Songs geteilt.
Kleine Geste.
Große Wirkung (für mich persönlich).
Denke immer daran, dass eine (aus deiner Sicht) winzige Kleinigkeit einem anderen Menschen in schwierigen Zeiten eine große Hilfe sein kann.
Also:
Welche kleine Sache kannst du tun, um jemandem in dieser Zeit zu helfen?
✅ Geld spenden
In Krisenzeit wird vor allem Geld gebraucht. Und auch als Unternehmer*in kannst du natürlich einen Beitrag leisten und spenden.
✅ Größere Aktionen
Falls du bereits über ein größeres Netzwerk verfügst, kannst du auch deine Kolleg*innen zusammentrommeln und eine Spendenaktion organisieren.
Ich habe Anfang 2021 zum Beispiel ein „Online Festival“ zum Thema Pinterest veranstaltet.
Wir haben eine Woche lang kostenlos unsere Expertise zur Verfügung gestellt und Spenden für die Coronakünstlerhilfe gesammelt.
Und auch jetzt nutzen viele Influencer*innen ihre Reichweite und stellen größere Aktionen auf die Beine.
✅ Reichweite Betroffenen zur Verfügung stellen
Eine tolle Idee von Biathlet Erik Lesser:
Er stellt seinen Instagram-Account, auf dem er allein 30k russische Follower hat, ukrainischen Sportlern zur Verfügung, damit sie über den Krieg informieren.
❌ Blinder Aktionismus
Der Wunsch zu helfen, ist nur allzu verständlich.
Doch lass dich nicht von blindem Aktionismus anstecken, der weder dir noch den von der Krise betroffenen Menschen weiterhilft.
Wenn du spendest, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Spende bei einer vertrauensvollen Organisation ankommt. Beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen gibt es eine tagesaktuelle Liste von Hilsorganisationen sowie grundsätzliche Tipps fürs Spenden in Katastrophen- und Krisenfällen.
Wenn du spendest, sollte die Spende zielgerichtet sein. Sachspenden sind zwar nett gemeint, aber für die meisten Organisation sind Geldspenden um einiges sinnvoller.
Wenn du deiner Community helfen willst, kannst du überlegen, ob du das wirklich willst oder nur aus „Gruppendruck“ machst.
Nur weil viele deiner Kolleginnen in Krisenzeiten für ihre Community da sein wollen und spontan Workshops und Hilfsangebote auf die Beine stellen, heißt es nicht, dass es dein Weg sein muss.
❌ Über andere Hilfsangebote urteilen
Ich bin mir sicher: Wir alle tun gerade das, was in unserer Macht steht.
Politisches Engagement.
Persönliche Gespräche.
Liebe Nachrichten.
Ehrenamtliche Unterstützung.
Alles ist wichtig und richtig.
Es gibt hier kein Besser oder Schlechter.
Kein Richtig oder Falsch.
Wir brauchen jedes blau-gelbe Herzchen, jede Demo, jedes Gespräch, jeden Anruf, jeden Blogartikel, jede Meditation, jede Spende, jede Aktion, jede Vermittlung, jeder Übersetzung, jedes Lächeln, jede Mail, jedes „Heute lasse ich mein Auto stehen und fahre mit dem Fahrrad – Puck Futin!!!!“ und jeden Musiker, der sich jetzt vor die russische Botschaft stellt und für den Frieden spielt.
Gerade die Fülle und die verschiedenen Arten der Hilfen ist das Wunderbare.
#4 Business as usual?
Und wie geht es nun ganz konkret mit deiner Selbstständigkeit weiter?
✅ Kommunikation nach außen anpassen
In den meisten Fällen wird es das Beste sein, die Kommunikation nach außen anzupassen.
So wie große Fernsehsender auf die veränderte Weltlage reagieren und Sondersendungen bringen, kannst auch du als Selbstständige dein „Programm“ ändern und über die Krise sprechen.
Keine Angst übrigens, dass deine Expertise dadurch Schaden nimmt. Menschen brauchen in Krisenzeiten vor allem eins: andere Menschen.
Ob du deine für die Veröffentlichung geplanten Blogartikel und Social-Media-Posts auf Eis legst, musst du selbst entscheiden.
You do you.
❌ Falsche Informationen teilen
Mit Reichweite kommt Verantwortung.
Je mehr Reichweite wir haben, desto penibler sollten wir darauf achten, welche Informationen wir auf unseren Kanälen weiterverbreiten.
Vor allem Social Media lädt quasi dazu ein, vorschnell etwas zu teilen, das uns emotional berührt – nicht selten bewusst gestreute Falschinformationen.
Wie du Fakten auf ihre Echtheit überprüfst, erfährst du unter anderem hier.
✅ Geld verdienen während einer Katastrophe
Wenn du deine Arbeit plötzlich als banal empfindest … keine Panik. Egal, wie sehr du deinen Job liebst – das meiste auf dieser Welt wird klein und unbedeutend im Angesicht von Krieg, Leid und Pandemien.
Ich würde zu diesem Zeitpunkt deshalb keine voreiligen Entscheidungen („Ich schmeiss alles hin, denn mein gesamtes Business ist total sinnlos.“) treffen, sondern die Reflexion und Transformation auf später verschieben, wenn ich mich an die neue Situation adaptiert habe. (Gleich mehr dazu.)
Du darfst natürlich auch in Krisenzeiten Geld verdienen.
Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Geld verdienen während einer Katastrophe und Geld verdienen mit einer Katastrophe.
die Bäckerin, die weiterhin Brötchen backt
die Busfahrerin, der weiterhin Menschen von A nach B bringt
der selbstständige Yogalehrer, der weiterhin Kurse anbietet
die Marketingberaterin, die weiterhin andere Selbstständige berät
Sie alle haben gemeinsam, dass sie weiterhin ihrem Beruf nachgehen und Geld verdienen.
Daran ist erst einmal nichts Verwerfliches.
Denn egal, ob du nun angestellt, verbeamtet oder selbstständig bist – selbstverständlich brauchst du auch während einer Pandemie oder eines Krieges in Europa Geld zum Leben.
Doch im Gegensatz zu Angestellten bekommst du als Selbstständige kein festes Gehalt auf dein Konto, sondern musst selbst dafür sorgen, dass neue Aufträge reinkommen.
Und das kann in Krisenzeiten, wenn es dir selbst nicht gut geht, eine große Herausforderung und hohe Belastung sein.
Es kann sich merkwürdig anfühlen, Workshops zu halten und Logos zu designen, während es anderen Menschen so schlecht geht.
Verständlich.
Aber du darfst es.
Wirklich.
✅ Auf veränderten Bedarf reagieren
Es ist aus meiner Sicht auch nicht verwerflich, auf einen veränderten Bedarf zu reagieren.
Wenn du Meditationstrainerin bist und nun einen Beitrag leisten kannst, damit Menschen ihre Ängste und Sorgen verarbeiten und in diesen schweren Zeiten etwas Ruhe und Frieden finden, dann brauchen wir dich.
❌ Geld verdienen mit einer Katastrophe
Anders sieht es aus, wenn du Geld mit der Katastrophe zu verdienen planst.
So wie zu Beginn der Corona-Pandemie „clevere“ Unternehmer die damals beim medizinischen Personal so dringend benötigten FFP2-Masken aufkauften, um sie um ein Vielfaches weiterzuverkaufen.
So wie Politiker Maskendeals abschlossen.
Oder wenn jemand vulnerable Gruppen und von der Krise betroffene Menschen ausnutzt, um sich zu bereichern.
Ein ganz klares: Nope.
Mögen diese Menschen im Dunkeln auf einen spitzen Legostein treten.
#5 Heilen
Kommen wir zum letzten Punkt. Der Heilung.
Denn auch wenn wir es uns zu Beginn einer Krise nicht vorstellen können, aber wir Menschen haben die verrückte Eigenart, dass wir uns irgendwie an die äußeren Umstände anpassen.
An Wirtschaftskrisen.
An Pandemien.
An Krieg.
Meist gehen wir gestärkt aus einer Krise hervor und bauen Resilienz auf – auch als Selbstständige.
✅ Zeit zum Trauern
Zunächst einmal brauchen wir aber Zeit zum Trauern.
Selbst wenn wir niemanden im Krieg verloren haben, haben wir etwas anderes verloren: eine bestimmte Art von Zukunft.
Eine Zukunft in Gesundheit.
Eine Zukunft in Frieden.
Eine Zukunft in Sicherheit.
Wir brauchen Zeit, die Zukunft zu betrauern, die wir nicht mehr haben werden, weil jetzt Krieg herrscht.
Diese Tage und Wochen der Trauer fühlen sich schwer an, keine Frage. Aber sie sind so unfassbar wichtig, um weiterzumachen.
✅ Reflexion
Wenn sich die Welt verändert, verändern wir uns auch.
Als Menschen, aber auch als Selbstständige.
Um gestärkt aus einer Krise hervorzugehen, kannst du innehalten und nachspüren, was die Geschehnisse mit dir und deinem Unternehmen gemacht haben.
Frage dich:
Was ist es, das ich jetzt verstanden habe?
Was hat sich als wirklich wichtig herausgestellt?
Was habe ich über mich und andere Menschen gelernt?
Welche Privilegien haben sich in der Krise offenbart?
Haben sich meine Werte verändert?
Haben sich meine Ziele verändert?
Alle Antworten, die du auf deine Fragen findest, sind in Ordnung.
✅ Transformation
Wenn etwas gehen muss, können wir daran festhalten oder es gehen lassen.
Deine Nische.
Deine Produkte.
Deine Website.
Deine Wunschkund*innen.
Wir können alles loslassen, was durch die Erfahrungen aus der Krise nicht mehr passt – und Platz für Neues machen.
💡 Tipp zum Schluss: Notgroschen tut gut
Ich kann die Bedeutung eines Notgroschens für Selbstständige nicht genug betonen.
Selbst wenn in Europa Krieg herrscht – Rücklagen in Höhe von 3–6 Monatsgehältern schaffen zumindest Frieden im Hirn.
Mir persönlich tut es gut, zu arbeiten und mich ein Stück weit abzulenken.
Doch das Wissen, dass ich mir keinen Druck machen muss und einen Plan auch mal verschieben kann, hilft, nicht in Panik zu verfallen und geduldig mit mir zu sein.
Es ist in der Onlinewelt vielleicht ein ungewöhnlicher Rat, aber:
Spar dir das Geld für den drölfzigsten Onlinekurs (ich bin mir sicher, dass du eh schon genug weißt) und leg das Geld lieber beiseite, damit du im Fall der Fälle Rücklagen hast.

Themenwünsche?
Wenn dir ein wichtiges Thema im Blog fehlt, sag mir gerne Bescheid. Ich freue ich mich auf deine Nachricht.