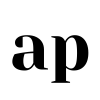Quit Playing Games With My Art: Kritik, negatives Feedback und Absagen
In dieser Podcastfolge spreche ich darüber, wie wir als Autor*innen mit Kritik, respektlosen Kommentaren und Absagen umgehen können. Ich teile meine eigenen Erfahrungen aus zehn Jahren Bloggen, fünf veröffentlichten Büchern und zahlreichen Bewerbungen, und erzähle, welche Formen von Kritik wirklich hilfreich sind und welche wir getrost ignorieren dürfen.
Folge anhören
Transkript lesen
Ganz ehrlich: Ich mach diese Folge nur wegen des Titels.
Na ja, nicht nur, aber „Quit Playing Games With My Art“ – das ist schon … ja, was soll ich sagen.
Genau, es geht um Kritik heute.
Um negatives Feedback.
Um blöde Kommentare.
Um fiese Rezensionen.
Um Absagen.
Und was es nicht noch alles gibt, wenn mensch schreibt.
Ich selbst kenne einiges. Ich habe seit fast zehn Jahren einen Blog und Newsletter. Und zwei Bücher im Selfpublishing veröffentlicht und drei im Verlag. Und ja, ich bekomme da nicht immer nur positive Rückmeldung zu dem, was ich mache.
Und wie ich als Autorin damit umgehe, das möchte ich in dieser Folge erzählen.
Ach ja, du hörst übrigens den Podcast SMELLS LIKE WRITING SPIRIT. Wenn du jetzt was über Immobilien oder Yoga hören wolltest, dann bist du hier nicht richtig.
Gut, haben wir das geklärt.
Wann Kritik für Autor*innen wichtig ist
Kritik. Wer mag Kritik? Vermutlich mag niemand Kritik. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem als Autor*in.
Zunächst einmal sollten wir festhalten, dass Kritik nicht per se schlecht ist. Wer schreibt, will ja den bestmöglichen Text aus sich herausholen.
Und da ist es natürlich nötig, das, was man schreibt, auch zu reflektieren und zu überarbeiten. Und da sind kritische Gedanken wichtig.
Wir müssen das, was wir schreiben, aus einer gewissen Distanz betrachten und uns fragen, ob wir da die richtigen Worte gefunden haben, was fehlt, was zu viel ist, was unklar ist, was vielleicht klischeehaft ist und so weiter.
Und diese kritische Arbeit macht einen Text definitiv besser.
Insofern plädiere ich jetzt überhaupt nicht dafür, Kritik vollständig zu eliminieren.
Kritik ist in dieser Hinsicht super wichtig.
Es gibt noch eine zweite Form von Kritik, die ich total wichtig finde. Und zwar ist es das Feedback aus dem Lektorat, Korrektorat oder Fachgutachten.
Ich hab bisher ja nur Fachbücher oder ein Sachbuch mit Verlagen gemacht. Aber ich konnte schon immer davon ausgehen, dass wir dasselbe Ziel hatten: nämlich das bestmögliche Buch zu schreiben und dann zu veröffentlichen.
Und wenn die Person, die das Lektorat macht, feststellt, dass es inhaltliche oder sprachliche Probleme gibt, dann muss sie mich natürlich darauf hinweisen. Und wir werden dann so lange kritisch an dem Text feilen, bis er in Ordnung ist.
Das gedruckte Buch hat manchmal nicht mehr so viel mit dem allerersten Entwurf zu tun. Und das ist auch gut so.
Buchschreiben ist eben ein langer Prozess und erfordert viel kritisches Nachdenken.
Ja, das klingt alles plausibel, hoffe ich. Aber als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, hatte ich selbst mit diesen Formen von Kritik so meine Probleme.
Ich hatte diese idealisierte Vorstellung, dass ich in einem vollkommenen Moment der Inspiration wunderschöne Worte zu Papier bringe, die über jeden Zweifel erhaben sind.
Und ich konnte mir damals einfach nicht vorstellen, was es an dem, was ich mache, überhaupt zu kritisieren gäbe. Und bei meinem ersten Verlagsbuch habe ich es dann auf die harte Tour gelernt.
Ich habe mit dem Lektorat zum Beispiel über Wochen nur an der Gliederung gefeilt und immer wieder Rückmeldung erhalten, was ich noch verändern könnte. Und musste mich eben sehr schnell damit arrangieren, dass Bücher und Texte sich entwickeln dürfen und dass der erste Entwurf genau das ist: ein Entwurf, mit dem man als Autor*in arbeiten muss.
Es ist nichts Persönliches und hat nichts damit zu tun, dass man nicht schreiben kann oder so.
Es geht darum, das Beste aus einer Buchidee herauszuholen. Und das geht durch Arbeit am Text.
Und ich merke auch, jetzt nach drei veröffentlichten Büchern kann ich diese inhaltsbezogene Kritik auch viel besser von mir abgrenzen.
Also wenn jemand sagt: „Ich würde noch das in die Gliederung packen“ oder „Das würde ich streichen“, dann nehme ich diese Tipps dankend an und schaue, ob sie für mich Sinn machen oder nicht.
Ja, das sind die berechtigten oder sogar erwünschten Formen von Kritik, die Autor*innen auch wirklich weiterbringen.
Amazon-Rezensionen
Aber daneben gibt es ja auch noch weitere Formen von negativem Feedback, die Autor*innen nicht unbedingt weiterbringen, und die wir uns dann vielleicht nicht so sehr zu Herzen nehmen sollten.
Zum Beispiel: Amazon-Rezensionen.
Das ist ja sowieso so eine Sache, dass wir in Zeiten leben, in denen alles bewertet werden muss.
Und wenn wir jetzt 1000 Stunden oder noch mehr dafür aufwenden, ein Buch zu schreiben, das über Monate oder sogar noch länger machen, und dann jemand in einer Rezension schreibt: „Was ein Kack-Buch!“
Dann ist das einfach erst mal extrem respektlos und dann glaube ich nicht, dass Autor*innen so viel Erkenntnisgewinn daraus ziehen, wenn sie solche unhöflichen, unwertschätzenden Kommentare sich allzu sehr zu Herzen nehmen.
Und ähnlich sehe ich das auch mit Kommentaren oder Rezensionen nach dem Motto „Da wird ja gegendert, was ein Kack-Buch!“
Zum einen ist es in der Regel etwas, das Autor*innen nicht nur selbst entscheiden. Sondern der Verlag hat da auch meist eine eindeutige Position und will, dass die verlegten Autor*innen bestimmten sprachlichen Grundsätzen befolgen. Und deshalb ist das Gendern nicht nur eine private Entscheidung der Autorin oder des Autors, sondern hat auch sehr viel mit dem Verlag zu tun.
Und zweitens gibt es anscheinend auch Gruppen in Messengern oder auf Social Media, wo Menschen Bücher, in denen gegendert wird, gezielt posten und dann eben gezielt dazu aufrufen, sie negativ zu rezensieren.
Das heißt, das ist dann einfach nur ein Kulturkampf, der auf dem Rücken meines Buches geführt wird, und ja: Das hat dann eben nichts mehr mit meinem Buch zu tun. Also es ist ja keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern einfach nur eine pauschale Ablehnung aufgrund von inklusiver Sprache. Und warum sollte ich mich davon fertig machen lassen?
Ich habe im Gegenteil sogar angefangen, da kreativer mit solchen unnützen Kommentaren oder Rezensionen umzugehen.
Die Rezension, in der das Gendern kritisiert wurde, hatte ich zum Beispiel für ein paar Monate als Gag auf meiner Buchseite. Und da habe ich eben eine positive Rezension zitiert und diese Ein-Sterne-Rezension. Ich fand es irgendwie witzig und wollte ganz offen damit umgehen und auch einfach zeigen, dass mich das auch gar nicht tangiert.
Eine andere Idee, da kreativ mit umzugehen, sind Blackout Poems. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Du nimmst im Grunde den Text wie eine blöde Rezension zum Beispiel und druckst ihn aus und dann schwärzt du alle Wörter bis auf ein paar. Und die Wörter, die du dann nicht schwärzt, ergeben eben ein Gedicht.
Das finde ich auch eine tolle Möglichkeit, um blöde Worte in Kunst zu verwandeln.
Feedback von Familie, Bekannten oder Freund*innen
Aber manchmal bekommen wir negatives Feedback ja nicht von Menschen, die wir nicht kennen, sondern durchaus auch von Menschen, die wir kennen. Und das ist dann vielleicht noch schwieriger, damit umzugehen.
Und was ich in den letzten Jahren auf die harte Tour gelernt habe, ist, sich gut zu überlegen, wem man literarische Texte zeigt. Vor allem, wenn sie gerade erst geschrieben und noch unveröffentlicht sind.
Ich weiß, wenn man einen Text schreibt und sehr überzeugt von diesem Text ist, dann möchte man ihn am liebsten allen zeigen. Aber ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist.
Denn viele von denen, die dann solche Texte lesen, sind ja überhaupt keine Autor*innen und würden Texte dann aus einer Laienperspektive beurteilen. Und da ist die Frage, wem das hilft.
Also wenn ich jetzt beispielsweise eine selbstständige Handwerkerin wäre und ich würde zu jemandem, die überhaupt nichts mit Handwerken am Hut hat, sagen: „Hey, guck mal, was ich gebaut habe, was hältst du davon?“
Dann ist doch klar, dass ich da nicht unbedingt ein qualifiziertes Feedback bekomme.
Oder wenn ich Chirurgin bin und eine Wunde vernähe und jemanden, die nicht Chirurgin ist, frage: „Wie habe ich das gemacht? Gib mir mal Feedback!“, bekomme ich natürlich da auch nur eine Laienperspektive, die mir vermutlich nicht so viel bringen wird.
Und ich finde, an diesen Beispielen sieht man so schön, wie absurd es eigentlich ist, wenn Menschen, die eine bestimmte Expertise haben oder zumindest eine Fähigkeit ausbilden wollen, an ihr feilen, sei es jetzt Handwerk oder Chirurgie, Laien nach ihrer Meinung fragen. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Und genauso sehe ich es auch beim Schreiben. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, meine Texte jemandem zu zeigen, der oder die nicht selbst schreibt. Oder zumindest nicht selbst gerne liest und sich keine Gedanken um Sprache macht.
Ich glaube, dass man da sehr viel Frust vermeiden kann, wenn man die Menschen, denen man seine frisch geschriebenen und unveröffentlichten Texte zeigt, sehr bewusst auswählt.
Und wenn man dann die Texte zeigt, dann glaube ich, ist es super wichtig, das auch mit einer konkreten Frage zu verbinden, damit man auch was aus dem Feedback zieht.
Offene Fragen wie „Wie findest du jetzt meinen Text?“ oder „Was hältst du von meinem Text?“ – die sind schon eher schwierig, würde ich sagen. Sie setzen dem Lesenden dann mehr oder weniger die Pistole auf die Brust und machen super viel Druck.
Und dann bekomme ich als Antwort eben eine Meinungsäußerung wie „Ja, finde ich super.“ Oder „Hm, weiß nicht.“
Aber wenn man konkretere, zielgerichtere Fragen stellt wie „Was fühlst du, wenn du dieses Gedicht hörst?“ oder „Welche Bilder werden bei dir durch diesen Text erzeugt?“, dann bekommt man eben auch ganz konkrete Antworten, mit denen man dann weiterarbeiten kann.
Also wenn beispielsweise jemand antwortet: „Bei mir werden diese und jene Bilder erzeugt“, kann man sich ja fragen: Ist es das, was ich beabsichtigt hatte oder will ich im Text noch irgendwas anpassen?
Es wäre also gut, sich vorab zu überlegen: Was erwartete ich von diesem Feedback überhaupt? Geht es mir wirklich darum, dass ich an bestimmten Stellen im Text noch unzufrieden bin und da gerne Input hätte, wie ich das verändern könnte. Aber dann kann ich das dann eben ganz konkret erfragen, die Fragen ganz konkret auf diese Textstellen bezogen stellen.
Oder will einfach nur, dass mir jemand sagt: „Ja, ist gut. Kannste veröffentlichen.“ Oder: „Kannste einreichen.“ Und dann wäre für mich die Frage, warum man da überhaupt eine Erlaubnis dazu braucht.
Absagen
Und dann wären da ja auch noch die Absagen, mit denen Autor*innen umgehen lernen müssen.
Ich glaub ja inzwischen, Autor*in zu sein, heißt gar nicht, wer am besten schreiben kann.
Autor*in zu sein, heißt, wer am besten mit Absagen umgehen kann.
Denn Autor*innen haben es ständig mit Absagen zu tun.
Wir bewerben uns bei Verlagen und bekommen Absagen.
Wir machen bei Schreibwettbewerben mit und bekommen Absagen.
Wir bewerben uns bei Agenturen und erhalten noch nicht einmal eine Absage, sondern überhaupt keine Antwort, was natürlich als Absage zu verstehen ist.
Ich hab jetzt für diese Folge extra noch einmal gezählt: Ich hab mich seit dem Sommer 26 Mal irgendwo beworben: Sei es bei Ausschreibungen, bei Schreibwettbewerben, Lesebühnen und so weiter.
Und von diesen 26 Bewerbungen habe ich bisher 11 Absagen erhalten, 7 Zusagen und vom Rest habe ich bisher gar nichts gehört. Das muss jetzt noch nichts heißen, manche Sachen laufen auch noch, aber ja, auf jeden Fall sieht man ganz gut, dass man als Autor*in auf jeden Fall mehr Absagen als Zusagen erhält.
Und das ist ganz schön hart.
Wenn man schreibt (oder generell etwas Kreatives macht), steckt da ja immer ein Stück von einem selbst drin. Eine Absage fühlt sich dann an wie ein Urteil über die eigene Person, nicht nur über den Text.
Aber in Wahrheit bewertet die Jury ja nie dich oder mich. Sie bewertet einen Ausschnitt, in einem bestimmten Moment, vielleicht auch mit eigenen Vorlieben, Themenvorgaben, Platzbegrenzungen und so weiter. Und manchmal ist es auch schlicht Zufall oder sowas Banales wie das falsche Format, in dem man aus Versehen eingereicht hat.
Und trotzdem: Dieses Gefühl von persönlicher Ablehnung darf natürlich auch erst einmal da sein. Es ist sogar ein Zeichen dafür, dass mir und dir das, was wir tun, wirklich wichtig ist.
Nur darf es uns eben nicht auffressen.
Viele erfolgreiche Autor*innen erzählen, dass sie jahrelang Absagen gesammelt haben — teilweise Dutzende oder Hunderte — bevor jemand „Ja“ gesagt hat.
Es ist nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall, würde ich sagen.
Und ich glaube, dass ich nach ein paar Monaten schon so langsam davon ausgehe, dass ich eine Absage erhalte, wenn ich mich irgendwo bewerbe.
Das ist jetzt auch gar nicht so traurig, wie es vielleicht klingt. Ich meine damit, dass ich versuche, Absagen eher als was Normales anzunehmen und mich dann eher über eine Zusage freue.
Ich hab auch ein paar wirklich schöne Zusagen bekommen in den letzten Wochen, über die ich in den nächsten Podcastfolgen auf jeden Fall noch berichten werde.
Aber trotzdem zieht so eine Absage natürlich immer auch runter und ich will das einfach nicht mehr.
Ich hab deshalb beschlossen, dass Absagen mein neues Default-Setting werden.
Und sehe meine Aufgabe jetzt darin, mich bei mehr Ausschreibungen zu bewerben, damit einzelne Absagen dann leiser werden und emotional gar nicht mehr so mächtig sind.
Und dass ich dann irgendwann von der Stastik profitiere, weil Erfolg vielleicht nicht nur mit der Qualität der Texte zu tun hat, sondern auch mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit.